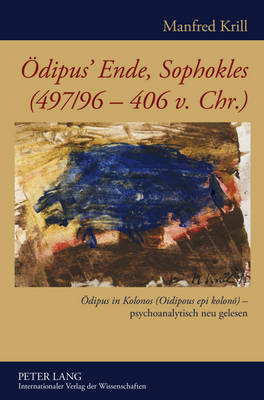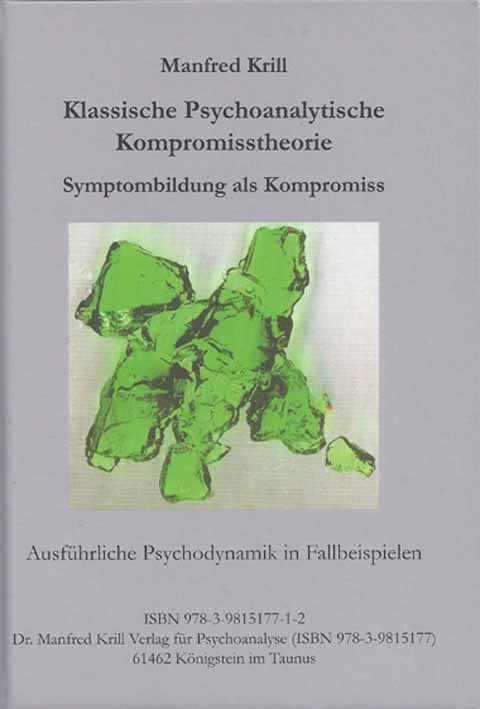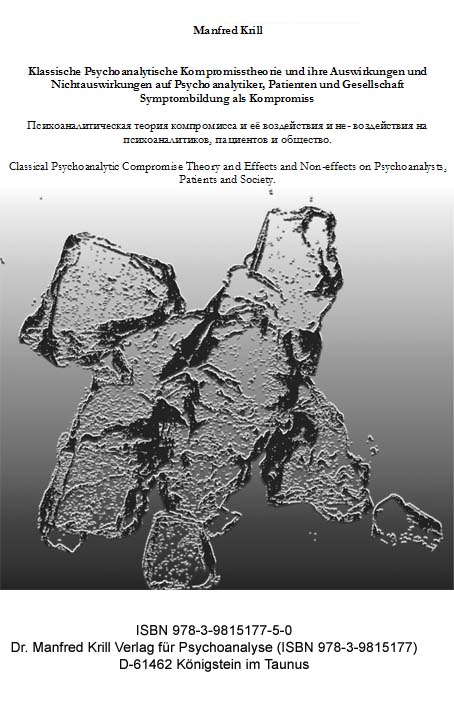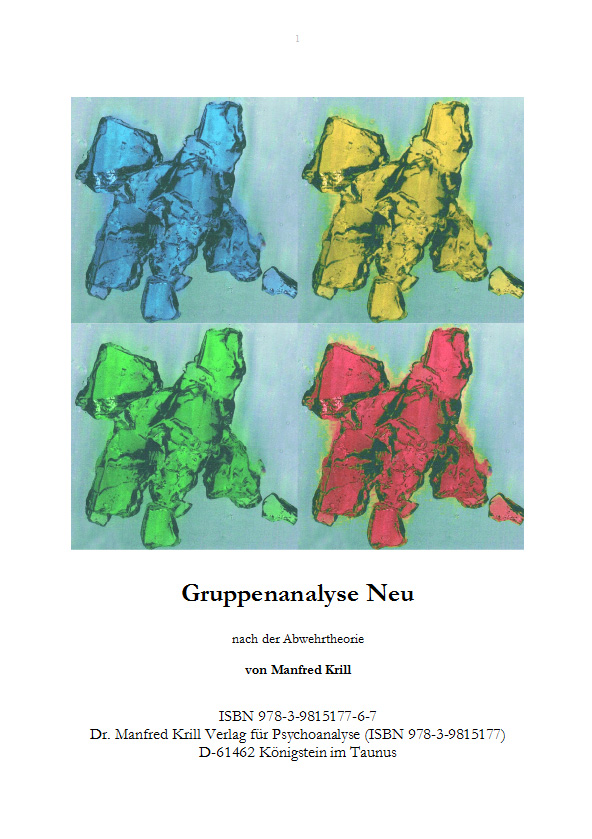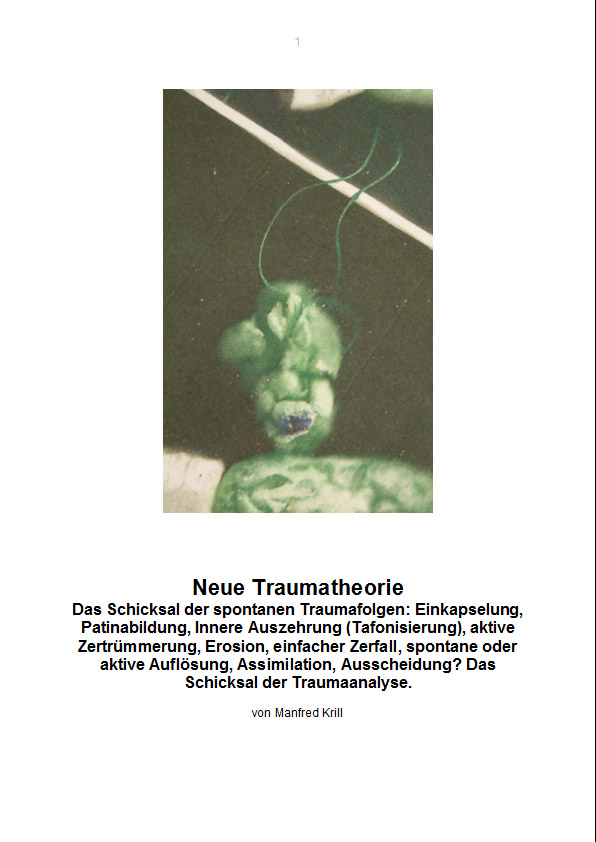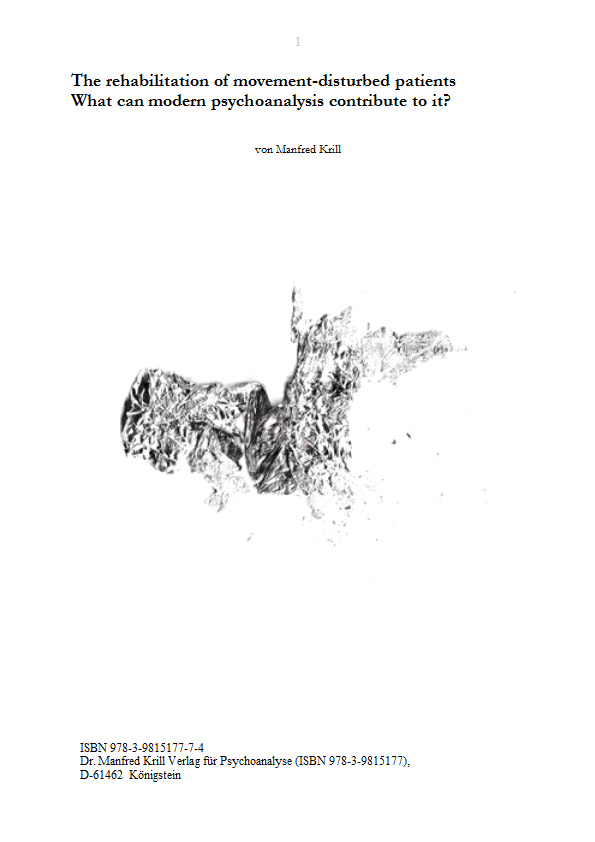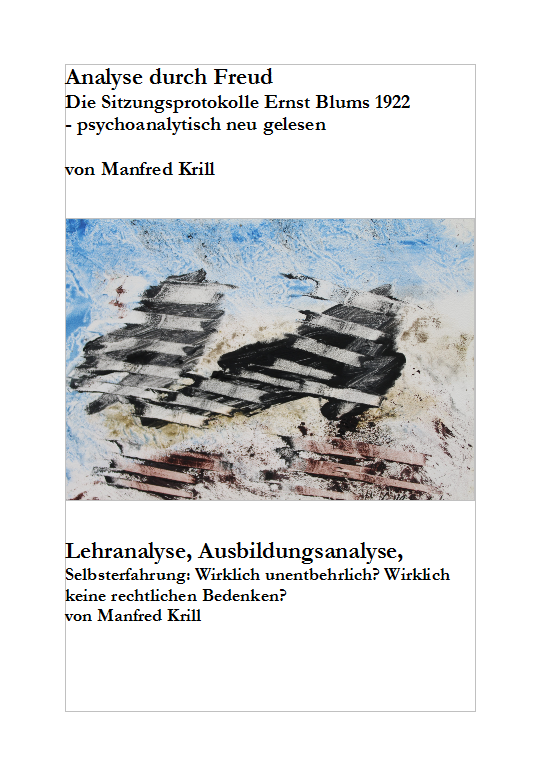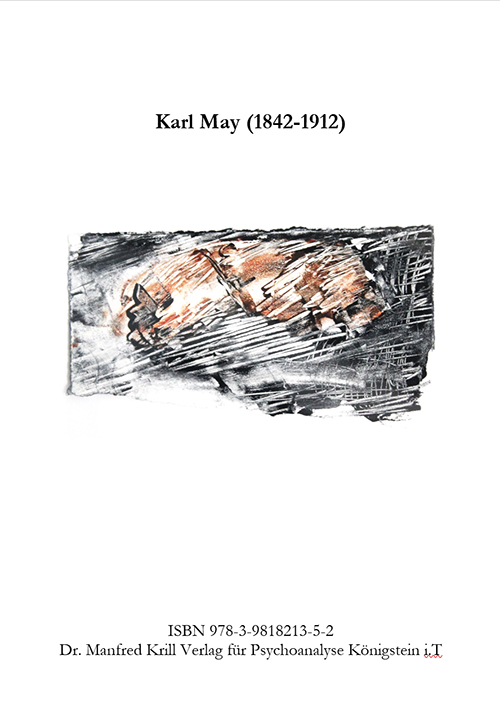Theater-
und Filmkritiken
X
Freunde
Liebe
(Haneke)
Work
hard, Play hard (Losmann)
Black
Swan
Frances
Ha
Burn After Reading
Burton Fink
„X Freunde“, Premiere im Schauspielhaus Frankfurt am 8.11.12, Autorin Felicia Zeller/ Regisseurin R. Bettina Breunier 8.11.12
Die
ersten 45 Min. reinste Sprechartistik, bewundernswert, diese Tempo, war
auch, wie zu erfahren war, schon vor Inszenierung gelernt, aber Theater ist
etwas anders als vorgetragene Literatur, ist keine Lesung.
Dann
setzte ein interessanter Kunst-Ton ein, leider nicht wiederholt. Dieser Ton
hätte einen Einstieg zur Besinnung sein können. War wie eine Erlösung von
dem Aufdringlich- Belehrenden (wenn auch Gescheitem), - die aber nicht
eingehalten wurde, denn der Ton hörte so hastig auf, wie er eingetreten
war. Die Regie hatte hier einen guten Einfall, hat aber nicht an dessen Wert
geglaubt, ihn nicht erkannt. So steht der Ton völlig isoliert da, schade.
„Gymnastische
Umsetzung“, wie es die Autorin gewünscht hatte (lt. Abschlussbesprechung)
nur ca. über 1 Std. nach Beginn erreicht (endlich Tanz), zu spät und nicht
ausdauernd genug.
Immerhin
sehr interessante Turnübung mit PC vor sich, - eine gute Erfindung der
Regie.
Sonst
war es nur Gehopse, Klamauk, zu plump, Stampfen, Springen, Draufschlagen,
und dies zu oft wiederholt.
Zu
viele Längen: 1 Wandverkleidung abreißen und draufschlagen, hätte
gereicht, 7 waren sinnlos, - das hörte und hörte nicht auf. Diese Idee der
leeren Wiederholung will zwar das Sinnlose der Leistungsgesellschaft
demonstrieren, entfernt sich aber nicht bühnenhaft genug vom Text. Der
Zuschauer kriegt es nur noch mal gesagt.
Die
Zahngeschichte zu derb, Zahn zu schwarz (so genau wollen wir Zuschauer es
auch nicht sehen), und noch die Zange und noch das Blut und noch der
Kollaps, - mag als Moritat-Einlage durchgehen, war aber dazu zu ausgedehnt,
mit Wiederholungen darin..
Besser
wäre, der Zuschauer entwickelt solche Phantasien, aber wie bringt man den
Zuschauer dazu? Ähnlich das viele Schreien: Zu laut, zu oft, zu
wiederholungshaft und gesucht, anlasslos, unmotiviert. Gefühl der
Peinlichkeit wie auch bei dem übrigen Drastischen. Schmerzhafter Gedanke:
Der Regie ging es mehr darum, dass es lebhaft zugehen sollte, - vielleicht
die Leute erschrecken, damit niemand sagen kann, er hätte sich gelangweilt,
- nach dem Prinzip: Mehr ist mehr.
Für
das trommelfeuerartige Einhämmernde des Textes kann die Regie nichts, aber
sie hätte kürzen und umwandeln können.
Funktionslos,
gesucht: Die Würfel (Philosophische Gedanken über die Strenge des Würfels:
Geschenkt). Guter Regieeinfall: Die Wogen des Firmennamens. Endlich mal vom
Sprechen erlöst, wie mit dem Ton.
Interessante
Szene erneut: Das Hochflattern und Niedersinken der DinA4-Blätter, aber
auch hier ergab die Wiederholung (1x) keinen Gewinn. Führt nur zu ärgerlichem:
„Das hatten wir doch gerade“. Erweckt den Eindruck, wie alle
Wiederholungen, von Ratlosigkeit. Soll sich der Zuschauer dumm fühlen? Als
ob er das erste Mal nicht mitgekriegt hätte?
Suizid:
Motivation dazu nicht entwickelt, kommt aus heiterem Himmel. Wirkt
konstruiert, gesucht. Nicht einleuchtend, nur von einem abstrakten Konzept
vom Elend der Leistungsgesellschaft eingepflanzt. Müsste stattdessen stückimmanent
und aus der Person des Spielenden hervorgehen. Intellektualisierung. Mühsame
psychologisierende Erklärungen sind auf der Bühne unangebracht.
Psychologie kann man besser in einem Lehrbuch nachlesen.
Insgesamt:
Regie
hat zu wenig gemacht, hat sich zu sehr an den Text gehalten. Ihn
wiederzugeben, reicht nicht für eine Insz. Sie hat sich vom Text erschlagen
(besser: pisacken lassen von tausend Nadelstichen, Maschinengewehr..) lassen
wie die Zuschauer und die Spieler, - alle sind erschossen. Stattdessen Idee:
Pause , mit einem seltsamen, entfremdenden Ton und völliger Erstarrung in
einer Pose. Dann wieder los im Eiltempo. Dann hätte man die 1,5 Std.
Pflichtzeit ebenfalls halten können. Die kurze Besinnung im Stück bei der
Hauptdarstellerin reichte nicht. Sie war todmüde (und krank, wie hinterher
zu erfahren war), dies hätte sie in diesem Fall sogar zeigen sollen.
Der
Zuschauer kriegt alles endlos eingetrichtert, ihm wird alles, alles bis in
alle Einzelheiten erklärt (daran ist aber die Autorin schuld), eingehämmert,
auf Auge gedrückt, wird selbst atemlos, hat zu wenig Raum für sich, sein
Nachdenken, seine Bilder zu entwickeln. Seine Phantasien werden zugeschüttet
von der großen Ausschüttung der Worte und klugen Sätze.
Im
Vgl. zu Brecht wird hier nicht nur belehrt, sondern in einem Irrsinnstempo
und mit lauter scharfsinnigen Sätzen. Zuschauer ist so doppelt entmündigt.
Bei Brecht hatte er noch Zeit zur innerlichen Gegenwehr und Vorausdenken,
hier hat er Mühe, mitzukommen.
Die
Eintönigkeit und Tödlichkeit der Über-Leistung werden verdinglicht und
aufgezwungen, statt diese im Zuschauer entstehen zu lassen. Es fehlt die
Verwandlung.
Ähnlich
die Spieler: Vor lauter Sprechkunst hat der Zuschauer keine Gedanken über
die Innenwelt der Spieler. Was geht in diesen vor, habe ich mich oft
gefragt. Wollte die Autorin zeigen, dass sie kein Innenleben haben? Wenn ja
(was ich nicht glaube), fehlt die Verwandlung. Die Spieler haben wie die
Regie zu sehr ihre Person aufgegeben, zugunsten einer virtuosen
Durchleitungsfunktion, wie wohl schon die Autorin, die, sensibel für die
Leistungsgesellschaft und ungeheurer gescheit, sich von dem Druck, den sie
spürt, erleichtert und ihn zu ungefiltert weitergibt, an die Regie,
zusammen mit der Regie, an die Spieler und alle auf den armen Zuschauer.
Dieser ist Opfer, Endstation einer Abfallröhre
ohne zwischengeschaltete Verdauung.
Zuviel
mit Fakt vergewaltigt statt Verwandlung. Man kann nicht einfach die Qual
weitergeben an den Nächsten, den Zuschauer.
M.E.
Aufgaben d. Regie, d. Schausp. und d. Zuschauer: Respekt erleben vor der
Welt der Bühne. einer eigenen Welt.
Bloße
Weitergabe, also Durchleitung ist keine Kunstleistung. Auch nicht bloße
Umsetzung in Bewegung, Figuren. Nichts für ungut. Es ist sehr schwer, ein
solches Sprechkunstwerk auf die Bühne zu bringen, also umzuwandeln in eine
Bühnenwelt. Die Autorin ist wegen ihres hochgescheiten Textes in Mode, -
dies heißt aber nicht, dass sie auf Dauer auch eine gute Bühnenautorin
sein kann. Belehrungen, Eintrichterungen werden die Leute rasch leid.
Manfred Krill, Psychoanalytiker
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
ein
deutscher Film aus dem Jahre 2011
von
Carmen Losmann (Reg., geb.
1978)
gesehen
2014
Es
handelt sich um einen Dokumentarfilm, der die moderne Arbeitswelt mit ihren Grausamkeiten
bei der Prüfung („assessment“) von hochkarätigen Bewerbern denkbar
anschaulich, eben dokumentarisch, darstellt. Der Regisseurin darf man
gratulieren, dass sie die geniale Idee hatte und mit großer Ausdauer gegen
verständliche Widerstände verfolgt hat, Firmen dazu zu bringen, diese
Aufnahmen direkt an der Quelle zuzulassen. Hard work und hard play darf sich
also auch die Regisseurin unbedingt bescheinigen, und ganz frei von der
modernen harten Arbeitswelt kann also auch sie nicht sein. Um etwas zu
beschreiben, muss man mit Leidenschaft hineintauchen.
Die
Regisseurin gab zu verstehen, ihr habe es fern gelegen, den Film mit eigenen
Ansichten oder gar Empörung zu belasten, sondern sie habe einfach nur
filmen wollen, ohne sich all zu viele Gedanken zu machen. Eine
Bilderwelt machen heißt nicht, sich Gedanken zu machen. Nicht, dass sich
die Regie keine Gedanken machen könnte, aber dies ist nicht ihre primäre
Aufgabe. Die Gedanken seien erst hinterher gekommen. Gemeint ist wohl auch,
dass der Zuschauer sich selbst ein Bild machen solle.
Dies,
einen Film zu machen, ohne sich groß Gedanken zu machen, mag sein oder
nicht – nicht nur als Psychoanalytiker darf ich sagen, dass es keine
absichtslosen Filme geben kann und auch nicht zu geben braucht, will heißen,
dass immer unbewusste Motive,
schon bei der Auswahl des Bildmaterials und bei der ganzen Konzeption, kräftig
mitspielen oder, besser gesagt, die eigentliche Motivation, einen Film zu
machen, abgeben, und dass es nur erreichbar ist, dem Zuschauer einen
gewissen freien Raum zu geben, den er selbst ausfüllen darf.
Dies
hat die Regisseurin mit Bravour erfüllt, und dies ist schon viel an
wirklicher Filmkultur und Respekt vor
dem Betrachter, und dafür können wir Zuschauer sehr zufrieden und
dankbar sein. Respekt vor dem Betrachter und Respekt für die Regisseure
sind, wie immer, wechselseitig bedingt, und offene oder heimliche
Motivationen tun dem keinen Abbruch.
Die
dokumentarische Aufgabe kann leicht zum Plakativen verführen, aber auch
diese Gefahr hat die Regisseurin wohl gesehen und im Großen und Ganzen
gemeistert. So ist doch im Mienenspiel der grausamen Prüfer deutlich zu
sehen, dass sie innerlich menschlich
empfinden und sich von der vorgeschriebenen Prüfungsprozedur mit deren
Quälcharakter und deren auch ins Intimleben eindringenden Fragen sichtbar
distanzieren. Sie geben dem geplagten Prüfling zu verstehen, dass sie
selbst es nicht so hart meinen, dass sie aber so vorgehen müssen. Auch in
den Gesichtern der Prüflinge gewittert es, man spürt die innerliche Wut über
die Zumutungen der Firmenleitung, die das Prüfungsschema ausgeheckt hat,
und keineswegs nur Gehorsamkeit und Anpassung,
- wobei diese allerdings auch gar nicht gefragt sind, es also auch
keine besondere Errungenschaft sein kann, widerständig zu sein.
Widerständigkeit
der Prüflinge ist sogar ein Pluspunkt,
und dies nagt an der Durchschaubarkeit der inneren Abläufe. Der Zuschauer
hat aber auch hier die Freiheit, sich vorzustellen, wie es ihm erginge.
Zweifellos fühlt sich der Zuschauer beklommen vor Angst und nicht weniger
angewidert. In Vielen mag der tröstende Gedanke aufkommen, man selbst sei
von so etwas verschont, und im Übrigen seien die Prüflinge selbst schuld,
denn wer habe sie geheißen, sich um derart hochbezahlte Spitzenstellungen
zu bewerben? Vielleicht waren sie selbst es gar nicht, sondern ihre Ehefrau,
ihre Freundin? Darüber will der Film keine Auskunft geben. Dies ließe sich
aber ebenfalls filmen. Dies würde dem Dokumentarfilm eine neue Dimension
hinzufügen.
Inhaltlich
geht es um gnadenlose Berechenbarkeit des Menschen, um totale Planbarkeit, um
abgesicherte Voraussagen. Auch die Prüfer selbst stehen unter Druck. Man
weiß auch in der Firma, dass die Prüfergebnisse wenig über die tatsächlichen
Erfolge der Auserwählten für die Firma aussagen, die ganze harte Auswahl
sogar nur Schaden für die Firma gebracht hat, aber die Prüfer müssen sich
nach oben rechtfertigen und dazu eine umfangreiche Dokumentation vorlegen,
die beweist, dass sie die Vorgaben der Firma bei der Prüfung erfüllt
haben.
Aber
auch die menschliche Seite der Prüflinge wird manchmal angedeutet, so, dass
eine Frau, die geprüft, somit gequält wurde, einen
auf das Unangenehmste quergehenden, huhnähnlichen Lachzwang entwickelt
(der kann aber nicht authentisch sein, dürfte ein leicht antifeministischer
Kniff der Regisseurin sein, mit dem sie ganz elegant und nebenbei wohl ihre
ehrgeizigen Geschlechtsgenossinnen und die Hilflosigkeit ihrer Opposition
aufs Korn nimmt), der die Geduld der Prüfer auf eine harte Probe stellt und
zu Befremden zwingt, und wenn man sehen kann, wie sie hinterher im Hof der
Firma sitzen, wohl das Ergebnis abwartend, und in üblicher Weise Kontakt
zur Außenwelt (zu ihren Angehörigen?) aufnehmen. Sie entziehen sich dem
Weiteren, auf das sie vielleicht ohnehin keinen Einfluss mehr haben, und
kehren zu ihren normalen menschlichen Beziehungen zurück. Man kann auch
sagen, sie lassen sich davon durch nichts abhalten, sie halten an ihnen
fest, und die harte Prüfung war eine Episode. Sie lassen sich nicht
kaputtmachen, - so leicht denn doch nicht.
Was
die Regisseurin nicht zeigen konnte, ist natürlich das feinere Innenleben der Prüflinge. Belastungen wie die hier
gezeigten lassen sich gut filmen, aber wohin sie führen und ob sie überhaupt
zu etwas führen, kann und will ein Film nicht so leicht zeigen. Jede
Belastung führt zu einer Reaktion des Belasteten, aber zu welcher? Insbesondere führen Belastungen nicht automatisch zu Krankheiten, nicht
einmal zwangsläufig zu inneren Konflikten, - dies wird zu oft vergessen.
Nur
Soziologen können zufrieden oder hochzufrieden sein, wird hier doch die
Schlinge vorgeführt, welche die moderne Arbeitswelt, wie schon
Mitscherlichs – angebliche oder tatsächliche- „Unwirtlichkeit unserer
Städte“, um den Hals der Menschen zieht, drastisch und mit anklagendem
Unterton, mit dem der Zuschauer ohne weiteres mitschwingen kann / muss.
Aber
dies ist nur die halbe Miete, denn für das Innenleben bleibt das Interesse
schwach oder fehlt ganz. Eine Schlinge, eine Gemeinheit, eine Unwirtlichkeit, - na und? Manch
einer findet, dass man in der
Unwirtlichkeit Frankfurts einmal so richtig durchatmen kann, wenn man
sich zuvor in Regensburg aufzuhalten hatte (persönliche Mitteilung von Günther
Ammann, ehem. Direktor des MMK Frankfurt bis 2001, ca. 2003).
Und
die menschenfreundliche, ja herzliche Atmosphäre im Kohlenpott, diesem früher
unwirtlichsten Szenario, ist sprichwörtlich. Gerade das Unwirtliche bringt
vielleicht die Menschen am besten zusammen, weil sie durch „Wirtliches“
nicht von einander abgelenkt werden und aneinander Trost suchen. Die
Ungeborgenheit, die man in einer Glas- und Betonstadt fühlt, führt eher
dazu, sich die Geborgenheit woanders und auf andere Art zu verschaffen. Wie
sind die Menschen in der ländlichen Einöde und in kleinen, intakten Orten
zueinander?
Die
Millionen von Landflüchtern haben sich geirrt. Sie hätten vorher
Mitscherlich lesen und einen Soziologen, vorher und hinterher, fragen müssen,
vor allem hinterher, damit sie sich besinnen können. Nun haben sie
respektlos einfach mit den Füßen abgestimmt und wollen das partout nicht
ändern.
Dies
alles ist aber nicht der Regisseurin anzulasten. Denn Filme halten per se
Oberflächenphänomene fest, für psychische Tiefe sind sie nicht zuständig,
wenn sie diese auch suggestiv vorspiegeln können oder der Zuschauer in günstigen
Fällen dazu innerlich Raum hat. Hier können sich dann auch die
Interpreten, ob psychoanalytisch geschult, halbgebildet oder gar nicht
gebildet, austoben.
Von
Abwehr unbewusster Wünsche, darunter auch aggressiver, Ängste, Schuld- und
Schamgefühle haben sie anscheinend nie etwas gehört oder sie haben
vergessen, was sie einmal
gelernt hatten, wenn sie es überhaupt jemals gelernt hatten. Sie möchten
lieber Einfühlungsathleten, „Empathie“-Künstler, sein. Vor nichts hat
ein heutiger Psychoanalytiker, aber nicht nur er, so Angst wie vor der
ausdauernden, handwerklichen Beschäftigung mit dem inneren Konflikt und
namentlich der sog. Abwehr. Wie kann man dann vom Film Besseres erwarten?
Ein Film mit einem Mienenspiel ja. Ein Film über innere Konflikte? Nein.
Scheintiefsinn? Ja.
Einen
ausgebufften Filmemacher (als
Funktion gemeint) berührt dies wenig. Er dürfte eher verdutzt
sein über die vielen klugen Kommentare zu seinem Bildwerk, das immer
auch ein Blendwerk ist, weil es fast nur die manifeste Seite zeigt.
Deshalb
haben sich Filme und Psychoanalyse so wenig zu sagen,
obwohl jetzt analytische Filmbesprechungen in Mode gekommen sind.
Hoffentlich nicht nur, weil Psychoanalytiker gern überall mitreden möchten,
d.h. die selbst versteckten Eier in dem erfundenen Patienten „Film“
auffinden möchten. Ein Schelm, wer denkt, sie seien unzufrieden mit ihrer
Arbeit und gingen in die Flucht, in die Ausflucht, - durch vorgetäuschtes
Expertentum auf einem fremden Gebiet. Tatsächlich sind sich Psychoanalyse
und Kunst nicht grün, allem fleißig Gedruckten und Gesprochenem zum Trotz.
Regisseure
sind hierin realistischer als Psychoanalytiker mit ihrer romantischen
Sehnsucht nach Verlassen des Behandlungszimmers und Eintauchen in die weite
Lichttheaterwelt. Regisseure
versuchen gar nicht erst, die Psychoanalyse zu befruchten. Es tut ihnen
begreiflicherweise lediglich gut, wenn sie bereitwillige Psychoanalytiker
auf sich aufmerksam machen können, und sie können auch nichts dagegen
haben, bei psychoanalytischen Besprechungen in persona zu erscheinen.
Ich
möchte hier eine neue Filmidee einbringen: Dokumentarfilme durch das
Darstellen von inneren Vorgängen in Opfern und Tätern zu ergänzen. Erst
dann hätte man eine tragfähige Aussage über beide. Dies ist freilich
schwierig, aber nicht unmöglich. Aber womöglich todlangweilig. Denn Filme
leben von Bildfolgen und sind kein Unterricht, das Unterrichten überlassen
sie Anderen, die dafür zuständig sind und die das besser können. Ein
neues Genre? Auch mit einer derartigen neuen Aura hätte der Film
noch schlechte Karten. Denn aufklären kann man sich besser durch Lesen als
durch Filme, und Psychoanalyse lernt man besser durch eigene Behandlung von
Patienten als durch Filme. Also lasse
man Filme Filme sein.
Aber
dies fällt Vielen schwer. Es wäre ja gelacht, wenn man Film als eine
eigene Kunstgattung, als eine eigene Welt, eine Bühnenwelt, auffassen müsste,
womöglich als Lichtspiel-Theater, nicht wahr? Wer lacht mit?
Dr.
med. Manfred Krill, Arzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychoanalyse
1.7.2014
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(ergänzt)
Film
Black Swan
US-Psychothriller
2010
Hauptdarstellerin:
Natalie Portman
Darsteller:
Vincent Cassel, Mila Kunis
Regisseur:
Darren Aronofsky
Subjektive
Einschätzung und Wertung, ohne Gewähr, im Zweifelsfall ungültig. Für die
Richtigkeit übernehme ich keine Verantwortung, keine Haftung.
Auf
den Inhalt wird hier mit Absicht nicht eingegangen. Dafür sind Andere da.
Der
Regisseur hat sich hier einen Kameramann gewählt, der es auf eine möglichst
rasche Bildfolge, dazu noch unter eifrigem Zoomen, anlegt, als wenn dies
heute noch ein Kunststück wäre, bzw. ihn dazu beauftragt, denn für diesen
Unsinn ist der Regisseur verantwortlich. Natürlich weiß der Regisseur,
dass dies kein Kunststück ist, aber er möchte den Zuschauer erschrecken,
fesseln, ihnen keine Zeit für eigene Gedanken und Gefühle lassen, kurzum
ihn nach allen Regeln der Unkunst, des billigen Tricks, manipulieren.
Dabei
schreckt er auch nicht vor ständigen, monotonen Wiederholungen zurück. So
zeigt er immer wieder, bis zum Erbrechen, die obere Rückenpartie, mal
angekratzt, mal nicht, und dem Nacken von Frauen, im Stehen oder im Gehen
auf und ab wippend, ebenso immer wieder das Gesicht der Hauptdarstellerin
mit deren fürchterlich steril hoch gezogenen Augenbrauen und anderer Frauen
im Großausschnitt, für den der Bildschirm regelmäßig nicht reicht, nicht
reichen soll. Diese Marotte – und sonst ist nichts dran - ist kolossal ermüdend.
Dem Zuschauer wird immer wieder Gleiches aufgedrängt. Der Regisseur ist
selbstverliebt in seine überwertige Idee vom Rücken und übergroßem
Antlitz dieser Frau und anderer Frauen. Auch die zweite Hauptfigur, der
Ballett-Regisseur, ist zu dick aufgetragen als Herrscher, als bellendes
Ungeheuer, als Sadist, ebenfalls mit ermüdenden Wiederholungen und
ebenfalls riesengroßen Darstellungen seines Gesichts, als ob in diesem die
Wahrheit zu lesen wäre, wie schon mit dem Gesicht der Hauptdarstellerin fälschlich
beansprucht.
Der
Regisseur möchte darstellen, wie seine Hauptfigur erwachsen wird. Dazu lässt
er sie gleich zweimal. einmal die Kleinkinderspielsachen und dann die Puppen
aus späterer Zeit, durch den Müllschlucker hinunterpoltern. So einfach und
sinnfällig wird also die Kindheit entsorgt, so wird man also erwachsen.
Einmal reicht nicht, es muss zweimal sein, nach dem Motto: Und willst du
nicht einsichtig sein, so hau ich dir den Schädel ein, und daran ist
erkennbar, was der Regisseur den Zuschauern an Eigenleistung zutraut oder
ihnen überlassen will: Nichts, - er will alles selbst machen.
Der
Zuschauer will aber nichts, gar nichts, eingehämmert haben. Er möchte sein
eigenes Gehirn arbeiten lassen und selbst Schlüsse ziehen dürfen und nicht
bevormundet, entmündigt werden. Man kann Filme unter dem Gesichtspunkt
betrachten (und im Wert einordnen), wieweit der Zuschauer mittels des immer
stark suggestiven visuellen Mediums entmündigt wird. Der Regisseur als
Vormund des Entmündigten? Dies können wir ihm nicht erlauben. Dies ist
bestimmt nicht seine Aufgabe. Er ist für die Umsetzung in die Kunst der Bühnen-
Theater- Film-Welt zuständig.
Von
Klischees wird reichlich Gebrauch gemacht. Das längst abgehalfterte,
abgenutzte, von Analytikern ergebenst abgelutschte Spiegelmotiv samt
Scherben mit der angeblichen Rätselhaftigkeit darf natürlich nicht fehlen,
auch nicht Blut und Messer (Romantizismus aus der Mottenkiste! Alt- Inventar
der Schauspielerei! Mackie Messer!) sowie andere Anspielungen auf Sado -
Masochismus oder auf eine Psychose, diese laienhaft, aber mit dem Anspruch
eines erfahrenen Kenners vorgetragen. Der Regisseur weiß es, und wir können
viel von ihm lernen. Durch ihn haben wir erst ein Verständnis gewonnen, um
was es sich bei einer Schizophrenie, einem Borderline handelt.
Stellenweise
sinkt der Film auf das Niveau einer bloßen Moritat herab.
Zum
Schluss folgt erwartungsgemäß der Tod der Hauptdarstellerin. Anders konnte
der Regisseur nicht zum Ende kommen. Ihm fiel nicht anderes mehr ein.
Schluss aus und tot, fertig. Die Zeit war um, und man musste zu einem Ende
kommen, empfindet wohl jeder Zuschauer.
Der
Film bedient klischeehafte Erwartungen und versucht den Mangel an künstlerischen
Einfällen mit billigster, aufgeregter Kameratechnik in Form von atemlosen
Sprüngen von Gesicht zu Gesicht zu verdecken, auch hin und wieder mit einer
kleinen, dummen Effekthascherei, so wenn er einen Greis bei dem Anblick der
schönen Hauptdarstellerin in der U-Bahn sich sexuell erregen lässt oder
andere absichtsvoll bizarre kleine Begebenheiten einfügt. Er hat wohl die
Befürchtung, sein Publikum könnte einschlafen, also muss schnell ein
Knaller her, und die Befürchtung hat er zu Recht. Immerhin kann man, wenn
man dem Regisseur wohlwill, glauben, er habe ihren heimlichen Genuss zeigen
wollen, betrachtet zu werden und dabei einen Alten zu erregen (soll sie
deshalb nicht aufgestanden und weggegangen sein, wie sie es ja hätte tun können?).
Aber dies stünde zusammenhanglos da. Wozu hat er also diese Szene eingefügt?
Dies bleibt sein Geheimnis. Aber man darf an seinen Wunsch denken, sich
interessant zu machen, als einziges Motiv.
Selten
einen so langweiligen Film gesehen. Wenn es ein Patient wäre (aber das ist
er nicht, und deshalb gilt alles unter Vorbehalt, höchst subjektiv, ohne
Anspruch auf Gültigkeit, es gilt also nicht, nur Ideen), würde ich ihn als
Narzissten bezeichnen, der nur eines im Sinn hat: Eindruck machen, Sensation
machen, Bilderflut anordnen.
Zwischendurch
liefert er, der dies irgendwie selbst geahnt haben muss, brav einige gefällige
Häppchen von Machohaftigkeit, Sexualität oder Andeutungen davon, auch eine
ausgewalzte lesbische Szene musste hinein, für alle Fälle sozusagen, für
Jeden etwas. Auch von einer Psychose (aber übrigens von welcher Art genau?
Das interessiert ihn nicht) kennt der Regisseur nur das Wort und die Art,
wie Klein-Hänschen sich eine Psychose vorstellt. Etwas Bizarres, etwas
Abstruses reicht ihm dazu, auch und natürlich das Spiegelmotiv, denn Glas
ist gefühllos, kalt und splittrig, und wahrscheinlich möchte er damit auf
die angeblich gespaltene Persönlichkeit und Spaltung anspielen und möchte
hier, im Schlepptau zahlloser Vorgänger aus der Filmbranche, Tiefenanspruch
stellen. Und die Psychoanalytiker finden hier reihenweise ihr gefundenes
Fressen, haben nur auf so etwas gewartet, um loszulegen. Dazu ist das
Klischee von „Psychose“ immer gut.
Er
ist sich auch nicht zu schade dafür, das analytische Märchen aufzutischen,
nach dem das „Objekt“ in Wirklichkeit das Subjekt selbst ist, wie auch
umgekehrt. So wird die Ballettkonkurrentin von der Hauptdarstellerin
vermeintlich totgestochen, sodass diese „im Wahn“ schließlich die
vermeintlichen Blutspuren zudecken will, tatsächlich aber sich selbst
erstochen hat. Dies wird von ihr selbst, ihrem Dompteur und ihren
Kolleginnen erst bemerkt, als es zu spät ist. Der Regisseur verklärt sie
am Ende zu einer nahezu göttlichen Figur in Hell, strahlend und
siegessicher. Sie kann gerade noch mit seligem Lächeln sagen, dass sie
„perfekt“ war. Sie ist nun tot, von Beruf tot, einem neuen großartigen
Beruf und Nachruf. Daran ist psychiatrisch und psychoanalytisch richtig,
dass Narzissten ihren Tod in Kauf nehmen (Drogensucht, Magersucht), wenn sie
nur gewonnen haben (s. die zahlreichen Suizide berühmter Schauspielerinnen,
die hohe – bis zu 50 % -Todesrate von Anorexia- Nervosa –Kranken, der
wahren Meister im Hungern und Abnehmen sowie im Erniedrigen der
verzweifelten Mutter und der professionell Helfenden). Sie hat eine Anorexia
Nervosa einschließlich künstlich herbeigeführten Erbrechens in die
Toilettenschüssel. Dies war von vorneherein anzunehmen und schließlich
richtig dargestellt. Dort kommt nichts mehr heraus, weil sie sich schon
chronisch entleert hat, - hier einmal eine zweifellos gute Erfindung des
Regisseurs. Aber dieses daran Richtige hat den Regisseur nicht davon
abhalten können, mit seinem Psychosetrick und seinem abgehalfterten
Spiegeltrick Sensation und Gruseln erzeugen zu wollen. Nur naive Zuschauer können
heute auf so etwas noch hereinfallen.
Man
vergleiche dies mit Hankes Film „Liebe“ oder Filmen von Fassbinder. Dort
geht es den Menschen ebenfalls nicht gut. Diese oder andere große
Regisseure hätten solche Tricks, solche Manipulationen aber nicht nötig
gehabt. Dieses Unternehmen, an dem sichtlich das Herz des Regisseurs hängt,
wirkt durch und durch künstlich- aufgesetzt. Auch wenn hier die Anorexia
Nervosa in Teilen richtig angedeutet ist, ist man verstimmt, weil man die
Absicht des Regisseurs spürt, Sensation und Schreck zu verbreiten und sich
selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Dem Regisseur ist nichts zu schwör.
Er ist nicht bei seinen Figuren und nicht beim Stück, sondern nur bei sich
und seiner Eitelkeit. Er ähnelt der Schreckfigur des Dompteurs mit seinem
unangenehmen Bellen, dem brutalen Kinn und der Herrschsucht in seinen Zügen,
aber ich traue diesem Regisseur nicht zu, dass er sich hiermit durchschaut hätte.
Mit dieser Figur spielt der Regisseur - wohl unbewusst - sich selbst, und
zwar ohne Selbstreflektion, fürchte ich, aber vielleicht unterschätze ich
ihn auch in diesem Punkt. Man kann ja nicht in ihn hineinschauen. Hellseher
sind wir ja nicht.
Ein
Erfinder wäre der, der auf solche Klischees verzichtet und eine wirklich
eigene Idee bringt.
Auch
eine künstlerische Umwandlung der im youtube erhältlichen Pornoszenen ist
nicht zu erkennen, vielmehr ist die Ähnlichkeit und das Abgekupferte
peinlich offensichtlich, nur dass hier das Aufdringliche der Darstellung,
sozusagen für die ganz Dummen, die noch nie einen Porno gesehen haben, ganz
im Vordergrund steht, im Ggs. zu einem echten Porno, der den Zuschauer
immerhin noch atmen lässt.
Nichts
hilft, alle Versuche des Regisseurs, sich künstlerisch zu betätigen,
scheitern kläglich. Schwerfüßig aufstampfend, was im Gegensatz zu manchen
gut getanzten Szenen (die nicht vom Regisseur stammen können und auch tatsächlich
nicht von ihm stammen). Umso erstaunlicher, dass der Regisseur derart hinter
seinem vorgezeigten Gegenstand (Ballett), an dem er seine plumpen und kümmerlichen
Absichten abhaspelt, zurückbleibt. Das Ballettleben hat ihn nicht anregen können.
Wo ist Deine Leichtfüßigkeit, Deine Eleganz, Regisseur? Hast Du Dir diese
von einem falschen Programm austreiben lassen oder nie erworben?
Zum
Glück hat er auch nicht das Ballettleben mit seiner dicklichen, prätentiösen,
falsch gewürzten Sado - Maso- Soße ersticken können. Aber die künstlerische
Umsetzung in das Filmische ist ihm nicht gelungen.
Nebenbei
gibt der Film aber einen guten Einblick in die grausame und eitle Welt der
Ballettstars, - grausam gegen den eigenen Körper und gegen Konkurrentinnen-
ebenso in die Unterwerfung unter den Ballettregisseur, sowie in die eitle
Welt der
reichen
Zuschauer, die das Leiden Anderer genießen.
Psychoanalytisch
ist noch anzumerken, dass die Hauptabwehr in Wendung vom Passiv (Erleiden)
ins Aktiv (Erfolg im Ballett) besteht, und zwar gegen Ängste, unterlegen zu
sein, Wendung gegen die eigene Person (Hungern, Sich- Verausgaben,
Unterwerfung, Suizid) als Abwehr gegen Schuldgefühle wie auch Schamgefühle,
Andere übertrumpfen zu wollen, Verleugnung der boshaften Seite des
Ballettregisseurs, um weiter mit ihm zusammenarbeiten zu können, aus dem
gleichen Grunde bzw. zu dem gleichen Zweck Reaktionsbildung (Unterwerfung
statt Zorn gegen ihren Dompteur) und nicht zuletzt Idealisierung ihrer
eigenen Person, ihres Dompteurs sowie des Balletts (Arme immer schön hoch
schwingen, - was wollen die Arme da oben? Verbindung mit den Himmlischen
aufnehmen? Sich selbst größer machen? Endlos harmonische Bewegungen überhaupt),
zur Abwehr von eigenem Zorn über das Ausgebeutetwerden, sowie, wenn man
will, auch Identifizierung mit dem Aggressor (der ausbeutenden Gesellschaft,
ihres Dompteurs), indem sie sich selbst in die Innereien sticht, statt sich
weiter ausweiden zu lassen (hier zugleich Wendung gegen sich selbst). So ist
es doch noch zuletzt so richtig analytisch geworden in dieser Kritik. Spät,
aber nicht zu spät.
2013
Dr.
med. Manfred Krill, Psychoanalyse
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Film
Frances Ha
ein
US-Film aus dem Jahre 2012
Drehbuch:
Greta Gerwig, Noah Baumbach
Regie:
Noah Baumbach
Greta Gerwig als Frances Halladay
Der
Regisseur nennt seinen Film „ein Generationenportrait“ und möchte ihn
unter das Genre Komödie einordnen. Aber ist es nicht eher eine Tragödie?
Es ist allerdings nicht zu erfahren, ob die Einordnung als Komödie wirklich
vom Regisseur stammt oder vor der Firma, die den Film vertreibt, oder von
einer Film-Jury, oder ob sich Zuschauer, Kritiker oder die Presse auf diese
Einordnung geeinigt haben. Schon diese Unklarheit in der Urheberschaft des
Bei -Titels, die der Vertreiber (Cinema MFA) hinterlässt, gibt, sicher
ungewollt, etwas von der inneren Unsicherheit der Figuren wieder.
Für die Inhaltsangabe stehen Andere bereit.
Der
Film zeigt eine ätzende, auf die Nerven gehende Überaktivität der
Figuren: Überdreht, kein Wunder, dass besonders in den USA so oft ADHS als
Ausrede benutzt wird, - oder stehen sie doch unter Drogen? Die Figuren sind
jedenfalls nicht bei sich! Sie leiden sichtlich unter Entfremdungsgefühlen,
müssen sich immer wieder mühsam auf sich besinnen. Sie können ihre Not
nicht wirklich ertragen, und deshalb müssen sie diese verdrängen, daher fühlen
sie sich von einem Teil von sich entfremdet.
Dies
auf verbalem und nonverbalem Gebiet, ungeachtet der beachtlichen Fähigkeiten
und Fertigkeiten der jungen Leute um die 27 Jahre, also im Erwachsenenalter.
Sie sind jedenfalls, wenn der Regisseur nicht doch auf Drogenabhängigkeit
anspielen möchte, in einem Ausmaß beweglich (scheinbar oder anscheinend mühelos
umstellungsfähig), wie es sich Ältere unter uns nicht vorstellen können.
Beim Ansehen, ununterrichtet, dachte ich, es handele sich um junge Mädchen
in der Pubertät, allenfalls in der Adoleszenz, die sich zudem viel zu lange
an Freundschaften zu ihren Altersgenossinnen anklammern, manchmal mit einem
leicht lesbischen touch.. Das gefühlte Alter kann auch auf einem
Perspektivefehler beruhen, da ich schon zu den Älteren gehöre. Da kommen
einem junge Erwachsene ohnehin leicht wie Kinder vor. Aber daran allein kann
es nicht liegen. Diese Figuren albern noch mit 27 J. herum wie Mädchen und
scheinen es wirklich schwer zu haben, nachhaltig zum anderen Geschlecht zu
finden. Über das Wort F... und dessen kontraphobische Wiederholung kommen
sie nicht hinaus. Sie sind in ihrer gesamten Entwicklung, ungeachtet ihrer
besonderen, imponierenden Fertigkeiten (Skills) und ihrer Intelligenz
deutlich retardiert, infantil. Die „Prokrastination“, das Aufschieben
von Aufgaben und Entwicklungen, so zur Partnerschaft, ist deutlich
dargestellt.
Die
schier endlose Demonstration der –angeblichen- Freiheit von Angst-,
Schuld, - und Schamgefühlen ist nur im Anfang prickelnd und lustig, aber im
Verlauf doch recht ermüdend und langweilend, weil der Regisseur sich darin
ständig wiederholt und dies durch winzige Variationen auch noch zu
verstecken sucht. Hat er befürchtet, das Publikum sei schwer von Begriff?
Oder hat er selbst damit ein Problem, d. h. muss er selbst bei sich Angst
vor dem Thema Sexualität? Man glaube nicht, bei einem Regisseur sei die
ausgeschlossen, nur weil er gewiss über viele Kontaktmöglichkeiten verfügt
und Schauspielerinnen ihm zu Füßen liegen. Jedenfalls wiederholt er sich.
Wenn dem Zuschauer etwas demonstriert wird, ist er rasch angeödet. Er möchte
alles selbst entdecken und nicht so vorgeführt vor Augen haben müssen. Er
will keine perfekte Mahlzeit vorgesetzt bekommen, die er nur vertilgen müsse.
Er möchte die Mahlzeit selbst zubereiten. Es geht bei künstlerischem Film
und Theater nur um die Vorgänge im Inneren des Zuschauers, ausgelöst durch
Darstellung der Figuren, durch ihre künstlerische schauspielerische
Eigenleistung, und aufgrund der Intentionen des Regisseurs, nicht um Aufklärung
oder Unterricht, schon gar nicht um Weisheiten, besonders nicht fertig
angerichtete. Diese kann sich ein Jeder besser woanders besorgen. Filme sind
Abfolgen von Bildern, von Musik und Dialogen, und ob ein Film gut ist oder
mies, darüber entscheidet der Prozess im Zuschauer. Zu den Zuschauern gehören
auch die Entscheider über Preise. Wollen wir hoffen, dass sie so gut sind
in ihrem Urteil wie die Zuschauer.
Neben
ständiger Betätigung des handys, Bitten um Hilfe bei der Übernachtung,
raschem Essen, das mehr einem hastigen Sich- Sättigen der durchweg magersüchtigen
Filmsternchen mit ihren obligatorischen Hohlwangen gleicht, neben
sprunghaften Ortswechseln, Erschrockensein über das fehlende berufliche
Weiterkommen ist dauernd und urplötzlich und immer wie selbstverständlich
vom F..., von „Sex“, von Trennung, von Zusammenziehen die Rede, aber
anscheinend ohne große Emotionen, jedenfalls ohne die Tiefe und
Nachhaltigkeit von Erwachsenen. Nur von Sex, nicht von Gruppensex ist die
Rede, wenn dies nicht überhört wurde. Verwunderlich ist das Nichterwähnen
schon, es wirkt wie ausgestanzt. Hat hier der Regisseur Zugeständnisse an
die Zensur, an die Freigabe für Jugendliche machen müssen? Das Fehlen
dieses Wortes wirkt wie ein Fremdköper, und dieser ist die Zensur!
Aber
bei der raschen, überhasteten Redeweise kann man auch etwas überhört
haben. Bei Themen wie Sex oder „F...“ werden Wortteile verschluckt, -
sind auch dies Zugeständnisse, so auch an die präsumptiven Preisverleiher?
Was will der Regisseur damit sagen? Wohl doch ein Rest von Scham? Alle Tabus
gebrochen, eines nach dem anderen, aber die Scham habe sie nicht
weggekriegt, sage ich, sagt der Regisseur, wissen die Figuren noch ein
wenig. Die Scham als letzte Bastion.
Das
immer wiederkehrende „Ich liebe dich“ wirkt irgendwie alt, wie in einem
Altersheim, geisterhaft, oder auch kindlich-unbedarft, als wisse man nicht
um die Bedeutung, namentlich die Verpflichtung, oder wolle sie nicht wissen.
Von Verpflichtungen will man demonstrativ nichts wissen, so die Figuren.
Will der Regisseur einfach nur die Pflichtvergessenheit und das
Verhaftetsein an den Augenblick in der heutigen jungen Erwachsenengeneration
zeigen? Dafür hat er sich aber viele Längen genehmigt und muss offenbar
den Zuschauer für begriffstutzig halten.
Weibliche
Homosexualität klingt an, will aber nicht ernst gemeint sein, mehr
verspielt, ohne Tiefe.
Ein
ständiges Potpourri von Gefühlen, Neigungen, Einfällen, Ängsten, raschen
Reden, Flachheiten, hektisch, unbedarft, kindlich, manchmal albern.
Dazwischen eine scheinpräzise Erklärung, was Liebe bedeutet: Wenn der
gegenseitige Blick quer durch den Raum geht, an Allem und Allen vorbei. Aha,
jetzt wissen wir`s. Neunmalklug. Altklug. Aufgeschnappt oder eigene Naivität.
Aufs Auge gedrückt. in den Zuschauer hineingeklopft. Ihm nichts zugetraut.
Das sind deutliche Schwächen in diesem Film.
Psychoanalytisch
gesehen, betreiben die Figuren hiermit Verdrängung (bei sich) und
Verleugnung (bei Anderen) der tatsächlichen Ungeborgenheit, der damit
verbundenen ständigen Angst, der Sehnsucht nach Halt und Sicherheit. In der
Gegenübertragung kann man die Figuren dafür nur bedauern und diese Angst fühlen,
die sie zu fühlen sich nicht erlauben, weil diese ihnen einfach zu
unangenehm ist.
Die
Abwehr gegen diese unangenehmen Gefühle ist hier so plump, dass man kaum
glauben kann, wie verblendet Menschen sein können. Der Regisseur hat auch
hier zu dick aufgetragen. Weniger wäre mehr gewesen.
Die
Abwehr unangenehmer Gefühle ist nach der Intention des Regisseurs auch der
unreflektierten, anscheinend auch unreflektierbaren Anpassung an die
Gleichaltrigen und der american way of life geschuldet. Die Atmosphäre, die
so vermittelt wird, ist die von Verlogenheit und Oberflächlichkeit bei äußerlicher
Anpassung, insbesondere an die Einförmigkeit ihres Alltag- Jargons mit
ihrem ewigen „Hi“, „o. k.“, dem Emoticon „Wow“ und der sexuell
verwahrlosten, breitmäuligen, anal getönten Redeweise und Aussprache
(diese ist dem Regisseur natürlich nicht zuzurechnen).
Auf
die Anpassung, um nicht zu sagen Unterwerfung, will der Regisseur noch
einmal am Schluss mit einem bemerkenswerten und intelligenten Kunstgriff
hinweisen: Die Hauptperson verstümmelt ihren Namen zu einem bloße Ha,
damit er in den Schlitz des Briefkastens passt. Das erinnert an den
Schneiderwitz, in dem der Kunde seine Figur ändern soll, damit der
angefertigte Maßanzug richtig sitzt, oder das Pferd sich anderer Hufe
befleißigen soll, damit die Hufeisen passen.
Oder Ärzte /Therapeuten ihre Diagnosen so stellen müssen, dass sie in die
ICD-10 passen und auch dem Budget der Klinik gerecht werden. Oder dass
Therapeuten die Anträge für Langzeitpsychotherapie so abfassen müssen,
dass sie genehmigt werden. Wir sind also auch nicht besser. Das nennt man
autoplastische Veränderung.
Aber
auch sonst ist die Unterwürfigkeit der Figuren unter den sog. Zeitgeist
hervorragend geschildert, - aber wie auch andere offensichtliche Intentionen
des Regisseurs – nie so, dass diese dem Zuschauer allzu sehr aufgedrängt
werden. Der Regisseur zollt vielmehr gegenüber dem Zuschauer den
erforderlichen Respekt. Der Zuschauer hat somit Zeit und Muße, selbst auf
diese Gedanken zu kommen.
Die
Musik unterstützt die rasch wechselnden Stimmungen sehr passend,
unterstreicht insbesondere das Qirrlig -Optimistische der kindergleichen
Erwachsenen, die an einer Stelle nicht aufhören wollenden Polizeisirenen in
der Ferne die furchtbare Einsamkeit, das Ausgeliefertsein, die
Ungeborgenheit. Nicht dass es sich tatsächlich Tag und Nacht so anhört in
Neu York, ist entscheidend (es ist bloß wahr, es ist so), sondern was der
Regisseur damit sagen will, oder genauer: Was er im Zuschauer damit erzeugen
will (und tatsächlich auch erzeugt).
Den
Zuschauer behandelt er respektvoll, er selbst ist aber ebenfalls dem
infantilen, eigentümlich leer laufenden, wenn auch recht spritzigem
Aktivismus erlegen. Das Thema wird einfach zu oft abgehaspelt, mit nur veränderten
Stellen, Zimmern, Fluren, Straßen im Ort, aber auch Paris und Japan. Ein
guter Film benötigt keine Sprünge auf andere Kontinente oder andere
Zutaten wie musikalisches Klanggewühl Ein Film von 20 Min. Dauer hätte es
auch getan. Dem Regisseur ist nach 20 Min. nichts Neues mehr eingefallen. Es
mag sein, dass es zu Verkaufszwecken nicht anders ging, als Längen
einzuflechten. Der Kinobesucher möchte für sein Geld eben 82 Minuten
haben, sonst geht er nicht hin.
Um
den Film zu Ende zu bringen, ist dem Regisseur noch schnell eingefallen, die
Hauptdarstellerin einen überraschenden Aufschwung nach oben nehmen zu
lassen. Wer hätte gedacht, dass dieses verkorkste Mädchen zum Schluss, mit
27 Jahren, doch noch Choreographin geworden ist, also doch noch zu einem
Beruf gefunden hat, - im Gegensatz zu den unzähligen „Jobs“ der
spritzigen Damen mit ihren ungesicherten,
unsteten und prekären Arbeitsverhältnissen, der vergeblichen Vorfreude,
bei der Weihnachtsaufführung mitmachen zu dürfen, dieser ständigen
Geldnot, dem furchtbaren, entwürdigenden Angewiesensein auf Hilfe durch
Eltern oder Freunde, dem Anpumpen, dem Betteln um spätere Mietzahlung, - oh, auf einmal gilt die Kreditkarte nicht mehr, das darf aber
das männliche Gegenüber nicht mitkriegen, deshalb muss Ha aber dann
laufen, über Stock und Stein, über Kreuzungen hinweg, hinstürzen und sich
den Arm verletzen, um einen Geldautomaten zu finden, einfach weiterlaufen
wie eingehetztes Reh, mit den dünnen Beinchen, so sehr hängen sie am Tropf
der Kreditkarten, sie sind ständig überanstrengt, außer Puste.
Es
geht ihnen doch sehr schlecht, sie wissen es nur nicht, - und dies alles
noch unter ständigem beruflichen Leistungsdruck
Aber
halt, Ha hat noch andere Errungenschaften aufzuweisen, es ist also alles
halb so schlimm, nicht wahr? Sie hat mit 27 Jahren ein eigenes handy, aber
auch eine eigene Mietwohnung und einen, man höre und staune, eigenen
Briefkasten, wenn auch mit verstümmelten Namen. Wie weit hat sie es doch
gebracht, so selbstgerecht und auftrumpfend die Figur der Ha oder vielmehr
der Regisseur wie im Faust.
Aber
wie wird es weitergehen? Hier drückt sich der Regisseur um eine Antwort
oder einen Ausblick. Ist es Einsamkeit und eine berufliche Endlos-Spirale,
in der alles so hektisch weitergeht wie bisher? Wie steht es mit dem Älterwerden?
Wie ist es mit einer dauerhaften Partnerschaft, mit Ehe und Familie? Und,
ihr beiden Gretchen (die Hauptdarstellerin und ihre Freundin Betty), wie
haltet ihr es denn mit der Religion? Hierfür nimmt sich die Regie keinen
Raum, aber der nachdenkliche Zuschauer. Das junge Erwachsenenalter hängt
hier eigenartig in der Luft. Im Grunde hat sich nicht viel am Lebensstil geändert.
Jedenfalls dürfte dies als Eindruck im Zuschauer zurückbleiben. Die Angst
bleibt, zumindest im Zuschauer, während die Regie die ihn mit diesem happy
end abspeisen möchte. Offenbar ist der Regisseur zum Schluss ganz
erschrocken gewesen über seine treffsichere Darstellung des eilenden und
elenden Lebens der jungen Generation mit ihren Zeitverträgen, mit ihren ständig
wechselnden „Jobs“ (in Deutschland die „400- Euro“- Jobs“), also
ihrer mangelnden Bindung an einen Beruf und an einen Partner, ihren überstürzten,
unmotivierten Reisen in ferne Länder und hektischen Kontakten, welche nicht
die Kontaktstörung verdecken können, und wollte dann ganz schnell zu einem
glücklichen Ende finden, - das übrigens gegenüber dem Hauptteil deutlich
untergewichtet ist, gleichsam nur einen bedeutungslosen Schlenker darstellt,
um, ja, - wozu? Um sich und den Zuschauern und den Filmbewertern (!) doch
noch eine glückliche Welt mit Zufriedenheitsgarantie vorzugaukeln? Oder es
dem Zuschauer zu überlassen, ob er diesen Tobak von einem happy end
schluckt? Da kann er lange warten.
Wir
wissen auch nicht, was in den Entscheidern, die über die Preisverleihungen
bestimmen, vorgegangen ist. Haben sie das Spiel, das Doppelspiel des
Regisseurs mit scheinbarer und wirklicher Realität und durchschaut und
gerade dieses honoriert oder haben sie sich von der Oberfläche des Films
blenden lassen?
Wohl
kaum, denn der Regisseur hat sie dauernd darauf gestoßen, dass es sich hier
um eine schreckliche, auf die Nerven gehende Oberflächlichkeit und
Verlogenheit handelt, so mit dem ewigen jubelnden „Hi“ bei jeder Begrüßung
und „o. k“. so in der Szene, als die Hauptdarstellerin so tut, als sei
sie noch am Ort, während sie sich in Wirklichkeit in Paris aufhält, oder
in der Verspätung, um nicht zu sagen Blindheit, Verleugnung, der
offenkundigen Entfremdung von
ihrer Freundin Sophie, und falscher, naiver, kindlicher Überschätzung der
Beziehungen überhaupt..
Die
Absicht des Regisseurs, Oberflächlichkeit und Ungeborgenheit der westlichen
Welt darzustellen, mag auch in der Namensgebung durch die Drehbuchautoren,
von denen der eine der Regisseur selbst ist (er hat offenbar am Drehbuch Veränderungen
vorgenommen) hinweisen. Halladay klingt so flott, lustig und unverbindlich
wie „holiday“, so schön, wie ewige Ferien sein sollen oder aber auch
wie das elende Von- der- Hand in- den- Mund- Leben, das rasche Durchleben
eines Tages (day) o. ä. Man glaube doch nicht, dass in den Autoren nichts
bei der Namensgebung vorgegangen ist.
Dies
könnte aber auch überhaupt die bewusste und / oder unbewusste Intention
des Regisseurs sein: Das eigenartig Schale und Verstörende des ach so
erfolgreichen westlichen Lebensstils anzuprangern. Jedenfalls kann man den
Film so verstehen, wenn man auch nicht wissen kann, ob der Regisseur solches
im Sinne hatte.
Gewiss
kann man aber sagen, dass ihm trotz mancher Längen die künstlerische
Umwandlung seines Stoffes gelungen ist, indem er genügend Tiefe belässt
und genügend Fragen offen lässt und den Zuschauer ohne Aufdringlichkeit,
namentlich ohne ideologische Indoktrination, in seine Gefühlswelt und in
sein Verstehen einbindet, sodass im Zuschauer ein Prozess zustandekommt.
Dieser kann auch Gedanken aufkommen lassen, wozu das tatsächliche oder
scheinbare Brechen aller Tabus, eines nach dem anderen, eigentlich geführt
hat: Zur Unverbindlichkeit, zur Haltlosigkeit, zur Heimatlosigkeit und nicht
zuletzt zur Empfänglichkeit der jungen Menschen für Intoleranz und solche
Einrichtungen, welche die ersehnte Geborgenheit versprechen wie Sekten, von
denen der Zuschauer eine gemeinsame Sing-Sang-Szene zu sehen bekommt, mit
deren grauenhafter Starre und falscher, ekelhafter, süßlicher Harmonie,
ihrer entsetzlichen Einfältigkeit und der Vortäuschung von Heimat. Dies
hat der Regisseur wohl nicht bewusst gewünscht, denn zu sehr feiert er
diesen Lebensstil auch selbst mit, - vielleicht auch nicht unbewusst, denn
dann hätte er am Ende einmal eine verschleierte Frau ins Bild stellen können.
Aber dass solche Gedanken möglich sind, zeigt, dass der Film über
seelische Breite und Weite verfügt.
Königsstein,
2013
Dr.
med Manfred Krill, Arzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychotherapie,
Psychoanalyse (DPV, IPV, FPI, IPAA).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Film
„A Serious Man“
Autoren
und Regisseure: Die beiden Brüder Joel & Ethan Coen
Schauspieler:
Michael Stuhlberg in der Hauptrolle als Larry Gopnik
Richard Kind, Adam Arkin
USA 2009
Das
Wesentliche ist rasch gesagt. Im
Vorkriegspolen, im „Schtetl“ bricht einem jüdischen Kleinhändler
auf der Heimries nachts im Schneegestöber ein Rad von seinem Fuhrwerk weg,
und eine Rabbi, der zufällig seinen Weh kreuzt, hilft ihm, das Fuhrwerk
wieder fahrfähig zu machen. Als Dank lädt der Händler den Rabbi ein. in
seinem Hause eine Suppe zu sich zu nehmen. Der nimmt die Einladung wörtlich
und steht dann, offenbar nach einer Bedenkzeit, denn der Händler hat
bereits eine Unterhaltung mit seiner Frau geführt, plötzlich vor der Tür.
Die
Frau des Händlers aber hält den Rabbi für einen Dibbuk, einen Geist, von
einem vor 3 Jahren angeblich Verstorbenen. Ein solcher Dibbuk benötigt
einen Lebenden. Als der Rabbi die angebotene Suppe nicht essen will, sieht
sich die Frau darin bestätigt. Sie sagt ihm auf den Kopf zu, dass er ein Dibbuk sei. Sie stößt ihm dabei ohne Vorwarnung ein Küchenmesser in
die Brust, worauf der Rabbi ungerührt weiterspricht und die Sache aufklärt.
Er habe wohl seinerzeit Typhus gehabt, sei aber genesen. Im Übrigen fühle
er sich nun nicht wohl (eine eigenartige, extreme,
geradezu märchenhafte Verleugnung dessen, was ihm gerade passierte: Dass er
gerade ermordet wird), sagt er, murmelt sehr vornehm, als ein Mann von
Bildung (und ohne jeden Protest), dass man da nicht bleiben solle, wo man
offensichtlich unwillkommen sei, torkelt ins Schneegestöber hinaus. Der Händler
erkennt und sagt zu seiner Frau: Jetzt ist unsere Familie verflucht. Die Frau zeigt sich davon völlig unbeeindruckt. Dass sie
tatsächlich einen Schaden für sich nicht zu befürchten hat, geht aus dem
Folgenden hervor.
Auf
einem anderen Kontinent trifft der Fluch einen völlig Unbeteiligten, die
Hauptfigur Jarry, einen Physikprofessor,
fleißig. gewissenhaft, pflichterfüllt, angesehen, von kindlicher
Arglosigkeit.
Sein
wiederholtes „Ich habe nichts
getan“ nutzt ihm nichts. Sein Sohn
fängt an zu kiffen und zu dealen, kann sich gerade noch retten vor seinem
Verfolger, einem größeren Dealer, dem er Geld schuldet. Nur mit Mühe, in
einem deutlich bewusstseingetrübten Zustand, sichtlich unter Drogen
stehend, und nur unter kräftiger Mithilfe der Gemeinde kann er seine –
individuelle, im Ggs. zu unserer Konfirmation bzw. Firmung, welche die ganze
Altersgruppe umfasst - Bar-Mitzwa-Prüfung, in der er einen hebräischen
Text vor der Gemeinde vorzusingen hat und mit der er seine religiöse Mündigkeit
erlangt und den Vater von dessen Verantwortung befreit, bestehen. Seine Tochter
stiehlt ihm Geld, um sich schöne Sachen davon zu kaufen, und frönt ihrem
Haarwaschzwang und braucht Geld für eine Nasenkorrektur. Seine Ehefrau
geht auf einmal fremd mit einem Nichtsnutz von verarmten Nachbarn, schließlich
kündigt sie ihm aus heiterem Himmel die Scheidung an und fordert zudem die
rituelle Scheidung, die mit einem erheblichen Aufwand und Vermögensverlust
seinerseits verknüpft sein wird Dieser
Nachbar gibt sich ihm gegenüber
wie ein großzügiger Freund und Psychotherapeut, der nur sein Bestes wolle,
und überschüttet ihn mit weisen, scheintiefsinnigen Ratschlägen, wie er
sein Leben meistern müsse, umarmt ihn freundschaftlichst und wärmstens. Es
sei das Beste, an das Wohl der beiden Kinder zu denken, und deshalb müsse
L. ausziehen. Man hat schon eine kleine Bleibe in einem Hotel für ihn
gefunden. Alles ist schon, im Einvernehmen mit seiner Frau, hinter seinem Rücken,
über seinen Kopf hinweg, geregelt. Er ist entmündigt, auf die Stufe eine lästigen
fernen Verwandten im Kindesalter herabgestuft. Dass der Nebenbuhler es nur
auf seine Frau, sein Vermögen, sein Haus und die Geborgenheit in seiner
Familie abgesehen hat, wird spätestens zur Gewissheit, als L. auch noch
dessen Beerdigung bezahlen muss, nachdem dieser durch einen Verkehrsunfall
ums Leben gekommen ist. Dass danach die Eheleute wieder etwas zueinander
fanden, wird ihm wenig nutzen, wie sich herausstellt.
Auffallend
ist das völlige Fehlen von Schuld-
und Schamgefühlen, aber auch von Vergeltungsangst in allen Figuren, die
den Professor bedrängen. Die stille allgemeine Überzeugung, dass L. sein
Schicksal verdient hätte, ist es nicht, die hier wirksam wäre. Nein, es
ist viel schlimmer: Sein Schicksal lässt sie völlig unberührt. Sie
handeln alle wie in Trance, wie
Puppen oder Roboter, die nur aussehen wie Menschen. Es sind allesamt
Ungeheuer in Menschengestalt. Natürlich sind hiermit Menschen in
Situationen wie im Holokaust gemeint, aber mehr noch die Menschen im Alltag.
So sind eben Menschen, wollen die Autoren wohl zeigen, und dies zu sehen,
bedarf es keines Holokausts.
Dies
ist das Schlimmste, denn es lässt auch für die Zukunft nicht Gutes hoffen,
wie es auch im Holokaust zwar nicht durchgängig, aber doch massenhaft der
Fall war.
Besonders
die Frauen kommen dabei nicht gut
weg. Wo bleiben Gefühle von Gerechtigkeit, Mitleid, Erbarmen, Mütterlichkeit?
Sie sind wie weggewischt. Angefangen hat dies mit der Frau in Polen, die dem Rabbi mir nicht dir nichts ein Hesser in den
Leib stach. Keine Spur von Reue oder Schuldgefühlen, aber auch keine
Vergeltungsängste, - alles wie selbstverständlich geschehen. Selbst der
Gedanke des Mannes, dass dafür die Familie verflucht sein, macht, wie erwähnt,
nicht den geringsten Eindruck auf die Frau. Auch hier ist das Verhalten der
Gesellschaft, außer in Deutschland, so gut gekennzeichnet, dass auch hieran
die Zeitlosigkeit des Stücks
deutlich wird. So sind eben die Menschen, wollen die beiden Regisseure und
Autoren sagen, und, dass es wenig Hoffnung gibt, dass sich daran etwas ändert.
Hinzu
kommt, dass die Menschen im Film
nicht unter einer Diktatur leben müssen, also die Freiheit heben, vom
Kesseltreiben abzulassen und dem in Not Geratenen beizustehen. Die
Regisseure wollen vielleicht damit darauf hinweisen (oder wir können
solches denken, auch wenn die Regisseure, als US-Amerikaner einer Diktatur
notorisch unkundig, vielleicht keineswegs darauf hinweisen wollten), dass
die Menschen heute, die solches ohne Not zulassen und sogar mitmachen, schuldiger sind als
die seinerzeit unter einer furchtbaren Diktatur. Die Leute heute dort haben
doch zu essen, haben einen Raum zum Schlafen, haben ihr normales
Familienleben mit Sexualität, haben ein Auto, eine Wohnung, können sich
gut kleiden, und die Sonne scheint warm vom Himmel, und der Staat verfolgt
sie nicht, ihre Kinder können in Ruhe die für sie geeigneten Schulen
besuchen, die Frauen können ihre Kinder austragen, die Väter und Mütter
ihren Berufen nachgehen, sie werden dabei nicht bedroht. Es gibt keine
Straflager und Hinrichtungen für Unschuldige
An
der Universität eröffnet ihm ein „Freund“,
dass die Genehmigung für eine Weiterführung seiner Lehrtätigkeit noch auf
einer Konferenz beschlossen werden müsse. Dieser Freund gehört mit seinen
wiederholten Auftritten zu den rätselhaftesten Figuren. Nie wird klar,
warum er immer wieder im Türrahmen erscheint und auf die bevorstehende
Konferenz sowie, aber – scheinbar, aber in Wirklichkeit doch von ihm
provoziert - erst auf Larrys Drängen auch auf Briefe verweist, die ihn
verleumden und auf weiteres, ebenfalls still provoziertes Nachfragen
angebliches „moralisches Versagen“ beinhalten, die, so kann der
Zuschauer schließen, von seinem Nebenbuhler stammen. Es soll also nicht der
Nebenbuhler, der seine Familie zerstört hat und ihn entrechten will,
moralisch verwerflich gehandelt haben, sondern sein Opfer, und die
Verleumdung muss vom Täter stammen. Am ehesten kann der Zuschauer zu dem
Schluss kommen, dieser „Freund“ sei, wie wohl alle, selbst von einer
unbekannten Macht gesteuert und diene dazu, Larry die Stimmung zu verderben
und ihn zu entmutigen. Aber weit schlimmer ist die nicht unberechtigte
Vorstellung, dass er dies aus eigenem Antrieb tut und der Zuschauer nur zu
gern bereit ist, eine hinter diesem stehende Macht anzuschuldigen, nur weil
man nicht das Eigen- Boshafte dieses eigenartig lungernden
Ungeheuers sehen will, weil man ihn so von seiner alleinigen
Verantwortung entlasten möchte. Ein Hinweis auf boshafte Menschen, die nur
eines im Sinn haben: Dem Anderen schaden. Wahrscheinlich will dieser Türrahmensteher.ihn
sogar in die Selbsttötung treiben.
Man
weiß nicht, ob die Autoren mehr die
Menschen anklagen möchten und so den Glauben an den guten Gott bewahren möchten,
oder ob sie umgekehrt die Menschen entlasten möchten, zuungunsten von Gott.
Wahrscheinlich aber sollen beide
keine gute Figur machen. Der Film wäre dann eine Abrechnung mit Gott und seiner Schöpfung, also doch mehr mit Gott,
da er für seine Schöpfung die Verantwortung trägt. Wie konnte er solche
Versager in die Welt setzen? Wie konnte er zulassen,
dass solche Religionen, mit solchen Pfeifen im Vorstand, entstehen? Wer
mag, kann sich hier an die Vorstände mancher Banken erinnert fühlen.
Ein koreanischer Student, der durchgefallen ist, hinterlässt ihm bei
der Besprechung des Examensergebnisses unbemerkt einen Briefumschlag mit
viel Geld, und stellt ihn vor Wahl, sich entweder von ihm wegen Verleumdung
verklagen zu lassen, falls er den Vorfall melde, oder wegen Geldannahme, als
korrupt angezeigt zu werden, - eine auswegslose Situation. Da sich die
Schwierigkeiten häufen, glaubt L, der Freund an der Tür wisse von diesem
Bestechungsversuch und wolle ihn beschuldigen, fühlt sich veranlasst, ihm
Briefumschlag mit dem Geld zu zeigen und seine Unschuld zu beweisen, wodurch
er sich erst recht in Gefahr bringen würde. Hier ist also eine Wendung
gegen die eigene Person mit der unbewussten Absicht der Selbstbestrafung
zu sehen. Dieser ihn unterbricht ihn aber, will gar nichts von dieser
Beinahe- Bestechung hören oder sehen. Es ist, so, als ob alle eine
selbstverständliche Kenntnis von seinem Scheitern
haben und ihn schon längst abgeschrieben haben. und nur noch – nicht ohne
Häme – zusehen, wie er sich dreht und windet, um aus dieser Klemme
herauszukommen, - die Frage der Bestechlichkeit braucht dazu nicht erörtert
zu werden, sie stört eher. Zusätzliche Beweise gegen Larry werden nicht
benötigt. Es werden überhaupt keine
Beweise benötigt, auch nicht
solche seiner eventuellen Verwerflichkeit, so ist das! Es ist doch alles
schon längst entschieden. Auch weiden sich die umstehenden Zuschauer
keineswegs an seinem Unglück. Dies sollte man annehmen, wenn es um normale
Menschen ginge. Es ist hier viel schlimmer: Sie wissen, dass es ihn
getroffen hat, aber sie kümmern sich nicht darum, ob dies berechtigt ist, ob
er solches verdient hat und wie es enden wird. Sein Schicksal, sogar jede
Begründung für dieses Schicksal ist ihnen völlig gleichgültig. Der
Sadist und der Voyeur wären Gold dagegen, denn diese hätten immerhin noch
ein Interesse an ihm und seinem Schicksal. Man kann froh sein, wenn jemand
überhaupt noch etwas fühlt.
Den
Briefumschlag benötigt der Türrahmensteher nicht, er ist auch so vom
baldigen Ende Larrys überzeugt.
Gerade diese allgemeine Stimmung, das Diffuse und Unklare, das Aberwitzige
daran, das Überspringen der Kontinente ist treffend geschildert und
verweist natürlich auf den verbreiteten Antisemitismus, ebenso auf die Unmöglichkeit,
den bedrängten Juden oder anderen Bedrängten entscheidend zu helfen, aber
auch auf die Gleichgültigkeit und den Mangel an gutem Willen, wenn nicht
Abneigung, zu helfen.
Im
Vorkriegspolen kommt es zu einem Totschlag unter Juden, aber es trifft einen
heutigen jüdischen Professor in den USA. Es geht willkürlich zu. Wer verteilt diese Schicksalsschläge nach dieser Gutsherrenart?
Verheerend
ist dabei die Rolle der jüdischen
Gemeinde und Religion, die in völligem Versagen besteht. Die jüdischen
Religionsausübenden kommen nicht besser weg als die seinerzeit
christlichen, warum auch?
Von
einem minderen Rabbi wird Larry mit
rabulistischen Allgemeinplätzen und Scheintiefsinn abgespeist, so mit
einem Hinweis auf einen Parkplatz, den man durch die Fenster sehen kann. Zum
obersten Rabbi wird er gar nicht vorgelassen, denn der sei gerade am
Nachdenken, - nachdem ihn dessen Sekretärin lange und abschätzig
betrachtet hat und ihn ebenfalls sehr förmlich und kalt abfertigt.
Hier
werden nicht nur die angeblich immer
so mütterlichen und einfühlsamen Frauen angeklagt, sondern die jüdische
Religion selbst wie auch überhaupt die Religion. Diese schwafeln dem
Menschen etwas vor von Gott, dem Gerechten, aber von dem kommt keine Hilfe,
aber auch nicht von seinen Vertretern auf Erden, den Rabbinern. Diese sind mit sich selbst, ihren Ornaten, ihren uralten Büchern, ihrem Pomp und
ihren Traditionen beschäftigt (hier vielleicht ein Seitenhieb auf
manche Fehlentwicklungen, so gewisse religiöse Züge, der Psychoanalyse),
sonnen sich in ihrer Macht und Untätigkeit, wimmeln die Hilfesuchenden mit
Allgemeinplätzen und rabulistischem Scheintiefsinn (Intellektualisierungen)
ab, - kafkaesk. Die Gläubigen lassen sich dadurch blenden und von ihrem
Anliegen ablenken, mehr noch, sie lassen sich von diesen hypnotisieren. Es
geht auch nicht um das Judentum oder Christentum allein, sondern auch um
alle anderen Religionen, die nicht besser verfahren: Koreanischer Student,
„andere Kulturauffassungen“. „Es ist eine Streit zwischen zwei
Kulturen“, sagt der völlig verbohrte Vater des Studenten zu Larry, wohl
nur eine etwas zusammenhanglose Andeutung, dass sich
die Religionen auf einen clash zubewegen. Dies ist ein Wink, dass es in
einem Religionskrieg noch weit schlimmer kommen würde, indem dort ebenfalls
jedes Mitgefühl ausbleiben würde. Es ist keinerlei
Achtung vor der Religion des Anderen in Sicht.
Der
wesentlichste Punkt ist aber wohl: Die
furchtbare, menschenverachtende Gleichgültigkeit der Götter, des Gottes,
der Religionen und nicht zuletzt der Menschen. Es ist nämlich nicht so,
dass nur die Unschuldigen „bestraft“ werden, denn dann hätten die
Mensche es wieder einfach: Sie hätten es nämlich erkennbar mit dem Teufel
zu tun, - sondern es trifft auch die Schuldigen, z.B. den Nebenbuhler, der umkommt.
Insofern bildet der Film nur die Realität ab. Der eine kriegt Krebs, der
andere Nicht. Im Krieg kommt
der eine um, der neben ihm nicht.
Nicht
der gerechte Gott, auch nicht der Teufel, der scheitan, der Dibbuk, sondern der rasende, sinnlos rund um sich schlagende Gott ist hier am Wüten, -
der den alten biblischen Gott wieder zum Leben erweckt, - der Gott, der
die Menschheit ohne Einzelprüfung in der Sintflut ertränkt, der – bei
den Griechen – Agamemnon seine Tochter Iphigenie- schlachten lassen lässt,
der Stalin seine Getreuen umbringen lässt, der einen Hitler und seine Häscher,
der einen Bomber- Harris.(dies ohne Druck einer Diktatur) industriellen
Massenmord begehen lässt.
Der
Teufel (oder Gott? Oder der Dibbuk?)
ist aber auch im Spiel: Jarrys Gesicht verzieht sich innert Sekunden zu
einer teuflischen Fratze (Identifikation
mit dem Aggressor aus Angst vor ihm), die der ähnelt die der
Nationalsozialismus seinerzeit als „jüdisch“ verbreitet hat, als Jarry
das Geld doch annimmt, um es seinem psychisch gestörten Bruder zukommen zu
lassen, der sich – mit Hilfe einer geheimen mathematischen Theorie- des
verbotenen Glückspiels schuldig gemacht und dabei viel Geld gemacht hat,
und nun vor der Polizei verfolgt wird. Der kommt schließlich auch um, wird
von der Grenzpolizei erschossen, und das Sündengeld ist ebenfalls verloren.
Gott macht in seiner Vernichtungslust
nicht einmal vor Kranken halt. Der biblische, sinnlos vernichtende Gott
beherrscht die Welt, - das ist die Botschaft, und es gibt kein Entrinnen vor
ihm. Tiefster orientalischer
Fatalismus auch heute noch oder erst recht heute, wie auch bei den alten
Griechen, die sich den Göttern, die sich alles erlauben konnten (Mord,
Totschlag, Kannibalismus, Ehebruch, Raub, Diebstahl, Intrigen), hilflos
ausgeliefert fühlten und in einer vagen Hoffnung ständig Tier- und
Menschenopfer darbrachten (Sphinx von Theben, Iphigenie von Tauris, Kretas
Minotaurus, wie weit zuvor „Abraham opfert Isaac“). Nicht immer ist
klar, ob die Geschehnisse im Traum oder „in Wirklichkeit“ ablaufen, aber
darauf kommt es den Autoren nicht an, denn auch im Traum geschieht
bekanntlich nichts ohne Grund. und die Welt oder die „Weltordnung“, die
besser als Weltunordnung zu bezeichnen ist, ist so verrückt, dass es darauf
auch nicht mehr ankommt.
Ganz zum Schluss das Todesurteil. Sein Arzt, der vor seinen Augen den Röntgenbefund
als normal bezeichnet hatte, ruft ihn an, es sei diese Röntgenaufnahme noch
zu besprechen. Nein, es gehe nicht am Telefon, er müsse vielmehr selbst
kommen. Später? Nein, sofort. Bezeichnend ist der jovial- beruhigend-
beschwichtigende, sogar kumpelhafte („Sie wissen doch, es geht um die Röntgenaufnahme“)Ton
des Arztes, der gleichgültig, über das Todesurteil, das in dieser Röntgenaufnahme
steckt, denkt und spricht und es dem Verurteilten gegenüber gar nicht schnell genug aussprechen kann.
Der Arzt will seinen Patienten Larry nur zu der kurzen Kooperation bringen,
seine Praxis aufzusuchen,. Will der Arzt zum Tennisspiel? zu seiner
Freundin? - damit er nicht länger
in seiner Arztpraxis verweilen muss? Von Helfen oder Heilung ist nicht die
Rede. Hier gibt L. endgültig sein
„Ich habe nichts getan“ auf. Er hat verstanden.
Es
handelt sich um eine anonyme Instanz, die rachsüchtig ist und willkürlich
alles niedermacht, was sie in die Finger kriegt. Man braucht die Vorstellung
eines – anderen –Teufels oder Dibbuks nicht mehr. Einer reicht.
Was
kann ein Analytiker dazu ergänzen? Wo ist Abwehr zu finden? Die erfahrene
Ungerechtigkeit und Vernichtung ist so unerwartet, läuft allen Erwartungen
und jedem Gerechtigkeitsgefühl derart zuwider und ist derart erschreckend,
dass es zur Identifikation mit dem
Aggressor (Gott) kommen muss. Das Opfer, der Physikprofessor muss selbst
zum bösen Gott oder bösem Dibbuk werden, um sich ebenso stark fühlen zu können
und seine Angst, vernichtet zu werden, im Zaum zu halten. Ferner findet
greift das Opfer zur Wendung vom bloß
passiven Erdulden zum aktiven Täter, - ebenfalls, um seine Angst,
vernichtet zu werden, niederzuhalten. Er nimmt
das Geld des koreanischen Studenten an und verwendet es zu eigenen
Zwecken, nämlich seinem Bruder zu helfen, außer Landes zu kommen. Ferner begeht er selbst, durch den Anblick seiner Nachbarin gereizt oder
nicht, darauf kommt es nicht an, Ehebruch,
indem er sie aktiv aufsucht. Von vorneherein ist seine Verleugnung der Bösartigkeit des Schicksals, das über ihn
hereinbricht, und der Bösartigkeit und Gleichgültigkeit aller Personen wie
seiner Kinder und seiner Ehefrau, besonders auch des Nachbarn, der ihm seine
Frau abspenstig gemacht hat, und so seine Familie zerstört und es
ersichtlich auf sein Eigentum, sein Vermögen abgesehen hat und ihn – ein
zusätzlicher Luxus an nicht weiter zielführender Bösartigkeit - durch
anklagende Briefe noch beruflich erledigen will. Mit der Abwehr durch
Verleugnung versucht L., seine Angst (sein Entsetzen) vor dem Unglück, das
ihn immer mehr einkreist, zu bekämpfen und so
lange wie möglich, seine Funktionen als Familienvater, als Ehemann und als
Professor für die Universität und seine Studenten zu erhalten. Hier wird
meisterhaft die Selbsterhaltungsfunktion der Abwehr, neben ihrer Aufgabe der
Bekämpfung von Angst, Schuld- und Schamgefühlen, demonstriert. Um sich
nicht von den einzelnen Schlägen, die er einstecken muss, völlig zermürben
zu lassen, greift er auch zu Rationalisierungen der Geschehnisse, indem er
versucht, sie als verständlich und normal einzustufen oder Erklärungen von
den Rabbinern zu erhalten.
Ferner
setzt er Idealisierungen ein, um
seine an sich fälligen Zornesgefühle nicht hochkommen zu lassen oder gar
auszuleben, so im Verhältnis zu seinen Kindern, seiner Ehefrau, dem
Nebenbuhler, dem merkwürdigen Mahner an der Tür seines Arbeitszimmers in
der Universität und seinem Bruder, den er sich in seinem kleinen Haus
ungehindert breitmachen lässt . Statt seiner Tochter hätte er selbst
seinen Bruder fragen sollen, wie lange dieser noch dazubleiben gedenkt. Die
stundenlange Blockade des Badezimmers durch den Bruder stellt dessen
schmarotzerhaftes Verhalten bloß. Gegen seine aggressiven Regungen setzt er
auch Reaktionsbildung ein, so
durch seine unentwegte Freundlichkeit und Unterwürfigkeit.
Das
Aggressive bricht endlich durch seine Abwehr durch,
als sein Gesicht sich - deutlich entgegen seine bewussten Bemühungen –zu
einer Teufelsfratze verzieht. Alle Bemühungen, diese innerlich bereits
abgelaufene Identifikation mit dem Aggressor Gott zu unterdrücken, brechen
an dieser Stelle zusammen. Er wurde ja auch in diesem Moment- durch die
Annahme der Bestechungssumme zum Bösen.
Die Nebenfigur der Nachbarin, mit der er sich aktiv einlässt, ist erwähnenswert.
Sie ist als auffallend berechnend, triebhaft mit boshaftem Gesichtsaudruck
geschildert und handelt wie alle entgeistert, wie unter Hypnose stehend. Sie
ist gewiss, so nach der Intention der Autoren, ebenfalls von einem Dibbuk
besessen, wie alle Anderen. Es ist nicht klar, was die beiden Autoren und
Regisseure mit dieser Figur noch Besonderes sagen wollten. Sie spielt die
Rolle der bösartigen Versucherin, die einen braven, fleißigen Mann vom Weg
abbringt, wohl ebenfalls im Dienst eines Dibbuk, der von ihr Besitz
ergriffen hat.
Auch
die Ehefrau wirkt wie
hypnotisiert, unter dem Einfluss eines Anderen stehend. Sie weiß selbst
nicht, warum sie sich scheiden lassen will. Sie glaubt nicht ernsthaft, dass
sie selbst die Scheidung ins Werk gesetzt hat, die Scheidung geschieht
vielmehr einfach, und die Ehefrau wirkt nur getrieben, unbeteiligt, wie in
Trance (s. hierzu Krill. 2008, s.u.).
Der
Ehemann ist wie ausgestanzt, das „Ausknipsphänomen“ auf Seiten der
Ehefrau, (Krill, 2008, Das Gutachterverfahren, Partnerschaftskonflikte, S.
282 ff) meisterhaft dargestellt. Dies kann man – abgemildert - auch für
die Kinder sagen.
Auch
bei uns, im christlichen Bereich, erlebt der Mann, wird er von seiner Frau
plötzlich mit Scheidungsabsicht konfrontiert und sie mit noch so viel Mühe,
Versprechungen nicht mehr umstimmen kann, diese als völlig verändert, „wie verhext“, wie besessen von der Idee, die Familie zu zerstören.
Nicht selten kommt es zu Gewalttaten
von Seiten des Mannes, um sie wieder „zu sich zu bringen“, „zur
Vernunft zu bringen“, aus ihrer Trance zu erwecken, auch zu Totschlag..
Der
Junge,
drogenabhängig, ist insbesondere bei seiner Bar-Mitzwa ebenfalls nicht bei
sich selbst. Er sieht völlig
entgeistert, mit glasigen Augen und ratlosem (amentiellem)Gesichtsausdruck
um sich herum, ist sichtlich zeitlich und örtlich desorientiert,
kann kaum wieder seine Bank finden, auf der seine Eltern ihn erwarten und
von der er aufgestanden ist. Aber sind es wirklich die Drogen oder ist es
nicht ebenfalls der böse Dibbuk, der hier und im ganzen Filminhalt wirkte?
Wie
heißt es im Vaterunser: „Und führe uns nicht in Versuchung“. In diesem
rätselhaften Spruch des Christentums, den ich schon seit meiner Kindheit
bis heute unbegreiflich finde, ist dies klar und deutlich ausgedrückt: Gott
nicht nur als Retter, sondern, ebenso auch als Versucher, der so die
Menschen vom rechten Weg abbringt und sie schnurstracks zur Hölle befördert,
- sich damit also als Luzifer, als
Teufel, als Dibbuk entpuppt. Ich hatte immer geglaubt, dass dieser
Passus im Vateruser eines Tages, mit zunehmender Aufklärung und deutlicher
einsetzender Kritik an anderen Stellen, gestrichen wird, aber nein, und mehr
noch, er wird stumpfsinnig von den Gläubigen bis heute ritualhaft
und gedankenlos, wie unter Hypnose, nachgebetet. Alle Rechtfertigung
hierfür dürfte die reine Rabulistik sein.
Weiß
die Kirche eigentlich, was sie
damit sagt, oder ist auch sie betäubt vom Dibbuk oder von Gott? Sie scheint
nicht bei sich zu sein („nicht
bei Trost“, „unwis“, niet recht weijs bei sejn hoofd, pomeschanaja,
pazza, meschugge, insensata wie man woanders sagt). Darüber könnten die
Autoren ebenfalls einen Film drehen oder dazu haben sie diesem Film
vielleicht gemacht.
Insgesamt
ist der Film eine Anklage gegen die
Religionen und die feisten, behäbigen, faulen, dickfelligen, nicht
hilfsbereiten, ritualisierenden Würdenträger
der Religion (so Rituale, statt einmal hinzuschauen und zu erkennen, dass
der Bar-Mitzwa –Anwärter mit Drogen oder aber mit einem Dibbuk
vollgestopft und nur zum Schein seinen Aufgaben, den Text zu lesen und zu
singen, gerecht werden kann. Der
Junge hat es mit einem Dibbuk zu tun und der Dibbuk mit ihm, und eine
Drogenabhängigkeit ist nur eine Ausrede zur Ablenkung. Die Drogen
hätten die Autoren gar nicht nötig gehabt, sie wollen damit die
Zuschauer nur auf die Probe stellen, ob sie etwas begriffen haben vom Film.
Der
Dibbuk dringt in den Menschen ein und steuert ihn von innen heraus zu bösen
Taten. Es ist das gleiche Phänomen, wie man es auch bei uns noch bis die
Neuzeit annimmt: Besessenheit vom
Teufel. Wir sind keineswegs darüber
erhaben, wollen die Autoren wohl sagen. Die katholische Kirche verfügt
über Hunderte von ausgebildeten Exorzisten, und Exorzismus auch bei uns
findet täglich statt, ganz offiziell, wenn auch nicht an die große Glocke
gehängt.
Wenn
man näher hinsieht, sind sämtliche
Figuren von einem Dibbuk besessen, selbst die Sekretärin des höchsten
Rabbi, die den Bittsteller so merkwürdig und so lange ansieht. Es scheint unter den erfahrenen Dibbukbesessenen auch ein geheimes, übereinstimmendes
Wissen um die allgemeine Dibbuk-Last vorzuherrschen, und dieses allseitige
Geheimwissen ist weit unheimlicher als dass der eine oder andere vom
Dibbuk besessen ist. Sie wissen alle, dass alle vom Dibbuk besessen sind,
und sie wissen auch, dass die Anderen es ebenfalls wissen, und
alle tun so, als wüssten sie es nicht und als seien sie selbst und die
anderen nicht vom Dibbuk besessen..
In
der Tat ist dies dem Alltagsleben der Menschen so unähnlich nicht. Auch wir
fühlen, dass wir viel mehr über Andere wissen und diese auch über uns,
und dass alle dies wissen oder ahnen. Diese Dimensionen versucht die
Psychoanalyse wenigstens teilweise mit dem Wort „Mentalisierung“ und
Abwehr zu umschreiben. Es handelt sich um ein überaus selbstreflexives
Wissen, welches das Seelenleben der Anderen mit einbezieht, aber auch die
Verdrängung (in sich), Verleugnung (des Wissens Anderer).
Daneben
ist der Film auch eine Anklage gegen,
oder mehr eine Verachtung für die Menschen, die so hilflos und dumm
sind, wenn es darauf ankommt, einem in Not geratenen Menschen zu helfen, wie
auch ein ganzes Volk vor der Ausrottung zu bewahren. Das gemeinsame Versagen
von Gott wie der Menschen ermöglicht erst den Holokaust.
Auch misogyne Züge sind nicht zu verkennen. Den Anfang macht die Frau
des Händlers in Polen, indem, sie bedenkenlos den Rabbi ersticht, weil sie
ihn für einen bösen Dibbuk hält, aber ebenfalls in einer Art Trance, wie
getrieben. Der Mann steht wie
angewurzelt und mit offenem Mund daneben, ohne eingreifen zu können. Er
zeigt sich als innerlich völlig abhängig von seiner Frau, denn er hätte
dem sterbenden Rabbi auch in den Schnee nachfolgen können oder müssen, um
ihm, der ihm zuvor ebenfalls geholfen hatte, das Leben zu retten.
Auch
die Sekretärin des obersten
Rabbi und besonders die Nachbarin
tragen teuflische, hinterlistige Züge, besonders auch Larrys eigene Frau, die mit seinem Nebenbuhler schon sein gesamtes künftiges
Leben eingeteilt und geregelt, auf eine vita minima reduziert hat, ohne ihn
auch nur zu fragen. Alle behandeln Larry wie ein unmündiges Kind, nein,
schlechter.
Es
passt ins Bild, wenn eine Schallplattenfirma
versucht, ihn am Telefon mit angeblichen Bestellungen zu ködern, zu überlisten
und ihn zu Zahlungen zu zwingen. Seine Beteuerungen, er habe nie nichts bestellt, erweisen sich noch im Telefongespräch genauso
wirkungslos wie seine vorherigen Beteuerungen, er habe „nichts getan“. Sehr richtig und sehr gut ist gezeigt, mit
welcher Rabulistik auch hier der Schallplattenverkäufer vorgeht („Sie
brauchen nichts zu tun, um die Schallplatten zu bestellen, sie werden Ihnen
einfach angeliefert und Sie haben sie erhalten, gerade weil Sie nichts getan
haben, müssen Sie diese kaufen und bezahlen“) Nein, er hat wirklich
nichts getan und auch keine Platten bestellt, aber dies wird ihm nichts
nutzen.
Falschheit,
Lüge, Täuschung und Selbsttäuschung
durchziehen den ganzen Filminhalt. Die Menschen sind schlecht, die
geistlichen Würdenträger noch schlechter, innerlich korrupt durch Haften
an bloßer Gewohnheit. Deren Trost ist verlogen und eigensüchtig. Sie leben
von der Angst der Menschen. Es ist unbegreiflich, wie man diesen Film als
Komödie bezeichnen kann. Wer den Film so beurteilt, wehrt die Grausamkeit
und den inneren Schrecken, den diese verursacht, ab (Lachen als Abwehr gegen den Schreck).
Es
handelt sich auch nicht um eine
Wiederauflage der biblischen Figur des Hiob:
Diesem ergeht es zwar ebenfalls schlecht, aber er hält die Verbindung
zu einem guten Gott, und er weiß, dass er belohnt werden wird. Larry ist eine Gegenfigur dazu, denn er hat keinerlei Hoffnung, nur
Unverständnis, Überraschtsein und Hoffnungslosigkeit. Das einzige was
Larry mit Hiob verbindet, ist, dass er sich für unschuldig hält, und dies
ist sehr wenig. Wenn es denn so gewesen wäre, könnte man bei Larry höchstens
von einem ernüchterten,
desillusionierten, gleichsam abgespeckten Hiob sprechen, der von Gott
nichts mehr erwartet. Sein Schicksal
ist ungleich bitterer als das des Hiob.
Diese
Folgerung hebt auf das allgemeine Nachlassen der religiösen Bindung ab. Der
Mensch hat sich vom Glauben teilweise befreit, aber dadurch findet er
weniger Trost und Hoffnung. Er hat verloren. Ich wäre nicht überrascht,
wenn dies die heimliche Intention der Autoren ist, bewusst oder unbewusst,
aber dies werden die Autoren selbst nicht wissen. Ein
Plädoyer für die religiöse Bindung und eine Anklage gegen diejenigen, die
den Menschen davon abgebracht haben. Trauer
um die verlorene Religiosität, verdeckt durch Spott und Hohn.
Allein
die Vielfalt der möglichen Interpretationen zeigt schon die Tiefe
des Films.
Filmtechnisch ist der Film ebenfalls originell. Die einzelnen Bilder sind überraschend
in ihren klugen Perspektiven, halten sich aber zugleich im Realen. Das Reale
wird hier benutzt, um zu zeigen, wie raffiniert der Dibbuk, der Teufel,
Gott,die Religionen, die Menschen vorgehen können, um Anedre hereinzulegen.
Wenn Larry z.B. auf dem Dach seines Hauses steht und an seiner Antenne als
gelernter Physiker herumdreht, möchte er vielleicht so erhaschen, was diese
Wesen vorhaben oder welches Telefongespräch gerade läuft, muss aber
aufgeben. Dann sieht er dabei „zufällig“ die verführerische Nachbarin
sich nackt in der Sonne räkeln. Oder hat er nur scheinbar an der Antenne
gewerkelt, um anschließend unauffällig diese Nachbarin betrachten zu können?
So kann es durchaus sein, ist der Zuschauer überzeugt. Die Menschen versuchen, es den Dibbuks, den Göttern, den Teufeln an
Raffinesse, an Hinterlist gleichzutun, psychoanalytisch gesehen durch Identifikation
mit dem Aggressor. Sie bilden so
den Aggressor auf menschliche Weise, im Kleinformat, ab. Aber wir können es
nicht so gut, wir bleiben zurück. Wir sind nicht ganz so teuflisch, nicht
ganz so gemein. So bleibt es mit der Nachbarin bei einem harmlosen coitus
mit nur teuflischem Gesichtsausdruck, der niemandem schadet.
Wir dürfen
glauben, wir alle seien nicht weit von diesem Film entfernt. So ist das
Leben, so sind die Menschen. Nein, es ist noch weit schlimmer, ahnt er. Es
ist todernst gemeint, nur auf bizarr
und lustig gemacht. Der Zuschauer merkt, wie sehr er sich täglich täuschen
lässt, und wie bereitwillig er sich
täuschen lässt. Die Autoren respektieren den Zuschauer, indem sie ihm
Raum lassen für eigene Bilder und seine vermutlichen Reaktionen, würde ihm
Solches widerfahren. In seiner Gegenübertragung könnten aggressive Wünsche
aufkommen wie: Alle diese Lügengespinste, diese Gemeinheiten, diese
endlosen Täuschungen zerschlagen! Dabei weiß er aber, wie erfolglos
Solches wäre. Gott, der Dibbuk, die gesamte Filmintention ist wie aus Gummi. Es würde
nichts nutzen, hineinzustechen, so wenig wie der Stich in den Dibbuk. Im
Gegenteil, so die vage Befürchtung, würde dies das Übel nur verschlimmern
und ausdehnen, auf völlig Unbeteiligte. Es wäre wie das Öffnen der Büchse
der Pandora. Das Übel ist nicht mehr einzuholen. Wenn es so schlecht schon
im Kleinen bestellt ist („die Hölle im Kleinen“), wie düster müssen
dann die globalen Aussichten sein? Wollen die Autoren dies vermitteln? Dies
wohl nicht, denn die Menschen belehren zu wollen, liegt ihnen fern,
abgesehen von der Nutzlosigkeit eines solchen Vorhabens. Eher
haben sie solche Intentionen nur für sich selbst wie überhaupt große Künstler.
Sie führen dem Zuschauer seine Haupt-Abwehr vor Augen: Verleugnung der
Realität. Sie haben aber keineswegs die Hoffnung, dass der Zuschauer dies
erkennt. Sie möchten vielleicht lediglich, so nebenbei und ganz elegant,
seine Einfalt zeigen.
Die
Autoren haben den Film erkennbar erst einmal für sich selbst gemacht, aus
Freude am Filmemachen und an Überraschungen, vielleicht, aber nicht sicher,
auch aus gewissen Überzeugungen, und ihn dann erst an den Mann gebracht.
Nun hat sich der Film von seinen Autoren längst selbständig gemacht, und
die Autoren staunen und werden in
Zukunft noch mehr staunen, was sie da eigentlich in die Welt gesetzt haben. Sie
haben gewiss irgendwelche Hoffnungen gehabt, wie Eltern über ihr noch
ungeborenes Kind. Aber wie sich das Kind dann entwickelt hat, - das haben
sie keineswegs vorausgesehen und auch gar nicht voraussehen wollen, und sie
haben auch wenig Einfluss darauf. Die
Produzenten sind selbst zu Zuschauern geworden, und es ist die Frage, wieweit jetzt die Autoren überhaupt noch mitzureden haben, - falls sie
überhaupt noch gefragt würden.
Was würden
sie schreiben, würden sie gebeten, einen Aufsatz über ihren Film zu
schreiben? Mehr als Anekdotisches käme dabei nichts heraus, und sie sind
wahrscheinlich noch ratloser und verwirrter als die Zuschauer, weil sie selbst nicht verstehen, warum sie die einzelnen Anekdoten, die
einzelnen Bilder, eingesetzt haben. Nicht die einzelnen Inhalte sind
entscheidend, sondern wie man mit diesen umgeht. Vielleicht gibt es auch
eine Art Selbstorganisation der
Bilder ohne viel Zutun der Autoren, oder die
einmal geschaffenen Bilder zwingen die Autoren, genauer: deren Gehirne, eine
Ordnung in diese Bilderflut zu bringen. Deren Neuronen schaffen Ordnung,
und die Autoren führen nur die Befehle der Neuronen aus. Sie wissen weder, was in ihrem Gehirn geschieht noch, warum es
geschieht, auch nicht, auf welchen Wegen.
Man
weiß um ihr Nichtwissen in dieser Beziehung, und deshalb werden sie auch
nicht mehr um ihre Meinung gebeten. Sie
haben etwas ins Werk gesetzt, aber das Werk hat sich vielleicht anders
entwickelt, als sie beabsichtigt haben, falls sie überhaupt eine Absicht
verfolgt haben, ist in jedem Fall in die Welt entlassen worden, wo es nun
zurechtkommen muss und auch kann, wie ein Neugeborenes, dass sich zu einem
Erwachsenen entwickelt. Kurzum, es ist ein großes Kunstwerk, es ist nämlich lebensfähig, ein eigener
Organismus.
Wie
sagten noch die alten Griechen in der Odyssee? „Was
entfloh dem Gehege deiner Zähne?“ Für Einwände der Autoren ist es jetzt
zu spät. Die hätten sie eher vorbringen müssen. Der Film ist nämlich
erwachsen geworden.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ergänzt)
Film:
Burn After Reading
Regisseure:
Joel Coen & Ethan Coen
Schauspieler: John Malkovich für Osborne Cox, Tilda Swinton für seine Frau Katie, George Clooney für Harry, Frances McDormand für Linda, Brad Pitt für Chad, Elizabeth Marvel für Sandy Pfarrer.
USA 2008
Der Film setzt mit einem Furioso ein: Ein rasches Näherkommen an den Ort der Handlung vom Weltraum her, nicht untermalt, sondern ebenbürtig mit einer Folge von horrend tiefen und lauten, einsamen Trommelschlägen gleichzeitig mit dem leisen Geräusch eines unerbittlich tickenden uhrähnlichen Apparates, die das Schicksalhaft- Unvermeidliche des zu erwartenden Gewimmels da unten vorwegnehmen und zugleich ironisieren: Was da unten wimmelt, nimmt sich zu ernst, glaubt an Paukenschläge, wo es sich nur um ein elendes Gejaule oder Gewimmer handelt. Mit den Paukenschlägen identifizieren sich die Regisseure zum Hohn mit dem tierischen Ernst, mit dem die Menschlein da unten ihre lächerlichen Anliegen betreiben.
Der Film geht großartig direkt durch das Dach des CIA-Gebäudes auf einen gut polierten Flur, auf dem der flotte, entschiedene, exakte, harte Gang eines noch vitalen Mannes zu sehen ist: Es ist der Gang von Osborne Cox (John Malkovich), eines hohen CIA-Agenten, der zu erkennen ist, als er auf dem endlosen Flur (eine Anspielung auf den endlos wuchernden CIA) eine Tür öffnet und hinter sich schließt.
Er weiß noch nicht, dass es sein letzter Gang dorthin war. Man eröffnet ihm die abstufende Versetzung auf einen minderen Posten im Außenministerium („ Es fällt mir nicht leicht...wir nehmen Ihnen den Balkan“, „aber das Ganze muss ja nicht unerfreulich verlaufen“, „wir schmeißen Sie nicht hinaus“, „es ist nicht so gut gelaufen in letzter Zeit“).
Den Vorwurf eines eisig kontrolliert wirkenden anderen Oberen des CIA, eines Mormonen, Cox habe ein Alkoholproblem (was zutrifft), kontert er damit, dass für einen Mormonen alle Männer ein Alkoholproblem haben müssten.
Ein anderer, Cox offenbar seit langer Zeit feindlich gesinnter Spitzenfunktionär, Olson (Armand Schultz) flezt sich demonstrativ in einer Ecke und genießt die Erniedrigung seines Konkurrenten Cox.
Cox kündigt selbst und spielt „die Kreuzigung eines Bauernopfers für das Versagen Anderer“, indem er sich in ein Kreuz verwandelt, - ein Seitenhieb auf das Versagen der CIA- Spitze vor dem 11. September 2001, auch durch Kompetenzrangeleien innerhalb des CIA, auch auf die Schludrigkeit und Willkür im Handeln des CIA überhaupt. Cox ist offensichtlich ein Bauernopfer für die Versäumnisse Anderer. Meisterhaft ist geschildert, mit welchen perfiden Mitteln dabei vorgegangen wird und wie das Opfer empört Gegenanklagen vorbringt, aber schließlich, verärgert, selbst alles hinschmeißt und die Tür hinter sich zuschlägt, also selbst kündigt Der Fisch stinkt vom Kopf her.
Vielleicht sogleich zu der wesentlichen Erfindung dieses Films: Aus drei Handlungssträngen knüpfen die Autoren nicht etwa ein Seil, sondern sie lassen diese drei Stränge immer wieder an unverhofften Stellen und zu unvermuteter Zeit sich berühren, dann wieder auseinandergehen, nicht weniger plötzlich, als sie zusammengefunden haben. Sie zeichnen so ihre Auffassung vom Tanz des Lebens, und es gibt dementsprechend kräftige Berührungsblitze.
Der Zuschauer hat das Gefühl der Überraschung, aber zugleich auch das Gefühl, dass so eben das Leben ist und er keineswegs überrascht zu sein braucht. Schließlich stellt sich das Gefühl des Selbstverständlichen ein, hinter dem der Zuschauer lediglich etwas hinterhergehinkt ist, vielleicht aus Mangel an Lebenserfahrung, vielleicht einfach aus Tempogründen.
Er sagt zu sich selbst: „Ach ja, natürlich“, „na klar doch“ und „warum nicht?“. Gleichzeitig hat der Zuschauer aber auch ein Gefühl von Respekt entwickelt gegenüber der ungeheuren Vielfalt des gesellschaftlichen Lebens, die durch das Alltagsleben vollständig wiedergegeben ist. Der Zuschauer erkennt, dass das ganze Leben aus solchen elektrischen und elektrisierenden Momenten der Berührung besteht. Das Leben knistert.
Der größte Teil des Knisterns wird gar nicht gehört, des Blitzens nicht wahrgenommen, weil man so genau nicht hinhört und nicht hinsieht. Hörte man hin und sähe man hin, wäre man davon gefangen und damit voll beschäftigt. Die Menschen müssen sich davon, um überhaupt ein Eigenleben zu haben, winzige Pausen stehlen, indem sie sich hinwegstehlen.
Die Dialoge sind geschmeidig, so die üblichen, gern überhörten unmotivierten kleinen Gehässigkeiten und typische Redensarten des small talk bei kleinen Empfängen wie „Haben Sie Lactoseintoleranz oder Säurereflux, - Sie kennen hoffentlich den Unterschied“, - „danke für die Belehrung“ . „Das wäre eine Frage an Ihren Psychiater“ (Anspielungen auf die gängigen kleinen Eitelkeiten und Wichtigtuereien auf Laktose und Säure, es gehört heute zum guten Ton, daran zu leiden, so, wie es früher zum guten Ton gehörte, einen Psychiater oder Psychoanalytiker zu haben, gleichsam als Haushaltsinventar, - Psychoanalytiker in der Gunst des Publikums abgelöst von Laktose und Säure oder Gluten, - wer hätte das gedacht!) sowie Anspielungen an die üblichen snobistischen Leckerbissen (Ziegenkäse der besonderen Art, eklige Spulwürmer, eine Quelle von bestem Eiweiß und Vitaminen, antiallergisch wirkend, eine halbe Einkaufstasche voll).
Die beiden (Cox, Harry) fühlen instinktiv, dass sie um Frau Cox konkurrieren und einander erbitterte Feinde sind, ohne sich dessen bewusst zu sein.
Cox wie Harry merken beide auch bewusst nicht, dass Frau Professor Sandy Pfarrer, Kinderbücherschreiberin und Frau von Harry, es sofort spürt und pikant genießt, dass Katie Cox und Harry ein Verhältnis miteinander haben und sie dies weiß, spätestens, als Harry zu Frau Cox in die Küche schlüpft und dort zu ihr meint, Ossi habe etwas gemerkt von ihrer Beziehung.
„Er weiß gar nichts“, belehrt ihn Katie Cox hochmütig, dabei - in ihrer sexbesessenen Fixierung auf die beiden Männer - Sandy, die Frau Harrys, übersehend.
Aber Harry kriegt von seiner Frau auf der Heimfahrt gesagt, dass Frau Cox ein „kaltes, arrogantes Miststück“ sei. Das war ihre letzte Warnung an ihn, - die er in den Wind schlägt. Sie zeigt ihm damit, dass sie von diesem Verhältnis weiß und sich darüber ärgert, was er aber nicht registriert, und wie sehr sie ihn für diese dumme Wahl verachtet, und sich alsbald von ihm lösen wird, wenn er so weitermacht, wenn sie nicht schon dabei ist, - und, wie sich herausstellt, ist sie schon dabei.
Großartig auch die Idee der Regisseure und das Spiel der Frau Cox, als ihr Cox seine Kündigung beim CIA mitteilt (eine Mitteilung, für die sie zuvor kein Ohr hatte).
Sie hat, da Gäste erwartet werden, ihre Haare zum Stylen in einen weißen Turban oder eine mitraähnliche Erhöhung eingehüllt, sich so als Person erhöht und von den Regisseuren so als Bock zum Gärtner gemacht, und sie erscheint gleichzeitig dreifach aus verschiedenen Perspektiven, darunter auch einer Rückenansicht.
Sie hackt auf ihn höhnisch ein, den drei Schicksalsgöttinnen (Parzen, Moiren) oder auch den Erinnyen dabei nicht unähnlich.
Dann dreht sie sich plötzlich um, und ihre Erbarmungslosigkeit füllt den ganzen Bildschirm. Ossi Cox spielt dabei bewunderungswert den Bedröppelten, Entmutigten, Kleinlauten, sich mühsam Verteidigenden, mit einen kindlich- ratlosen Gesicht, von den Regisseuren auch räumlich tiefer angesiedelt.
Frau Katie Cox muss schleunigst alle finanziellen Daten ihres Ehemannes Osborne Cox heimlich kopieren, um finanziell auf die bevorstehende Scheidung, die sie auf Anraten ihres Anwalts betreibt, vorbereitet zu sein (und später, wie sich herausstellen wird, seine Konten leer räumen zu können oder ihn davon auszusperren), bevor dieser heimkommt.
Ihr Lover Harry muss nach dem Treffen mit Frau Cox, natürlich auf der Yacht von Cox, um ihn in stillem Einverständnis gemeinsam zu demütigen und so ihre Lust zu steigern, ganz schnell sein ritualhaftes, postcoitales Jogging wie nach jedem Zusammensein mit einer Frau betreiben („Ich sollte mal wieder eine Runde laufen“).
Dazu muss ihn Frau Cox an einer bestimmten Stelle aus ihrem Auto steigen lassen, damit er genau 5,2 km laufen kann, zunächst zurück zu seiner Wohnung, später in ihr Haus, da er inzwischen bei ihr eingezogen ist. Er muss aber möglichst schnell laufen, um leistungsfähig zu bleiben, aber auch, um den Spähern zu entgehen und diese ausfindig zu machen, die ihm seine Frau aus der Ferne, aus Kanada, wo sie aus ihren Kinderbüchern vorzulesen hat und ihr Verhältnis mit einem - bestgelaunten - Fernsehkochkünstler pflegt, auf den Hals gehetzt hat, um für die Scheidung, die sie im Sinne hat, Belastungsmaterial zu sammeln.
Alle sind in höchster Eile, alle haben Angst, ihre Wünsche nicht erfüllt zu bekommen. Und was sind das für Wünsche, für die sie sich so abzappeln? Hier folgt eine weitere Überraschung: Es sind ganz banale Alltagswünsche, wie die der Frau Cox, ein Verhältnis anzufangen mit einer Null von Mann, der sich als Personenschützer ausgibt und immer sichtbar eine Pistole mit sich führen muss, um Eindruck auf Frauen zu machen - na, was ist das schon! - und sich scheiden zu lassen von einem Mann, der die besten Jahre hinter sich hat und, Memoiren schreibend und längst impotent, von ihrem Vermögen leben will. Auch dies ist ja wahrlich nichts Weltbewegendes.
Die Wünsche der beiden Angestellten des auf Streckung spezialisierten Fitnessstudios („Stretching Gym“), Linda und Chad, sind ebenfalls banal.
Sie, Linda, möchte an ihrem Körper dieses und jenes wegoperieren lassen, um sich zu verschönern. Sie bleibt fixiert auf dieses kleine, schäbige, dumme Ziel und hat keinen Blick für den Studiobesitzer, der sie so liebt, wie sie ist. Sie muss dazu ganz rasch einen Mann im Internet finden, der ihr diese kosmetischen Operationen finanziert, auf die sie sich fixiert hat, und verabredet sich fleißig, gerät dabei auch an Harry.
Herrlich dargestellt ist ihr ordinär und bösartig verkniffener und berechnender, Falten bildender Mund, wenn sie ihre Absichten verfolgt (wie auch in dem berühmten Film Fargo der Coenbrüder, als Polizistin)).
Sie verkörpert damit wunderbar die Kurzsichtigkeit, das auf schnellen Vorteil gierige Bedachtsein des kleinen Angestellten, der nicht über den Tellerrand sehen kann oder will.
Auch an Hausfrauen, die penibel, geradezu erbittert, die Preise vergleichen und darin kein Erbarmen kennen, kann man denken. Sie sind mit vollem Einsatz dabei, als ob es um ihr Leben ginge, dies zeigen die Regisseure meisterhaft und machen sich damit über sie lustig.
Diese kleinen mimischen und verbalen Anspielungen sind es, welche die Größe der Regisseure besonders erkennen lassen.
Der Chirurg (Jeffrey DeMunn) hat es ebenfalls eilig, ihr die verschiedenen Körperstellen zu zeigen, die korrigiert werden müssen. Großartig spielt der Chirurg, wenn er ihr das Wegoperieren ihrer Narbe von der Pockenschutzimpfung „nachlässt“, - großzügig zieht er zurück, nachdem er sie auf ihr eigenes Betreiben wie eine Weihnachtsgans ausgenommen hat: „Das ist Geschmacksache“, - ein eleganter Wink auf das Geschäftsgebaren erfahrener Geschäftsleute und ärztlicher Geschäftemacher: Zum Schluss steht er noch als verständnisvoll und uneigennützig, als ein Mann von Welt da, der einer Frau nichts abschlagen kann. Er will halt sein Vermögen noch aufbessern, obwohl er längst genug davon hat, weiter nichts.
Ihr kleiner, junger Kollege Chad (Brad Pitt) findet zufällig einen Umschlag mit den Memoirenanfängen des abgehalfterten Mr. Cox, den die Sekretärin des Anwalts dessen Frau im Fitnesstudio liegen ließ, und jubelt über die zu erwartenden großen Erpressungsgelder oder Zuwendungen von der russischen Botschaft.
Er möchte das große Los gezogen haben, muss sich aber mit einer Ohrfeige von Cox zufrieden geben, der zu Recht nicht begreifen will, was man mit seinen Memoiren anfangen möchte.
Als Chad in dessen ehemalige Wohnung einbricht, um mehr von dem scheinbar belastenden Material zu finden, wird er, sich wie in einem schlechten Film im Kleiderschrank verbergend (eine ironische Anleihe aus Billigfilmen, und sich damit von diesen absetzend), von dem inzwischen dort eingezogenen Lover der Frau Cox, Harry (George Clooney) entdeckt, wohl für einen heimlichen Konkurrenten seiner Beziehung zu Frau Cox oder – wahrscheinlicher- für einen Agenten seiner Frau gehalten oder eher reflexhaft, im Schreck, erschossen, - das hat er davon.
So billiges Zeug wie das auf der Diskette will nicht einmal die russische Botschaft haben, geschweige denn dafür zahlen (ein Riesenkubus mit zuzementierten Fenstern bzw. einer Front von quadratähnlichen Radarschüsseln, eine Parodie auf die Hybris und das hemmungslose Wuchern der Geheimdienste auch auf der anderen Seite).
Alles Bagatellen wie auch die vielen, sich überkreuzenden sexuellen Beziehungen (so kommt Linda ausgerechnet mit Harry, dem Liebhaber der Frau Cox zusammen, während sie mit Chad zusammen von Ossi Cox Unsummen erpressen möchte , - Stürme im Wasserglas, die aber ein Menschenleben fordern können.
Harry, der Liebhaber der Frau Cox wird nämlich ungewollt zum Mörder an Chad, mit dem er nicht das Geringste zu tun hat.
Katie Cox ist arrogant, aber sehr präzise in ihrer Einfühlungsfähigkeit in ihren Liebhaber Harry, und so spürt sie genau, dass sie einen Wackelkandidaten zum Freund hat. Als sie erzählt, dass sie die Scheidung eingereicht hat und ihn damit auf die Probe stellt, tritt ihre Befürchtung ein, dass Harry sich unter allerlei Vorwänden und scheinheiligen Erklärungen (so, man müsse Rücksicht auf den gerade entlassenen Cox nehmen), einen Rückzieher macht.
Insgesamt ist gut gezeichnet, wie sich die Menschen in ihren Bestrebungen blind verheddern und
scheitern, nicht etwa an großen Hindernissen, sondern an ihrem Konsenswahn,
das höchste Glück zum Lebensziel zu machen, an dummen Zufällen, am
Kleinklein, sozusagen am Sand des Lebensgetriebes, an Betriebsmüll, der
ständig und immer übersehen die Lücken zwischen den Menschen ausfüllt,
und die Menschen – flink wie Ratten, aber ohne deren Geruchsinn - in
diesem Müll blind wühlen und sich
dabei gegenseitig absichtslos in die Quere kommen lässt.
Harry ist ein unermüdlicher Fremdgeher und immer auf der Suche nach einer reichen, ihm, einem Hallodri ohne Substanz und ohne eigenes Einkommen, Sicherheit verschaffenden Frau, lebt zudem unter der Angst, dass seine Frau, eine Professorin, die Scheidung einreicht, wenn sie ihn bei einem Ehebruch ertappt hat.
Was auch immer ein „Motiv“ der Handelnden ist: Sie unterschätzen regelmäßig die Intelligenz ihrer Feinde oder derer, die sie dafür halten.
Sie halten sich für gescheite Täter, sind aber längst Opfer, bevor sie es wissen. Hier wiederholt sich das Motiv, dass alles so schnell geht, dass die Handelnden, aber besonders auch die Opfer und der Zuschauer, kaum mitkommen, sondern im Verständnis hinterherhinken.
Die Regisseure halten sich an diese grundlegende Konzept: Die Ahnungslosigkeit der Menschen in ihrem selbst erzeugen Gewimmel. Ein Ameisenhaufen hat entschieden mehr Verstand.
Die Autoren lassen zunächst drei Handlungsstränge laufen,
Der Film beginnt mit der Versetzung des altbewährten CIA–Agenten Osborne Cox auf einen kleinen Posten im Außenministerium.
Zu Hause angekommen, wird er von seiner Frau nicht angehört, sondern erst einmal abgekanzelt, weil er die ihm telefonisch aufgetragenen (aber nicht abgehörten) Einkäufe (eine spezielle Sorte Ziegenkäse!) nicht getätigt hat, Als Cox schließlich Gelegenheit erhält, seiner Frau eröffnen zu dürfen, dass er seinem Arbeitgeber CIA gekündigt hat und künftig nur noch als Berater tätig sein oder nur noch seine Memoiren schreiben wolle, reagiert diese eiskalt.
Wunderbar gezeigt ist ihr Hohn: „Schreiben? Schreiben?“ „Was denn schreiben“? Sie spielt wunderbar die Kälte einer nicht mehr jungen Frau gegenüber ihrem Ehemann. mit dem es schon lange nicht mehr geht.
Ihr Gesichtsausdruck ist dabei steinhart, - man wundert sich, dass sie noch einen Liebhaber hat, der aber, wie sich schließlich zeigt, später aus Angst vor ihr („Du bist so negativ.. ich habe vergeblich versucht, das zu ignorieren“) die Flucht vor ihr ergreift.
Sie sieht durch Coxens Kündigung ihr Vermögen in Gefahr und konsultiert ihren Anwalt (Horne). Wunderbar ist dessen raffiniertes Verhalten gespielt, die Frau zur Scheidung zu überreden („Ich sehe k e i n e n Grund, weshalb Sie sich nicht von allem, was bei ihm finanziell vorgeht, sofort Kopien machen sollen“, „Handeln Sie, ehe es zu spät ist und die Schildkröte ihren Kopf und – äh- ihre Hände, ergänzt sie - bereits gehorsam und mit einem wundervoll nervösen Fingerspiel – unter ihren Panzer zurückzieht, und schließlich: „Wir sind jetzt zu weit fortgeschritten, als dass wir noch zurück könnten“, - ein raffinierter, manipulierender, sich philosophisch gebender, sein konkretes Anliegen verbergender Ausspruch).
Sein mimisches Spiel ist eine wunderbare Mischung aus Erfahrung, wie man Mandanten gewinnbringend aufs Kreuz legt und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein, ein wahrer Herrscher, der auch schon äußerlich die Statur dazu hat. Die Szenen sind voll von solchen Erfindungen, gerade im Kleinsten. So auch Cox, der sich „gewissenhaft genau“ seinen Alkohol abmisst, nachdem ihn seine Frau so erniedrigt hat, aber nein, dies ist nicht der Grund, vielmehr trinkt er sich einen an, um in seinem Klub mitgrölen zu können.
Dann sieht man ihn tot daliegen, auf dem Rücken, aber nein er ist nicht tot, sondern hat sich nur besonnen, um seine Memoiren diktieren zu können.
Man sieht, wie zuerst sein Mund arbeitet, bevor ihm die richtigen Formulierungen kommen. Dann stirbt er endgültig, aber wieder nein, er stockt nur und schreckt wie von den Toten auferstehend hoch, als er das Telefon läuten hört, - es ist der Anruf des Liebhabers seiner Frau.
Er stirbt nach dem Verlust seines Berufes noch mehrfach, ist aber einstweilen nicht totzukriegen, er überlebt zunächst, während der kleine Chad zuvor erschossen wird.
Im Klub wird ihm durch einen Fremden, der sich als Studienfreund ausgibt („wir kennen uns doch...“), aalglatt die Scheidungsklage einfach in die Hand gedrückt („hiermit zugestellt und bezeugt“, wohl den USA eine beliebte, rasche Methode, die Scheidung einzureichen).
Währenddessen ist seine Frau auf seinem Schiff (auf das er schließlich umziehen muss) mit ihrem Liebhaber Harry (George Clooney) befasst, und man hört – wieder ein glänzender Einfall - beide stöhnen, aber nicht in der sattsam bekannten Weise, sondern mehr bellend, den Atem heftig ausstoßend, jedenfalls tierisch, genial verfremdet zu einem irgendwie aversiven, abstoßendem Geräusch, wie es Menschen nur auf Anweisung erzeugen können und das mehr Hass als Liebe ausdrückt. Nein, besser ist es als Defäkationsstöhnen bei hartem Stuhl beschrieben. Man will etwas Lästiges loswerden, nicht etwa Liebe empfangen. Nach dem Stoßen und Sich- Stoßenlassen das beiderseitige Abstoßen.
Danach ist alle libido verflogen Das ist richtiges Film-Theater, wie es besser nicht sein kann, d. h. das Reale ist künstlerisch umgewandelt und bleibt dabei real.
Sofort danach ist sie schon beim Sich- Schminken und Anlegen der Ohrringe, und er sagt seinen nach jedem Verkehr wiederkehrenden Spruch: „Ich sollte jetzt mal eine Runde laufen“, ein diskreter Hinweis, dass der Verkehr an seiner Gesundheit (omne animal post coitum triste) genagt hat und / oder er nicht mehr an diesen denken will, weil er die Frau Cox, die seine Frau als eiskalt und arrogant bezeichnet und damit nur das ausgedrückt hat, was auch er empfindet, gründlich satt hat.
Sie ist nur seine Sexpartnerin, weil er, bedroht von eigener Scheidung und Verlust auch seines finanziellen Halts, Anlehnung sucht, und sie Geld hat, besonders nach Ausbootung ihres „Ossis“.
Auch, dass der Verkehr deshalb nur eine lästige Pflichtübung war, die, ist sie vorbei, ist man frei, um hier einen bekannten Satzbruch zu zitieren.
Auch mit der sexuellen Anziehung ist es vorbei oder sie war gar nicht groß vorhanden, denn er interessiert sich per Internet ständig für andere Frauen. Das Abstoßen war der vorläufige Schlusspunkt, - bis zum nächsten Mal.
Man geht unvermittelt, wortlos, ohne sich eine kleine Ruhepause zu gönnen, wieder zum postcoitalen Leben über, sie in ihre Kinderarztpraxis („höre mal, entweder öffnest du jetzt endlich den Mund oder deine Mutter verlässt den Raum, und dann machen wir das unter uns aus.“, - einfach wunderbar, wie die Regisseure die Unbarmherzigkeit dieser Frau mit ein paar Pinselstrichen darstellen, und wunderbar, wie sie diese Rolle spielt, - sie geht nicht einen Deut von ihrem rabiaten Charakter ab, wenn sie es mit einem 5j.Jungen in ihrer Praxis zu tun hat, - von wegen liebe, einfühlsame Kinderärztin, aber fachlich zugleich richtig handelnd, - die Regisseure vermeiden hier jede billige Schwarz-Weißmalerei, und führen jedem, der sie für eine schlechte Ärztin hält, vor, wie einfältig er von einem auf das andere schließt, - er zu seinem Sport eilend.
Die
einzelnen Handlungsfäden verzwirnen sich immer wieder unerwartet.
So gerät Linda per Internet ausgerechnet an Harry, - nach einigen trostlosen Treffen, dabei auch einem Zwangsneurotiker, der Sexualität mit mühsamem Sport verwechselt und einfach nicht zum Lachen zu bringen ist und in dessen Taschen sie einen Auftrag seiner Frau findet („Ach, verheiratet ist dieser miese Typ auch noch“), einen Abflussreiniger zu besorgen (eine Replik auf die Weisung der Frau Katie Cox an ihren Mann, Käse einzukaufen, - wie klein und lächerlich hier ganz nebenbei die Männer gemacht werden, aber nicht weniger die geschlechtsbewussten Frauen, die unbedingt Härte ausstrahlen möchten, - eine Anspielung an einen dummen Feminismus, der sich schon damals überlebt hatte und den die jungen Frauen längst nicht mehr wünschten, aber an dem ältere, die seinerzeitigen Frauen in den Vierzigern, noch hingen).
Harry lädt sie in die noch-eheliche Wohnung („meine Ex hat sich gerade davongemacht“) einlädt und ihr seinen eigens gebauten Fickstuhl im Keller vorführt („hat nur 100 Dollar an Gestänge gekostet plus einige Stunden Eigenarbeit“) mit nach oben stechendem Superphallus, den er bescheiden, wie alle Welt, einen Dildo nennt, fremdartig und enorm, wahrlich ein allseits verehrtes Sonderorgan, weißlich, nie von der Sonne gesehen, und Linda reagiert begeistert und mit einem Ausruf ähnlich wie dem Emoticon „Wow“, und der Rest ist geschenkt.
Auch hier sind die Regisseure im Auslassen genial, - sie wollen doch nichts erklären oder dem Zuschauer aufs Auge drücken. Er hat doch selbst Phantasie genug.
Der Einfall, die Bewegung des Stuhls von einem total altmodisch quietschenden Geräusch (hier eine diskrete Wiederholung der Geräusche beim Verkehr zwischen Frau Cox und Harry auf dem Schiff) wie von einer alten Tür in einem verwunschenen Schloss mit Spinnweben begleiten zu lassen, gehört zu den elegantesten, unaufdringlichsten und genialsten, weil so einfachen (!) Einfällen der Regisseure, dass „Jeder hätte darauf kommen können“, hätte, hätte, ja hätte. Diese Idee spielt wohl auf das unerkannt Verspießerte, bloß Konsenshafte, Anpassungshafte, Imitative und Mechanistische der Jagd nach dem sexuellen Glück an, und wenn nicht, ist es eine umso kühnere Erfindung, die keiner Begründung bedarf.
Alles ist von leichter Hand gemacht und wirkt deshalb authentisch. Die Regisseure drängen sich nie auf, sind nie belehrend, lassen alle Schwere hinter sich oder besser: Haben nie solche Schwere gehabt. Sie fliegen.
Sie fühlen im Weltraum der Phantasie wohl, und nicht zufällig beginnt und endet der Film mit dem Weltraum.
Hier ist in einem tieferen Sinne das Publikum König (das Wort Kunde, client, kann ich, Entschuldigung, wenn ich so privat werden muss, nicht ausstehen, besonders nicht in künstlerischem Zusammenhang, und auch nicht in der Psychoanalyse, das sei Ihnen von mir geklagt) es kann selbst entscheiden, was es aufnimmt und sich denkt.
Respekt der Zuschauer vor den Regisseuren und Respekt der Regisseure vor den Zuschauern, - so muss es sein. Die Regisseure trauen den Zuschauern das zu, und diese den Regisseuren.
Filme (nicht zufällig im Anfang „Lichtspieltheater“ genannt) sind wie Theaterstücke nicht nur Dialoge zwischen Regisseur und Publikum, sondern auch immer Respekt-Dialoge zwischen ihnen. Die gegenseitige Achtung hängt natürlich auch mit einer gesunden Selbstachtung zusammen.
Alles Verbiesterte, Kleinliche, Zwangshafte ist den Regisseuren fremd. Es herrscht eine olympische Atmosphäre wie im alten Griechenland, in dem die Götter fremdgehen durften, wenn sie nur humorvoll waren, jetzt nennt man das Weltraum. Man darf dort wie dort frei flottieren.
Der schließliche Hirntod des Osborne
Cox war ein Missgriff der Regisseure,
da zusammenhangslos und unnötig. Er wäre auch so erledigt gewesen. Hätten
die Regisseure ihn doch in Gottes Namen seine Memoiren schreiben lassen. Er
war es ja nicht, der weiteren Schaden angerichtet hätte. Es mag auch sein,
dass die Regisseure hiermit den CIA
treffen wollten, indem sie diesen als hirntot bezeichnen.
Ein CIA–Agent hatte in seinen Kopf geschossen, als Cox versuchte, den Inhaber des Fitnessstudios zu erschlagen, nachdem Cox diesen bereits angeschossen hatte, weil er ihn in seiner ehemaligen Wohnung vorfand. Übrigens hatte Cox in seiner ehemaligen Wohnung nach Bankunterlagen gesucht, sich dann über Alkoholvorräte und eine Stapel Playboy-Hefte hergemacht. Der Fitness- Mann hatte nur erforschen wollen, in was seine verehrte Linda verstrickt war. Erneut eine Verkettung von Zufällen und Motiven, die nichts miteinander zu tun hatten und von den jeweiligen Gegenspielern auch nicht erraten werden können. Die Motive liegen derartig verquer, dass hier Empathie nicht helfen kann. Für einen Todesschuss reichte es aber allemal, wollen die Regisseure sagen.
Aber an diesem Punkt ist den Regisseuren die Eleganz, die Leichtigkeit ihres Stils abhanden gekommen. Dieses Ende ist einfach zu plump und fällt dadurch aus dem Rahmen, die Regisseure haben an dieser Stelle ohne Not ihr Niveau unterschritten.
Gut gespielt ist aber die zynische Erleichterung des CIA-Oberen („supervisor“), es mit einer lästigen Figur weniger zu tun zu haben.
Aber zwei Tote sind zwei Tote zuviel für die Darstellung unserer Spaßgesellschaft, es hätte auch ohne Tote gehen müssen. Denn diese gierigen, kurzsichtigen Leute haben sich doch genug selbst geschadet, und dieser Gesichtpunkt kommt zu kurz, wenn man Tote einführt. Es entsteht auch der Eindruck, dass Cox nur hirntot werden musste, um die Geschichte endlich zu Ende bringen zu können.
Es scheint den
Brüdern Coen auch in anderen Filmen schwer zu fallen, einen Schluss zu
finden, der mit dem Stück nicht bricht, so auch in „A serious man“.
Die Kleinstanliegen der Menschlein da unten schlagen Wellen und Wellchen bis in die höheren Chargen des CIA. Dort führen sie zu Ratlosigkeit und Verwirrung („Was haben wir aus dieser Scheiße gelernt? Nichts.“). Glänzend gespielt ist die Rolle des CIA Supervisors (J K Simmons) gegenüber dem hohen CIA-Agenten, seinem Berichterstatter, der verzweifelt und zwangshaft eine Ordnung in die Nachrichten bringen möchte und dabei subaltern- kleinkariert bleiben muss, weil er aus seinem Charakter nicht herauskann („Ach, soweit klar, - wenn da nicht noch ein Haken wäre...“).
Der Supervisor hat tatsächlich einen
großen Überblick, ein unabhängig
arbeitendes, skrupelloses Gehirn, wie es auch ein psychoanalytischer
Supervisor von Rang haben sollte, aber den finden Sie erst mal (wenn Sie
mir diesen Anakoluth verzeihen oder lassen Sie es), aber nicht, dass es
diese nicht gäbe, und dieses ermöglicht die einzig richtige „Erklärung“
für das, was sich „da unten“ und
immer wieder auch „da unten“ am Körper abspielt: Nebensache, das
ganze ist, so der Supervisor, eine „riesengroße Scheiße“, Alltagsscheiße, „in die einfach keinen
Sinn zu kriegen ist, und Linda werden selbstverständlich die vier
kosmetischen Operationen bezahlt, der Preis kommt gar nicht zur Sprache, -
nur weg damit. („Sie haben Linda?
Was soll das heißen, - Sie haben? - eine
wundervoll spöttische Wendung, die sich über die allgemeine sexuelle
Routine mit ihrem Eifer und die Sucht nach Selbstbewunderung lustig macht,
die das Motiv für das gängige sexuelle Gehoppel abgibt.
Was sollen wir mit Linda? Die russische Botschaft? Was will die denn?
“ „Das FBI hinzuziehen? Um
Gottes willen, die nicht auch noch“, eine Seitenhieb auf das vielfache
Versagen des FBI).
Daraufhin geht der Blick des Supervisors wunderbar an die Zimmerdecke und dem folgt elegant die Kamera wieder durch die Decke wie gekommen, getrost gen Himmel, als ob nichts gewesen wäre. Es war auch nichts, außer zwei Toten. Sturm im Wasserglas. Es war echtes Theater. Theater ist eben Theater, das wollen viele nicht begreifen.
Psychoanalytisch gesehen werden hier Wünsche nach Macht, Größe, Erniedrigung des Konkurrenten, nach Geld, nach erfülltem Sexualitätsprogramm, vor allem aber nach Übereinstimmung mit der jeweiligen Zeitströmung (Konsenswahn) sowie Ängste, vor allem Vergeltungsängste, aber so gut wie keine Scham- oder Schuldgefühle vorgetragen. Diese Emotionen werden abgewehrt durch häufige Identifikation mit dem Aggressor, Wendung gegen sich selbst (laufend Selbstschädigungen), Isolierung von Gefühlen zugunsten gespielter Gleichgültigkeit, grobe Verleugnungen von Offensichtlichem, Idealisierung (der Sexualität, des „modernen, flotten Lebens“ mit viel Handy- Telefonaten, mit Anpassungen und Unterwerfungen unter den heutigen Lebensstil in gehobenen Kreisen, - diesmal ausnahmsweise nicht in der Unterschicht wie sonst so oft).
Als ein unerwartetes Nebenergebnis darf vermerkt werden, dass hier die Brüder Coen auch die Grenzen der Empathie aufzeigen.
Diese kann nur an Plausibilitäten anknüpfen, - die hier in solchen Fällen nicht gegeben waren. So hat hier endlich einmal die Psychoanalyse aus einem Film Gewinn gezogen. Dies ist selten, aber umso bemerkenswerter. Dies sollte öfter vorkommen, - statt in einem Film nur das wiederfinden zu wollen, was man schon als Konzept hat, - die berüchtigten selbst versteckten Eier.
Dr. Manfred Krill, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychotherapie, Psychoanalyse (Mitglied in DPV, IPV, FPI, International Psychoanalytic Association, IPAA).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
|
(ergänzt) Barton Fink
Drehbuch: Ethan Coen, Joel Coen Kamera: Roger Deakins Schnitt:
Roderick Jaynes (. Pseudonym für die Coen-Brüder,- diese haben
also den Schnitt selbst gemacht, - die können einfach alles am
Filmemachen) Musik: Carter Burwell Michael Lerner (Jack Lipnick), John Mahoney (W.P.
Mayhew), Tony Shalboub (Ben Geisler), John Polito (Lou Breeze),
Steve Buscemi (Chet). |
|
|
Inhaltlich
ist der hervorragenden Rezension von Andreas Thomas aus filmrezension.de
nichts hinzuzufügen.
Diese
Besprechung folgt nicht streng dem Filmverlauf, bildet mehr assoziative
Schwerpunkte ab.
Vom
psychoanalytischen Standpunkt aus
ist immer wieder Abwehr von Wünschen, Ängsten durch grobe Verleugnung und durch Verschiebung auf Anderes auffallend. Im
Übrigen stößt bei diesem Film Psychoanalyse an nahe Grenzen. Die
künstlerischen Erfindungen sind hier so zahlreich und tiefgehend, dass sie
im Vordergrund stehen.
Die
Musik (Carter Burwell) ist wie
immer in den Filmen der Brüder Coen bemerkenswert. Die tiefen ,
geheimnisvoll langsam auf- und absteigenden Bässe und deren
erbarmungsloser, nicht einmal vom lieben Gott beeinflussbarer Ostinati wie
auch tiefe, unklare, brüchige oder schleichende Geräusche stehen für das
Finster-Unheimliche des Films, die hellen, sauberen, sorgfältig voneinander
abgesetzten und sich nur wenig auf- und abbewegenden, vorsichtig-
behutsamen, silbrigen Klavierterzen, begleitet von einzelnen geheimnisvollen
Glockentönen, sind von einer wunderbaren Warmherzigkeit und unbegreiflichen
Schönheit, ja Innigkeit, aber auch Melancholie, und beide Instrumente
zusammen haben etwas unerbittlich, schicksalhaft Vorwärtsschreitendes an
sich, was dem Stück auf bedrückende Weise die Grenzen des Menschen, sein
Ausgeliefertsein an Andere und an sich selbst, aufzeigt.
Es
ist der Gang der Welt, der
besonders die Hauptperson, des Drehbuchautoren Barton
Fink (John Tarturro), der am
Anfang des Films nicht weiß, wie ihm mit seinem Erfolg am Broadway
geschieht, und nicht an den eigenen Erfolg und an die Urteilskraft der
Kritiker und Zeitungsschreiber glauben mag, sich dann überreden lässt,
nach Hollywood zu gehen. Das ist eine regelrechte Überraschung
für den jungen Schriftsteller, und diese ist genial dargestellt durch eine
nicht weniger überraschende Woge,
die an der kalifornischen Küste hart und erschreckend laut gegen einen
vorgelagerten Felsen prallt, sich an ihm wunderbar bricht und triumphal
hochschäumt, hiermit auch den Erfolg eines jungen, vielversprechenden
Autors, aber auch sein mögliches Scheitern („nur Schaum“)
vorwegnehmend.
Fink
bleibt ein Kind, ein Kind, über das Erwachsene unentwegt verfügen, und dies bis zum Schluss, im Übrigen ein
Kind, das seinen diffusen visionären. sozialen Weltverbesserungsideen, die
Welt des „einfachen Mannes! durch Schreiben von Theaterstücken verändern
zu können, verhaftet bleibt, - ein kindlicher Phantast.
Als
er aber auf einen - vermeintlich oder tatsächlich – einfachen Mann
stößt, auf Charlie, seinem Nachbarn, und dieser ihm – dreimal -eine
„Menge Geschichten“ erzählen will, hört er gar nicht zu, was ihm
Charlie auch ganz zum Schluss des Films zornig entgegenhält (auf Finks
Frage, warum es gerade ihn „getroffen“ habe mit der Begegnung mit einem
(diesem) Serienmörder: „Weil Du, verdammt noch mal, nie zuhören willst, wenn ich dir eine
Geschichte erzählen will)“,
Fink
hält diesem statt dessen einen hochmütigen,
langatmigen Vortrag über sein Weltverbesserungsthema, auch mit
arroganter Mimik, mit herabgezogenen Mundwinkeln, mit seinem Oberkörper
zurückweichend und somit Distanz schaffend.
Fink
überhört in einem Belehrungseifer den eindeutigen Kommentar seines
Nachbarn Charlie: „Es tut mir jetzt
schon der Hintern weh.“
Ausgerechnet
diesem „einfachen Menschen“ gegenüber unternimmt es Fink, vom Leben des
„einfachen Mannes und wie man dieses ins Theater bringt“, in einer Suada
wie sonst nie mehr im Film, zu schwärmen.
Fink
leidet unter schwerer Schreibhemmung,
ihm fällt nichts Neues ein, er bleibt vielmehr am Schluss seines
Erfolgsstücks am Broadway hängen.
Er
hört Charlie, wie erwähnt, nie zu, wenn diesem ihm immer wieder „lauter
Geschichten“ erzählen möchte
und auch die ganze Geschichte, die er
im Hotel erlebt, nimmt er nicht als Gelegenheit beim Schopfe, um sie
für ein Theaterstück zu verwerten.
Sogar
das Catching / Wrestling hat er doch gerade am eigenen Leibe erlebt, und
dies ist doch der Titel, mit dem er beauftragt wurde. Die Autoren zeigen
hier meisterhaft, dass die Menschen
wie mit Blindheit geschlagen an den Gelegenheiten vorbeilaufen.
Sogar
zum Schluss kann er sich nicht aus dieser kindlichen
Rolle der Abhängigkeit von Erwachsenen lösen, die ihn an Macht,
Selbstbewusstsein und Einfluss auf Andere gewaltig überragen.
Zuletzt
wird er, völlig verdutzt durch die rasche Abfolge, auch dem rasanten Brand
des Hotels ratlos zusehend, durch einen Großen, Mächtigen, wieder einem
Erwachsenen, diesen Zimmernachbar Charlie, den Serienmörder, gerettet.
Wie
dieser eine Riesenanstrengung
unternimmt, die Eisenstäbe, an die Fink mit einem Klaps auf die Backe
von den Kriminalbeamten angekettet wurde, auseinander zu biegen, ist im Gesichtsausdruck
von Charlie meisterhaft gezeigt.
Es
ist interessant, dass sein Gesicht in der äußersten Anstrengung den
Ausdruck äußerster Bösartigkeit zeigt.
Mehr noch als gute Taten scheinen böse Taten besonders anstrengend zu sein.
Auch
Charlie ist, wenn er gerade einen Mord hinter sich hat, sichtlich
erschöpft. Oder soll man daraus den Schluss ziehen, große Anstrengungen
zögen leicht böse Taten nach sich? Alles ist irgendwie austauschbar.
Wundervoll
ist auch der filmische Einfall, eine belanglose
Messingkugel, die an einem der Bettstäbe befestigt war, herabfallen und
auf den Zuschauer hin rollen zu lassen, als Fink von Charlie von diesen, an
die er gekettet ist, befreit wird. Die
Kugel hätte sich sozusagen nie gedacht, dass es so kommen würde, -
dies war in ihrem eintönigen
Kugelleben nicht vorgesehen, - so wie nichts bei den Figuren des Film so
vorgesehen war, wie es dann kam.
Übrigens
ist nebenbei die Idee mitgeliefert, dass auch
Unbelebtes ein Eigenleben hat (Kugel, Autohupen, Geräusche im Hotel)
als ob es eigene Wesen seien. U.a. in Philosophie und Soziologie geht man in
ähnlicher Weise mit abstrakten Begriffen um.
In
dem verkommen alten, stickigen, aber
alterswürdigen und altersehrwürdigem
Hotel (Drehort das Gellert- Hotel in Budapest? Oder in einem
nachgebauten Hotel in den USA? – Jedenfalls täuschend ähnlich)
angekommen, bedient Fink einen ewig
langtönenden Klingelknopf, auf den hin zunächst nichts geschieht und
auf den es erst nach einer langen Pause fürchterlich im Boden rumpelt und
wie ein Geist (aber es ist ein ganz normaler junger Mann, das Fiktive ist
hier als etwas höchst Reales gezeigt, wie bei Kafka) aus der Unterwelt der
Rezeptionist erscheint, aus einer Klappe im Boden, der dann mit
einer Selbstverständlichkeit sondergleichen, d.h. wie offenbar gewohnt,
den Klingelton mit seinem Zeigefinger verstummen lässt, ihm dann eine
streng auf den Rezeptionstisch angenageltes,
drehbares uraltes Fremdenbuch vorlegt, in das er sich eintragen kann.
Dann
nimmt Fink den Aufzug, uralt,
langsam, mit Nebengeräuschen und einem ganz alten, psychisch entleerten
Aufzugführer, der seelenlos und kontaktlos und nur für sich das
Stockwerk nennt. Wollen die Regisseure die Wirkung einer modernen
eintönigen Tätigkeit andeuten? Macht Routine die Menschen kaputt? So. wie
das seelenlose Stückeschreiben im Dienste von Hollywood die Schriftsteller
in den Grabkammern des Autorenhauses enden lässt? Auch im Geistesleben,
auch im Kulturbetrieb lauert der Tod durch Routine, nicht anders als im
Hotelbetrieb..
Dann
betritt er den erschreckend endlos
langen Flur aus der K & K – Zeit, wohl in den USA europatreu
imitiert, mit den typischen braven, herrlich verspießert-
tüllbehängten, gelben Lämpchen an den Seiten und mit einem
beängstigend weit entfernten Fluchtpunkt, wie den Vorläufer einer nachts
beleuchteten Autobahn, und die verhalten knarrende, von zahllosen Betretern
erschöpfte Diele, alles gerade
noch gepflegt, dass es funktioniert, über die lange Zeit mühevoll in
Funktion gehalten, wie eine alte, schön geschminkte Frau.
Im
Zimmer angekommen, ist Fink weiterhin wie betäubt, versucht vergeblich, das
uralte Fenster zu öffnen, mit
einem schrecklich trockenen Geräusch aus altem Holz und schabendem
Glasgeräusch, das jedes Ohr quälen muss, wirft
den Koffer mit der Schreibmaschine auf das Bett, sein einziges Gepäck,
wie er auf Frage des Portiers angibt („Der Rest wird nachgeschickt“, -
es gibt aber keinen Rest. Fink will nur nicht erkennen lassen, dass er gar
nichts hat und arm wie eine Kirchenmaus ist).
Und
hier wieder ein wunderbarer Einfall der Regisseure: Das Bett wimmert regelrecht unter der Wucht des Koffers, schwingt
jammernd auf und ab, bis es sich beruhigt. Den jämmerlichen Zustand der Matratze und der Federung nach hundert Jahren
der Belastung durch ein oder vor allem zwei Hotelgäste, nach deren
tausendfachen orgiastischen Höhepunkten, diese gleichzeitig wie einen
fernen Nachklang wiedergebend. Was haben die dort herumgelegen und herumgeturnt
und herumgemacht, vor allem dieses, zu zweit, gewiss auch zu dritt,
möchten die Regisseure wohl vermitteln.
Aus
den orgastischen Lauten ist ein Wimmern geworden, - der Lauf der Welt.
Auch
das Bett hätte diese seine Zukunft nicht ahnen können. Es war überrascht
von der plötzlichen Belastung durch eine Schreibmaschine. Wahrscheinlich
hat noch nie eine Schreibmaschine auf dem Bett gelegen.
Das
Bett ist böse überrascht und wimmert. Die Schreibmaschine hingegen bleibt
ganz sie selbst, überlegen, geborgen im Koffer. Das „Unbelebte“ ist
höchst lebendig und hat heftige Erlebnisse.
Fink
sieht ein Urlaubsreise-Photo mit
einer schönen Frau am Strand, die dem Betrachter den Rücken zuwendet.
Ganz zum Schluss des Films kommt ihm diese Frau entgegen, spricht mit ihm
und sitzt schließlich genauso da wie auf dem Photo. Was wollen die
Regisseure damit wohl sagen? Dass sich vieles wiederholt und alles einander
ständig ersetzt, austauschbar
ist. Ein Photo ist mit einer leibhaftigen Person austauschbar. Charlie hat Finks Schuhe mit seinen verwechselt und bringt sie zurück.
Fink
beschwert sich beim Portier Chet über die störenden
Lachsalven seines Nachbarn Charlie, eines Serienmörders, wie sich
später herausstellt.
Dieser
tritt unter viermaligem, energisch
protestierendem Türklopfen ein, um Fink zur Rede zu stellen. Fink
entschuldigt sich, redet sich darauf hinaus, er habe sich nur Sorgen um
Charlie gemacht. Da ist von Charlies Seite „alles schon vergessen“.
Man
freundet sich gut und rasch sich an, mit einem Mann wie Charlie, mit dessen gutmütigen Gesichtsausdruck und gemütlichen
Übergewicht (einem
„Pfundskerl“), und der auch immer eine Flasche Whisky mit sich
führt und Fink wiederholt anbietet, (wenn es eine Frau wäre: „An diesem
Hintern, - da mecht ich
überwintern, an diesem Po, - ebenso“.) kann man auch gar nicht anders.
Fink nimmt aber seine ausgestreckte Hand nicht entgegen.
Zweimal
ein einsames, fernes Autohupen,
klingt sehr seltsam, aber irgendwie großartig ist diese Erfindung, es ist
schwer zu sagen, warum. meldet sich hier noch etwas Anderes, das immer im
Spiel ist, im Hintergrund oder im Vordergrund oder nebendran oder sonstwo
immer mitspielt, - das wir aber nicht näher bestimmen können?
Es
könnte an barocken Generalbass
erinnern, der immer irgendwie dabei ist und heimlich alles lenkt oder
begleitet, und bei man ebenfalls nie weiß, ob er mehr begleitet oder führt
oder herausgefordert wird, - er ist jedenfalls immer dabei. Genau so gut
könnte jemand nebenan oder im Zimmer selbst einen einsamen Pfurz lassen,
und auch dieser hätte eine nicht klar fassbare Bedeutung.
Auch
wird die gegenwärtige Szene durch das Autohupen irgendwie betont und
herausgehoben. Ist es eine Art Anerkennung der laufenden Szene, wenn auf
einmal ein fernes Autohupen zu hören ist? Das Auto sagt etwas zu der Szene.
Es ist ein Gespräch zwischen den beiden. Auch ist es ein Widerhall der
Alltagsgeräusche, die sich immerfort in unsere Handlungen einschleichen,
wie auch der unaufhörlichen
Geräusche der vielen Gäste in diesem Hotel, von denen man nur die Schuhe
vor den Zimmertüren stehen sieht, wie auch eine Antwort, eine
Begleitung zu unserem eigenen Atemgeräusch. Alles hängt mit allem
irgendwie zusammen, alles spricht mit allem und hört von allen.
Charlie
erzählt, dass er Versicherungsvertreter
ist und den Hausfrauen „Seelenfrieden“ bringt, in dem er ihnen
Versicherungen anbietet, nur leider wissen diese oft nicht, was für sie gut
ist, und so bringt Charlie sie um, - weil „Hausfrauen so grausam sein
können“ und er, wie er am Schluss sagt, mit ihnen leidet und sie erlöst,
-„ich wäre froh, wenn das auch
jemand für mich täte“.
Aber
ganz zum Schluss beschwert sich
Charlie fast weinend bei Fink, dass dieser in seinen Bereich
eingedrungen sei, wo er doch nun mal lebe, in sein Zuhause also, und sich
dann noch über ihn beschwert habe, „weil ich zuviel Lärm machen
würde“. Charlie zeigt hier seine andere Seite: Weich, höchst empfindsam,
empfindlich, traurig, ein richtiger, liebenswerter Mensch, unter seinem
Übergewicht und der Hitze im Hotel leidend und stark schwitzend
(„Mein Gott, ist das heiß hier, ...die Zentrale macht mir die Hölle
heiß, ich möchte aus der Haut fahren“, - ein armer Teufel, der in
seiner eigenen Hölle und in der Hölle Anderer schmort) und so
anscheinend keine Spur mehr von einem Serienmörder bei ihm, jedenfalls so
wenig erkennbar, dass man auch nicht mehr danach sucht oder darauf gefasst
ist.
Ich
habe allerdings den Endruck, dass die Regisseure Coen & Coen nicht zwei
Seiten ein und desselben Menschen zeigen wollen, - das wäre noch
konventionell und fast harmlos gegenüber dem, was sie dem Zuschauer
wirklich auferlegen.
Die
Menschen sind komplett austauschbar, und zwar von einem Augenblick zum
anderen.
Wir wissen dies ja schon aus anderem Zusammenhang. Der Kommandant des KL
Auschwitz wohnte dort harmonisch mit seiner Familie und pflegte dort sein
Gärtchen, über Großverbrecher des 2. Weltkriegs überhaupt auf so gut
allen Seiten kann man leicht ihr harmloses, fleißiges, bisweilen geradezu
musterhaftes, auch durchaus liebevolles und liebenswürdiges Vorleben
nachlesen. Diese Verbrecher hätten selbst (!) niemals vorausgesehen (und
auch nicht gewünscht!), dass sie sich zu Ungeheuern entwickeln würden, und
zwar binnen kürzester Zeit, - wenn die Umstände sich entsprechend wandeln.
Auch in diesem Film zeichnen die Regisseure dies meisterhaft an den
verschiedenen Figuren nach.
Aus
Jedem kann alles werden, und wieder zurück. Das Böse und das Gute,
vielleicht in dem Paket
dargestellt, von dem die beiden Hauptfiguren sagen, es gehöre ihnen, nein,
es gehöre ihnen nicht, und sie wüssten gar nicht, wem es gehöre. Sehr
richtig! Es kann wandern von einem Menschen in den anderen und wieder
zurück, und die Betroffenen wissen ebensowenig wie ihre Opfer und
Empfänger, wie ihnen geschieht (!). Obwohl selbst höchst aktiv, haben sie
doch nicht das Gefühl, selbst handelnd zu sein. Zu der Ausflucht, sie
hätten nur Befehle befolgt, ist es nur ein winziger Schritt, den sie aber
alle mit Leichtigkeit tun können. Sie sagen das, was sie fühlen, sie
lügen nicht einmal.
Etwas
Ähnliches glaube ich bei vielen zerstörerischen Scheidungen gesehen zu
haben (Krill 2008, 282 ff). Die Menschen handeln plötzlich hasserfüllt wie
in Trance, haben nicht das Gefühl, selbst etwas ins Werk zu setzen, sondern
sind höchst erstaunt, wenn man sie darauf hinweist. Früher hat man gesagt,
„wie wenn der Teufel hineingefahren
ist“, oder die Person sei vom
Teufel besessen“. Man hat ja früher auch gesagt: „Da soll der
Teufel hineinfahren“. Hier ist durch das Wort „fahren“ auch die
Geschwindigkeit und Unvorhersehbarkeit der Veränderung im Menschen
abgebildet.
Der
Teufel geht nicht zu Fuß,
zumal er durch einen Klumpfuß behindert ist, sondern er
fährt, er fliegt. Er ist
blitzschnell. Dies war vielleicht gar nicht so falsch. Jedenfalls war es
praktisch höchst brauchbar und bildete und bildet in vielen
Zusammenhängen, im Alltagsgeschehen, im Kriegsgeschehen, im Kampf der
Fanatiker, aber auch in plötzlichen Ehekrisen oder Auseinandersetzungen mit
Nachbarn, mit denen man viele Jahre in Frieden gelebt hatte, die
Wirklichkeit besser ab als die Psychoanalyse mit ihren vornehmen, wenn auch
nicht falschen, Vorstellungen über Charakter und Entwicklung sowie braver
Lösung von inneren Konflikten.
Wir
glauben uns über jeden Geisterglauben hoch erhaben. Aber es gibt noch 250
offizielle, ausgebildete Teufelsaustreiber in der katholischen Kirche, und
neben dem aufgeklärten Christentum hält sich z. B. in Südamerika
hartnäckig Anderes. Wenn man statt Teufel das Wort „Neuronen“ einsetzt,
ist man gewiss nicht weit von der Wahrheit weg.
Es
scheint so zu sein, dass ganze Neruronenverbände plötzlich aktiviert
werden können und in andere feuern und diese dann immer weitere mitreißen.
Hierzu gehört ja auch der generalisierte epileptische Anfall.
Auch
die plötzlich gewalttätigen Fans fallen in diesen Zusammenhang.
Das
Gehirn ist ein riesiger Apparat, und in ihm können sich Stürme ohne
großen äußeren Anlass entwickeln, die alles an guter Erziehung,
Frömmigkeit (Maiandachten? Firmung? Messen? Predigten? Gebete? Beichten?),
Vorsatz, Vernunft hinwegfegen. Homo homini lupus.
Es
ist, als ob die Menschheit im Tiefsten die Überzeugungen der Brüder Coen
teilt, oder diese nur das sagen, was die Leute ohnehin glauben.
Nach
kurzem Schlaf bemerkt Fink entsetzt, dass sich
die Tapeten von den Wänden lösen, mit einem ekligen Klebstoff-Laut,
und als Fink sie wieder an die Wand drückt, hat er eine fädenziehende,
verkäste, ekelhafte Substanz an den Händen. Später das Gleiche im Beisein
Charlies, seines Nachbarn. Dies zeigt das Heruntergekommene des Hotels und
der Zeit überhaupt, - mehr Schein
als Sein und mehr Schleim als Schein, wohl den Klebstoff,
nämlich Scheiße, welche die Welt zusammen hält. Auch hinter
der Tapete sieht es ekelhaft aus. Nichts und keine Menschen sind so wie versprochen. Das
Hotel schält sich innen wie ein Darm.
Dementsprechend
ist es auch unnatürlich heiß im
Hotel, - eine Anspielung auch an die
alte Druck- Dampfheizung mit 120 Grad Temperatur in solchen alten
Hotels, die sich nicht herunterdrehen lässt und zu ständigem Lüften auch
im Winter zwingt, dafür immerhin nicht die Leitungen mit Kalk verstopft,
aber besonders wohl auf das untergründig Erhitzt-
Wabernde der menschlichen Aktivitäten anspielend, namentlich wohl auch
auf das Verdampfen von Blut in diesem Hotel, in welchem der umgängliche,
herzensgute Charlie, den auch der Zuschauer sofort in sein Herz schließen m
u s s , nebenan sein Serienmordhandwerk fortsetzt. Man hört sein – wohl
sadistisches - Lachen, als er –
nach den wimmernden, jammernden
Lauten des Opfers zu urteilen – nebenan eine Frau zu Tode quält.
Weil
wir gerade beim Akustischen sind: Fink hört später, wie über ihm ein
Körper über den Boden geschleift wird, dann, wie der Körper zu
handhabbaren Portionen zerhackt wird. Es ist der Körper der
Lebenspartnerin des Dichters Mayhew,
Judy,die ihn besucht, um ihm aus
seiner Schreibhemmung herauszuhelfen, und die Fink nach dem sexuellen Zusammensein mit ihr zu seinem Erschrecken
ermordet hat, denn sonst war niemand in seiner Wohnung, - oder war doch
Charlie darinnen, als Fink schlief?
Es
kommt nicht darauf an, denn die
Menschen und ihre Untaten, aber auch ihre gewöhnlichen Tätigkeiten (Fink
sieht man seine Tasten tippen, unmittelbar dabei stellt sich heraus, dass es
nicht seine Finger sind, sondern die einer Sekretärin)
sind austauschbar.
Überall
passieren die grauslichsten Sachen, aber Fink und Andere verleugnen diese in
gröbster Weise.
Auch
das Umgekehrte tritt ein: Fink sieht den allseits verehrten Schriftsteller
Mayhew aus der Toilette kommen, piekfein,
mit gut sitzendem Schlips, total sauber. Unmittelbar zuvor hat dieser,
sich vor die Toilettenschüssel kniend, wie Fink , sich ebenfalls hinkniend
,von außen sehen konnte, in
übelster Weise erbrochen und dabei die
allergrauenhaftsten Geräusche von sich gegeben, eine Mischung von Ekel,
Abscheu, Verachtung, alle Schlechte aus sich möglichst laut und
rücksichtslos- ausstoßend, herauswürgend, herauskotzend. Also hier zuerst
das Fürchterliche, das sich dann als harmlos entpuppt, sozusagen eine
Verleugnung des Bösen, die man hautnah miterlebt.
Gemeinsam
ist die Unzuverlässigkeit unserer
Sinneswahrnehmungen, Meinungen und Pläne, also kurzum die
Unvorhersehbarkeit unseres Schicksals. Auch die Polizeiagenten laufen an dem
Paket mit dem Kopf der Ermordeten darinnen, den sie doch suchen, da sie den
Körper ohne Kopf gefunden
haben, achtlos vorbei, fragen gerade einmal, wem es gehört.
Am
Schluss wirkt Fink wie ein Kind mit Größenwünschen, das seine Eltern zu
früh verlassen hat, ratlos und klein, nur zufällig gerettet von einem
Großen, Mächtigen. Um ihn herum gibt es nur elterliche Figuren, die ihn an
Macht, Einfluss und Selbstbewusstsein gewaltig überragen. Nein, schon am
Anfang ist er ein Kind, das nicht
weiß, wie ihm geschieht und das unerwartet zu Erfolg gekommen ist, über
das aber Erwachsene unentwegt verfügen. Er glaubt selbst nicht an
seinen Erfolg, vor allem auch nicht an die Urteilskraft der Kritiker und
Zeitungsschreiber, verharrt aber in seinen diffusen, visionären Ideen, vom
sog. einfachen Menschen zu
schreiben und so im Schreiben von Theaterstücken die Welt zu verändern, -
ein sozialismushafter Phantast.
Zum
Schluss wird er noch einmal, diesmal endgültig,
entmündigt: Er darf zwar Theaterstücke schreiben, soviel er will, er
niemals wird eines von ihm aufgeführt werden, und alles, was er noch jemals
produziert, gehört in alle Ewigkeit dem Theaterverlag.
Das
erinnert auch an die Mär von Schriftstellern und Dichtern, die oft nur ein
Gehabe ist, sie hätten befohlen, alle Werke und Aufzeichnungen zu
verbrennen (so angeblich Kafka an Brod, das Aufführungsverbot seiner Dramen
für Österreich durch den österreichischen Schriftsteller Thomas
Bernhard). Er gehört auch als Person ganz und gar dem Verlag und muss sich
in die Unzahl von erfolglosen, nie aufgeführten Theaterstückschreibern
einreihen wie in ein Gräberfeld von lebendig Begrabenen, und zwar im sog. Autorenhaus,
einer ausgedehnten Ansammlung von Kleinstwohnungen mit den Namen der
Schriftsteller und der Hausnummern aneinandergereiht, wie es trostloser
nicht sein kann.
Ihm
soll es nicht anders ergehen, als der unendlichen Reihe schon verbrauchter
Autoren, die im Autorenhaus Tür an Tür (ein Seitenhieb auf die winzigen
Reihenhäuschen auf Kredit) vom Gnadenbrot leben, als Sklaven der theater
company.
Es
wäre zu kurz gegriffen, hier nur einen der vielen üblichen Seitenhiebe auf
die geldgierige, kunstfeindliche, nur
auf Vermarktung ausgerichtete Theater- und Filmindustrie zu vermuten,
wenn diese Zeichnung auch nicht ganz aus der Welt ist, denn jeder, der
einmal publiziert hat, weiß, wie willkürlich Verlage
mit ihm umspringen, mit dem Text, der gekürzt werden muss, auch wenn dabei
viel Blut fließt, aber schon mit der Umschlagsgestaltung, die oft
geschmackloser nicht sein kann („Über den Umschlag bestimmt der Verlag
allein, da können Sie als Autor nicht gehört werden, und erst mal 300
Erstexemplare für den Verlag ohne Honorar, und alle Rechte einschließlich
der Übersetzungen - von denen der Verlag aber keinen Gebrauch machen wird -
auf Ewigkeit für den Verlag“).
Vielmehr
benutzen hier die Autoren Coen eine traurige, weit verbreitete Realität, um
die Kleinheit, das Ausgeliefertsein des Menschen überhaupt darzustellen.
Fink
ist ebenfalls immer wieder kleinmütig zusammengesackt vor den mächtigen
Figuren, die ihn umspielen und die mit ihm spielen, darunter auch schon
gleich zu Anfang den Überredungskünsten ausgebuffter
Geschäftemacher in der Film- und Theaterbranche ausgeliefert.
In
deren Machtbereich wird der einsame Fink schließlich oder von Anfang an
doch eingesaugt und lebendig
eingesargt, ohne dass er bemerkt, wie ihm geschieht, und schon gar nicht
ist daran zu denken, wie er dem Einhalt gebieten kann. Er hat sein Werk
vollendet, darf es aber nicht anwenden, und dies ist so gut, als wenn er es
nie geschrieben hätte. Er ist in die Gemeinschaft der verbrauchten Autoren
exiliert worden und darf im Autorenhaus leben, bis der Tod ihn erlöst.
Gerade
sein Erfindergeist ist ihm zum
Verhängnis geworden, denn dieser ist den routinierten, ignoranten
Mitmenschen, auch wenn sie „branchenkundig“ sind, verhasst, weil
verneidet. Diese spüren ihre Mittelmäßigkeit genau, auch wenn sie in
Verhörtechniken eingeübt sind wie die beiden Polizeiagenten, die hinter
dem Serienmörder her sind.
Diese
bemerken aber nicht, wie nah sie dem Mörder auf den Fersen sind, sondern
tappen dicht neben ihm vorbei, kommen sogar in einem verpatzten
Schusswechsel um, von der Hand des Serienmörders. Die
Schlaumeier sind eben auch nicht schlauer. Dieses Motiv zieht sich durch
den ganzen Film.
In
einem erweiterten Sinne geht es um die Blindheit und den blinden Eifer der
Menschen. Fink erkennt nicht das sozial und traditionell Vorgegebene des Hollywood-Betriebs
mit seinen Flachheiten, seinen billigen Geschäftemachereien und dem
langwährenden Fehlen jeglichen Sinnes für Film- und Theaterkunst und dem
Bestehen auf einem billigen Catcherfilm, wie es schon unzählige gegeben
hat.
Die
Hollywood- Betriebsamen haben keinen Schimmer von Schöpferkraft, sondern
können nur mit einfältigem Hochmut darauf reagieren. Fink wird auf ein
museales Dasein, auf ein Dasein in irgendeinem Archiv, reduziert, wo er sich
mit anderen „Spinnern“ wiederfinden wird.
Es
war ein Irrtum, auch sein eigener, in ihm eine Art mobilen Thinktanks zu
sehen, den man einfach von New York nach Los Angeles verschicken könnte.
Zum
Schluss werden die beiden FBI-Beamte, die Mördermund Charlie fangen sollen,
von Charlie mit seiner schweren, einläufigen Elefantenbüchse
(großkalibrige Wildmunition!) erschossen, unter Charlies Ruf : „Ich bin
der kreative Geist“, „Ich zeige euch den kreativen Geist“, nachdem sie
Charlie aufgefordert hatten, „sich zu zeigen und hervorzukommen“ (so,
wie Faust Mephistopheles beschwört, sich nun zu zeigen“) und seinen
Koffer abzustellen und „schön die Hände hochzuheben“.
Majestätisch
tritt Charlie hinter einer vorausgestoßenen Dampfwolke (eine Reminiszenz an
die Art, wie man seit jeher böse Geister im Theater auftreten ließ,
- der Teufel kommt dampfend direkt aus der Hölle - , mit einem sanften,
aber großen Schritt von seitlich her auf den Flur. Ebenso majestätisch-
würdig ist sein letzter Gang in sein Zimmer in dem lichterloh
brennenden Hotel ganz zum Schluss. Er steht vor seiner Tür und tritt dann
plötzlich ein, wie wenn er sich betrachten lassen wollte, - auf jeden Fall
würdig und völlig unaufgeregt.
Nachdem
Charlie die beiden Beamten erschossen hat, tritt er zu Fink und fragt ihn:
“Was siehst du mich so an?“ Fink antwortet mit seiner Klage und Frage,
warum gerade er es mit einem Serienmörder zu tun haben musste. Darauf
Charlies Antwort: „Weil du mir nie zugehört hast“. Dies klingt so, als
ob Fink die Chance gehabt hat, Charlie von seinem Tötungswahn abzubringen,
ihn davon zu erlösen, - wenn er ihm
nur mal zugehört hätte. Dies erinnert an das offene Ohr, das wir alle für unsere Nächsten und Fernsten haben
sollten. Alle machen etwas verkehrt, ohne es zu merken. Dabei wäre das
Richtige so leicht zu tun gewesen, eine Anspielung nicht nur auf den
Holokaust, sondern nicht weniger auf andere Massenverbrechen. Erst im
Suezkrieg 1956 haben sich zwei englische Piloten geweigert, die zivile Stadt
Suez zu bombardieren. Nach der Bombardierung deutscher Innenstädte hat es
also noch ganze 11 Jahre dazu gebraucht.
Zum
Schluss wird ausgerechnet der Jude Fink von einem großen blonden Hünen,
seinem umgänglichen, jovialen Nachbarn und Serienmörder Charlie gerettet. Dieser drängt mit ungeheurer Anstrengung die schweren
Eisenstäbe auseinander, an die Fink von ihm ganz ähnlich aussehenden
Figuren, also von „seinesgleichen“, gekettet wurde.
Der
Untergang ist fürchterlich. Das
ganze Hotel steht in Flammen. Es widerstrebt mir, darin nur eine Anspielung
auf den Holokaust zu sehen. Der Film will eher zeigen, dass alles Mögliche und Furchtbare jederzeit und überall und in jeder
Person auf Verwirklichung und in jeder Person lauert.
Von
dem Paket, das er von Charlie
erhält und das wahrscheinlich den abgetrennten Kopf der Partnerin des
Dichters Mayhew, Judy, enthält, sagt Fink zum Schuss, dass er nicht wisse,
wem es gehöre, auch nicht, was darinnen sei, auch nicht, woher er es habe.
Auch Charlie bestreitet zum Schluss, das e ihm selbst gehöre. Zuvor hatte
er Fink dieses Paket zum Aufbewahren gegeben, mit der Bemerkung, darin seien
seine Kostbarkeiten, von denen er sich nicht trennen wolle, die er aber
nicht immer mit sich schleppen wolle.
Man
darf auch hier annehmen, dass auch diesem Film, wie in „A Serious Man“
dieser Regisseure, eine tiefliegende religiöse
(nicht religionshafte, etwa christliche, jüdische oder andersartige
Richtung) Auffassung und zugleich eine Anklage
gegen jede Religion und die Figur, die eine Religion verehrt, zugrunde
liegt, ohne die einzelnen Erfindungen in diesen Filmen damit erklären zu
wollen.
Es
ist so, dass die Autoren sagen wollen: „Da
ist noch etwas, was wir nicht verstehen, und wir haben Respekt davor“.
Die Figuren schwimmen alle irgendwie in einer Suppe,
die sie nicht kennen, geschweige denn deren
Strömungen sie voraussehen könnten. Sie werden hineingezogen und in
ihr und auf ihr herumgewirbelt,
dass ihnen Hören und Sehen vergeht, und der Zuschauer wird, will er den Weg
der einzelnen Figuren ernsthaft verfolgen, nicht anders, von Schwindel
befallen.
So
verfällt Fink kurz vor Schluss in ein „never
stop working“ und schreibt so das ganze Theaterstück in einem Zuge
nieder. Das ehrwürdige, harte
Schreibmaschinen-Tasten –Doppelklicken mit dem typischen hart-
metallischen, (wie in Ewigkeit gemeißelt) echohaften (darin schon das Echo
der Zuschauer vorwegnehmend), überaus würdigen Nachklicken
der alten, wundervollen Underwood-Maschine mit den ausgetippten,
plastikeingehüllten, und trotz viel Fingerschweiß noch gut aussehenden,
nur leicht vergilbten, alt gewordenen Buchstaben und dem hellem Klickgeräusch
beim Öffnen des schwarzen Koffers (ein typisches und herrliches, uns an
unsere Reisen, als wir noch jung waren, erinnerndes Koffergeräusch), in dem
sie transportiert wird, ist ein
Genuss, mit dem uns die Regisseure so ganz nebenbei – unverdient, wie
alles, was wir hier erleben dürfen, - beschenken.
An
einer Stelle wird das Innere der
Schreibmaschine vergrößert, - nun sieht
es aus wie ein Amphitheater. Die Buchstaben schlagen nach vorn, auf die
Bühne, auf die halbmondförmige arena. Sie sind es, die das Theater machen.
Das Theater auf der Bühne mag seine
Zuschauer haben, aber hier geht es plötzlich umgekehrt. Die
Bühne muss sich das gefallen lassen, was die Zuschauer produzieren,
also womit sie die Bühne „schlagen“.
Fink soll ja lt. Auftrag ein Drehbuch für einen „Catcher-Film“
schreiben. Wenn Fink dies nicht kann,
soll sich die Schreibmaschine auf ihr Eigenleben besinnen und das Stück
selbst schreiben, indem sie die Buchstaben mit
Hebelwirkung auf das Papier haut. Es muss notfalls eben auch ohne Fink
gehen. Der Auftrag und die
Schreibmaschine haben sich verselbständigt.
Damit
sind wir erst recht beim Thema „Catcher-Film-
Theater, über das doch Fink lt. Auftrag ein Drehbuch schreiben soll.
Die Herren von Hollywood bestehen
eisern darauf, weil sie Bildungsgut
verabscheuen. Charlie, dem Fink seine Schreibhemmung beichtet, um Ideen
dazu zu erhalten, macht daraufhin mit Fink ein kurzes Wrestling (ein Schau-Ringen als Theater, hier allerdings ohne die
übliche Verabredung, wer siegen, wer verlieren soll), nach dem Fink hilflos
wie ein Klammeräffchen auf ihm sitzt und von dem Fink Nackenbeschwerden
davonträgt („tut mir sehr, sehr leid...“).
Charlie
verlässt den Raum und schließt die Tür hinter sich, - dies macht ein geisterhaftes,
schlürfendes oder rauh hauchendes, menschenähnliches Geräusch. Dieses
gehört wieder zu den kleinen, liebenswürdigen Geschenken, die von den
Regisseuren so ganz nebenbei an die Zuschauer verteilt werden.
Aus
der vorherigen Schreibblockade möchte Fink durch die Hilfe des bekannten Schriftstellers Mayhew herausfinden. Wie
Kafka in seinem Roman „Das Schloss“ den Weg zum Schlossherrn sucht,
aber bei einem Schankmädchen landet oder in seinem Roman „der Prozess“
statt bei seinem Anwalt in der Umarmung dessen Sekretärin und Geliebten
„Mizi“, so ergeht es jetzt Fink mit Mayhew. Er kommt nicht an diesen
heran, zumal dieser sich durch seine Alkoholexzesse entzieht. Er muss mit
dessen Sekretärin und Geliebten Judy vorlieb nehmen bzw. sucht
deren erotische und mütterlich stützende Zuwendung. Klappt es mit den
Männern nicht, muss man sich den Frauen dieser Männer zuwenden, um wenigstens über
diese noch einen dünnen Kontakt zu den Männern zu knüpfen und
so doch noch den Mann anzuzapfen.
Hier
stellt sich aber heraus, dass Judy die eigentlich Produktive ist: Sie ist
es, die die Drehbücher des Mayhew geschrieben hat.
Hier
wieder das Thema der unvermuteten
plötzlichen Verwandlung: Aus der Sekretärin eines berühmten Dichter ist
plötzlich die große Autorin selbst geworden, und Mayhew zu einem unproduktiven Alkoholiker, einem bloßen
Aushängeschild.
Fink
gerät in einen schlimmen Zustand der Wut und Enttäuschung, da er sein
Ideal von Mayhew verliert. Nun verachtet er diesen, - wieder ein plötzlicher Wandel ins Gegenteil.
Fink
kommt aus seiner Schreibhemmung erst nach dem erlösenden sexuellen
Zusammensein mit Judy, aber auch deren Ermordung durch Fink selbst
(Lustmord) heraus.
Dass
er sie umgebracht haben muss, entdeckt er erst, als er aus einem tiefen
Schlaf erwacht und in eine Zimmerecke
blickt. Dabei geht ihm auf, dass es sich „eigentlich“ um die
Großumrisse der weiblichen Genitalgegend handelt. Oder besser umgekehrt:
Er sieht eine weibliche Genitalgegend, bis er begreift, dass es sich um eine
Zimmerecke mit einem schwarzen Punkt und den davon abgehenden Linien
handelt.
Dann
hört er ein Insekt summen, das sich auf dem Körper der neben ihm abgewandt
liegenden Judy niederlässt und Blut saugt. Als er dieses totschlägt,
bemerkt er, dass Judy tot ist und am Rücken eine, von ihm selbst
zugefügte, Stichwunde trägt.
Dann
kann er sein Stück in einem Zuge zu Ende schreiben.
Sein
willenloses Sich- Ergeben in diesen sexuellen Akt, der zunächst nur ganz
konventionell mit dem beiderseitigen Abstreifen
des Schuhwerks angedeutet, aber dann gewaltig
vertieft wird in Form eines Waschbeckens, das viel aufnehmen kann (viel
Schmutz, wie vorgesehen), aber erst recht in Form des Abflussloches, das zunächst ganz harmlos einfach das Abflussloch ist,
sich dann aber zu einem riesigen schwarzen Loch, dem schwarzen Loch
eben, erweitert, das alles verschlingt, das heißt den ganzen Fink mit Haut
und Haaren, samt seinen frommen Vorsätzen und seinen
Weltverbesserungsallüren, sodass er dann zum Mörder wird, an der Judy, die
ihm soeben geholfen hat, und diese so zerfleischt., dass selbst seinem
hartgesottener Zimmernachbar Charlie
zuviel wird, - der in seinem Eigenleben ein lang gesuchter Serienmörder ist
( FBI-Beamte: „Charlie heißt überall „Mörder-Mund“ und ist irre
im Kopf, erschießt Leute und schneidet ihnen dann die Köpfe ab“, Charlie
dazu: „Aus Mitleid, weil sie alle so leiden. Ich gebe ihnen Seelenfrieden.
Ich wollte, es täte jemand auch mir.“ „Haben
Sie vielleicht vorher eine Frau gesehen, wir meinen, als der Kopf noch drauf
war, also eine Frau mit Kopf“? )
Beim
Anblick der furchtbar zugerichteten Leiche, muss sogar der hartgesottene
Charlie erbrechen. Dann teilt ihm Charlie seine baldige Abreise mit („Da
ist etwas in der Zentrale
((seinem Gehirn? Oder in einem imaginären Ort, in dem Menschheitsverbrechen
geplant werden?)) in New York (ist Berlin gemeint? Nein, jeder Ort könnte
es sein, war es, wird es sein) nicht
in Ordnung“, verspricht aber, in sein lange Jahre gewohntes
Hotelzimmer zurückzukehren.
Er
wird nun als Serienmörder („Mörder- Mund“ von der Polizei gesucht. Er
hat soeben seinen
Hals-Nasen-Ohrenarzt umgebracht, weil er diesem seine richtige Diagnose
gesagt hatte, aber dafür zehn Dollar bezahlen sollte.
Er
hat auch die Leiche, die Fink hinterlassen hatte, entsorgt und den Kopf der
Frau, luftdicht eingepackt, an Fink übergeben, damit dieser dieses Paket aufheben solle für ihn.
Fink
trägt dieses Paket bis zum
Filmende, d.h. bis zur Begegnung mit der Strandschönheit, mit sich herum
und antwortet wahrheitsgemäß, er wisse nicht, was darinnen sei und wem es
gehöre.
Außerdem
konnte Fink aus dem Nebenzimmer hören, wie eine Frau zu Tode gequält
wurde, aber er - Abwehr des Schrecklichen durch grobe
Verleugnung und Verharmlosung – glaubte, nur die Orgasmusschreie einer
Frau bei Charlie zu hören.
Charlie
kam nach Erlöschen dieser Todesschreie verschwitzt und an seinem rechten
Ohr blutend in Finks Zimmer („Ohrentzündung“). Er verbot nicht ohne
Grund Fink wiederholt, sein Zimmer zu betreten („eine Müllhalde“,
„kann niemanden hereinlassen“). Er gibt an, es handele sich um eine
schon länger bestehende Ohrenkrankheit.
Erst
die Liebe und die Sexualität, in einem fade errungenem, mehr geschenktem
ödipalen Sieg über den schon berühmten, alkoholkranken Schriftsteller
Mayhew, dann der Mord an dessen Frau durch ihn, Fink selbst, - das war
offenbar das richtige Elixier, das
Fink benötigte, um aus seiner Lethargie zu erwachen.
Geistige
Produktivität hält sich nicht an Moral, - das ist das Mindeste, was man dazu sagen kann. Eine teuflische
Mischung von Liebe und Mord ist hingegen das „Richtige“, das zum
genialen Erfolg führt.
Alles
andere hatte nichts genutzt, so Druck von Seiten der Geschäftemacher, Druck
von ihm selbst, finanzielle Notwendigkeiten, - nichts. Nur eine Teufelsmischung hilft, - man kann sich an Faust erinnern,
der sich mit dem Teufel verbindet und verbündet.
Es
muss gebrannt und gemordet werden. Phönix aus der Asche, Genie und Kultur
aus dem Detritus der Menschheit.
Fink
wird als zwangshaft, überaus ängstlich und skrupelhaft gezeigt, eine
Art zweiter Franz Kafka, sowohl im Aussehen als auch in der Schüchternheit
seines Benehmens.
Die
Skrupel vergehen vorübergehend mit der angesehenen und selbst ausgeübten
Grausamkeit, sowie mit der Geschäftemacherei Anderer. Er findet so zu einem
raptus des Schaffens, schreibt
sein Stück ununterbrochen zu Ende, dabei ständig
auch mit den Füßen arbeitend (bereits zuvor sieht man ihn verzweifelt
im Zimmer hin und her laufen. Man
erinnert sich: Vor der Klagemauer und auch beim Lernen beugen die Juden den
ganzen Oberkörper vor und zurück, - eine alte Weisheit, dass man in
Bewegung besser lernt, hierzu s. auch die Peripathetiker,
die Herumgeher, im alten Griechenland), anscheinend ohne Korrekturen und
nicht ohne Abgabesorgfalt, - er schreibt in Großbuchstaben: THE END.
Die
Regisseure/ Autoren vermeiden den Abstieg eines Films in einen bloßen Roman, womöglich noch in einer der üblichen Sozialromane
(Finks Projekt des „einfachen Menschen“)
mit Marketingsaussicht, oder jedenfalls etwa
mit einer durchgehenden, einigermaßen vernünftigen, „plausiblen“
Geschichte.
Dieser
Film macht besonders deutlich, dass Filmkunst ein eigenes Metier ist, - das
auch den Mut aufbringen kann, eine Art „Antistory“
darzustellen, wie sie uns übrigens auch
ständig in den Biographien unserer Patienten begegnet, wenn wir dafür
auch nur etwas offen sind und für das Psychotherapie - Antragsverfahren
(Krill 2008) nicht allzusehr mogeln,
um den Antrag durchzukriegen.
Kein
Geringerer als Freud würde hier seine Freude haben, denn hier handelt es sich ausnahmsweise einmal nicht
um eine der vielen „geglätteten Krankengeschichten“, über die er
sich so verwundert und empört zeigte, weil er das Verlogene daran nicht
mochte.
Wir
mögen es auch nicht, möchten die Regisseure sagen, und, wenn Sie
gestatten, ich mag es auch nicht. Die Schreibhemmung dazu kriegen auch wir
hier geschenkt.
Der
Schluss wirkt wieder,
wie schon öfter gesehen, so in „Burn after Reading“ der gleichen
Autoren, an den Haaren herbeigezogen. Diese Regisseure haben einfach
chronisch Schwierigkeiten, den Schluss aus dem Stück herauswachsen zu
lassen. Bei den Skills in Sachen Film, den die Regisseure vielfach
bewiesen haben, nimmt dies nur auf den ersten Blick Wunder. Tatsächlich
dürfte dies ihrem ungeheuren Einfallsreichtum geschuldet sein. Sie
haben es schwer, diesem Einhalt zu gebieten. Sie möchten und könnten
lieber endlos so weitermachen. Aber bei ca. 120 Minuten muss nun mal Schluss
sein. Längeres würde kein Verleih mehr annehmen. Daher wohl das
künstliche im Ende ihrer Filme. Sie machen ja auch den Schnitt selbst. Das
hat ihnen sicher selbst wehgetan, - hart gegen Andere und grausam gegen sich
selbst. Auch die Suizide sind austauschbar. Sie verschonen sich selbst nicht
davon. Den Nachbarn Charlie haben sie einfach in sein brennendes Zimmer
gehen lassen. Fink lassen sie noch entkommen. Den Fink lieben sie einfach zu
sehr. Und auch, das ist wieder eine Überraschung, die Strandschönheit, die
Fink in seinem Hotelzimmer auf einem eingerahmten Billig- Reisen –Photo
gesehen hat, ist plötzlich wieder da. Inhaltlich entspinnt sich ein
nichtssagender, scheintiefsinniger Dialog, der u.a. , um die mitgeschleppte
Kiste geht, von deren Inhalt und Herkunft Fink, so Fink, nichts weiß, was
ja einfach zutrifft.
Aber
immerhin, auch hier geht es um eine Coensches
Thema: Wie sich an anderen Orten und zu anderen Zeiten das Gleiche
wiederholt, wie geisterhaft, - entweder identisch oder nur leicht
verwandelt. Die gleiche Frau in der gleichen Haltung am Strand wie auf
der Ferienreklame in seinem Hotelzimmer.
So
auch immer wieder antisemitische
Sticheleien: „Fink, - das ist doch ein jüdischer Name, nicht? Dein
kleiner jüdischer Schädel, was Du dir einbildest“. Und Versuche, Fink zu
erniedrigen. Die Polizeibeamten wechseln zum „Du“, geben ihm einen Klaps
wie einem Hund, nachdem sie ihn in dem brennenden Hotel angekettet haben.).
Die
Autoren sind zum Glück weit davon entfernt, den gleichen Respekt, den sie
dem Zuschauer zollen, von Anderen zu fordern. Sie wollen niemanden bekehren.
Der
Film ist kaum zu fassen, wie das Leben und das Universum. Es wäre daher
auch ganz verkehrt, in den Film eine (jeweils
die unsrige) Ordnung hineinbringen zu
wollen. Die Regisseure wollen zeigen, wie chaotisch die Welt und die Menschen sind, und sie stellen sich daher
quer.
Ein
für Rezensenten („Er
ist ein Rezensent, schlagt ihn tot“) ausgesprochen
sperriges Stück, wie später in „A serious man“. Das Leben ist eben keine glatte Krankengeschichte.
Dr.
med. Manfred Krill, Arzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychoanalyse
(DPV, IPV,FPI, IPAA)
Bücher
|
Das Gutachterverfahren für tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie Verlag: Psychosozialverlag, Gießen ISBN: 978-3- 89806-773-7
|
|
Ödipus' Ende, Sophokles (497/96-406 v. Chr.) Verlag: Peter Lang, Frankfurt ISBN: 978-3-631-61407-5
|
|
Klassische Psychoanalytische Kompromisstheorie Verlag: Dr. Krill Verlag, Königstein ISBN: 978-3-9815177-1-2
|
|
Sophokles Ödipus in Kolonos Drehbuch von Manfred Krill Verlag: Dr. Manfred Krill Verlag, Königstein ISBN: 978-3-9815177-0-5
|
|
Anorexia nervosa und Aggression Neue Psychodynamik nach der Klassischen Kompromisstheorie Verlag: Dr. Manfred Krill Verlag, Königstein ISBN: 978-3-9815177-0-5
|
|
Klassische
Psychoanalytische Kompromisstheorie und ihre Auswirkungen und
Nichtauswirkungen auf Psychoanalytiker, Patienten und Gesellschaft
Symptombildung als Kompromiss ISBN 978-3-9815177-5-0
Gruppenanalyse Neu, 158 Seiten, Preis 56 Euro gegen Vorauskasse Verlag: Dr. Manfred Krill Verlag, Königstein ISBN
978-3-9815177-6-7
Neue
Traumatheorie Das Schicksal der spontanen Traumafolgen: Einkapselung, Patinabildung,
Innere Auszehrung (Tafonisierung), aktive Zertrümmerung, Erosion,
einfacher Zerfall, spontane oder aktive Auflösung, Assimilation,
Ausscheidung? Das Schicksal der Traumaanalyse. von Manfred Krill
The
rehabilitation of movement-disturbed patients What
can modern psychoanalysis contribute to it? von
Manfred Krill ISBN 978-3-9815177-7-4
Dr. Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse (ISBN
978-3-9815177), D-61462 Königstein
Как
работает
психоанализ
в
групповом
анализе? von Manfred Krill ISBN
978-3-9815177-8-1 Dr.
Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse (ISBN 978-3-9815177) D-61462 Königstein im Taunus
Analyse durch Freud Die Sitzungsprotokolle Ernst Blums 1922 - psychoanalytisch neu gelesen Lehranalyse, Ausbildungsanalyse, Selbsterfahrung: Wirklich unentbehrlich? Wirklich keine rechtlichen Bedenken? von Manfred Krill ISBN 978-3-9818213-2-1 Dr.
Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse (ISBN 978-3-9815177) D-61462 Königstein im Taunus
Krill, Manfred / Tuin, Inka: (2018)Gestörter Schlaf und Schlaflosigkeit , in Krovoza, Alfred / Walde, Christine: (2018) Traum und Schlaf, ein interdisziplinäres Handbuch , 316- 329, J.B. Metzler Stuttgart, imprint Springer Verlag, Springer Nature ISBN 978-3-476-02486-2
Friedrich Hölderlin (1770-1843) Eine Pathographie ISBN 978-3-9818213-2-1
Karl May (1842-1912) ISBN 978-3-9818213-5-2
Letter to Japan Psychoanalytic Society
|