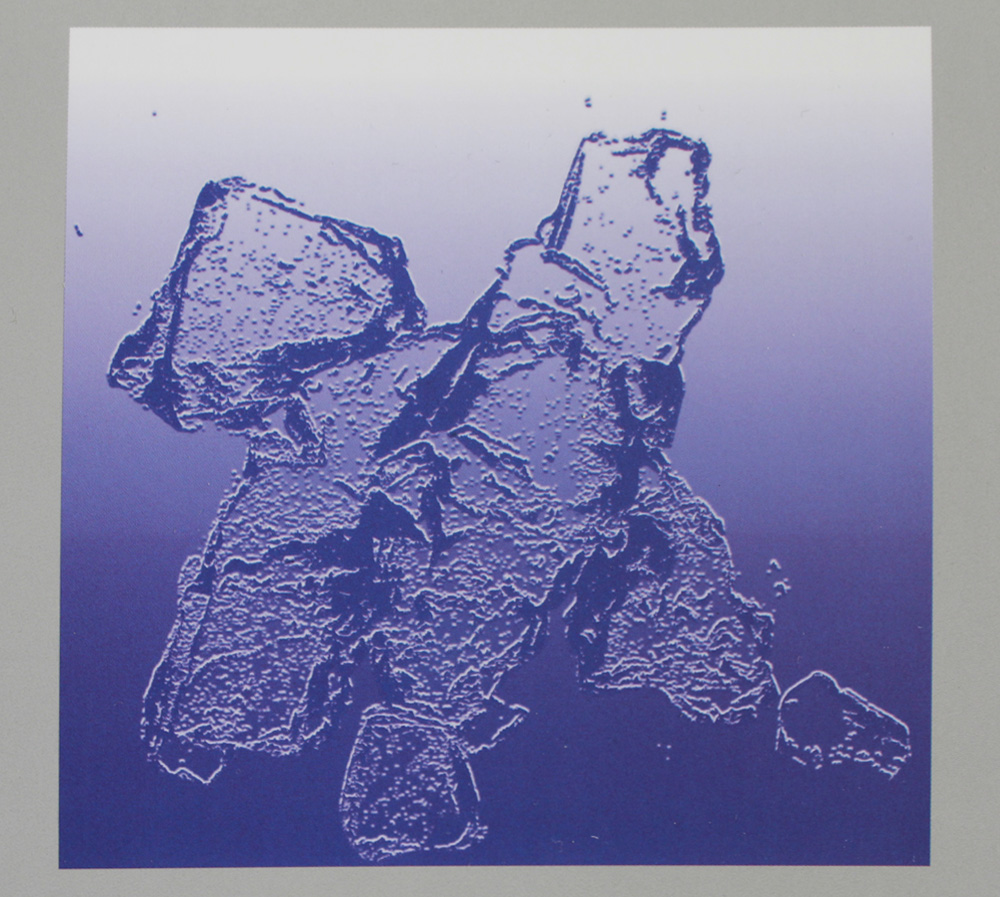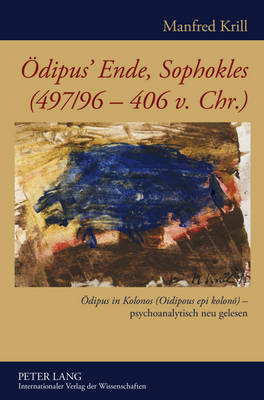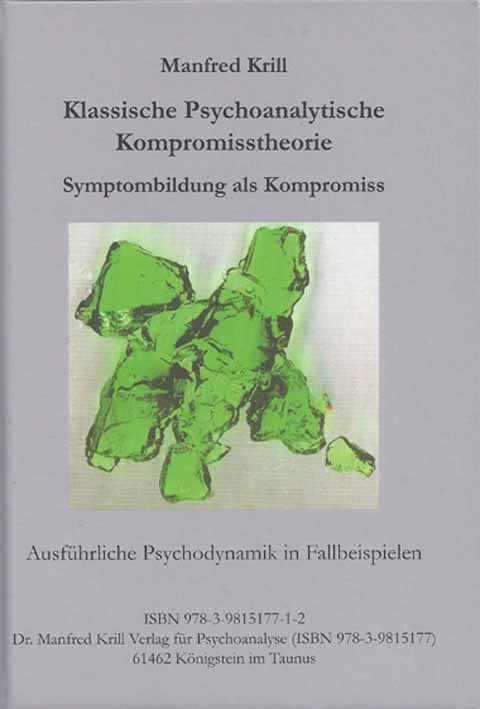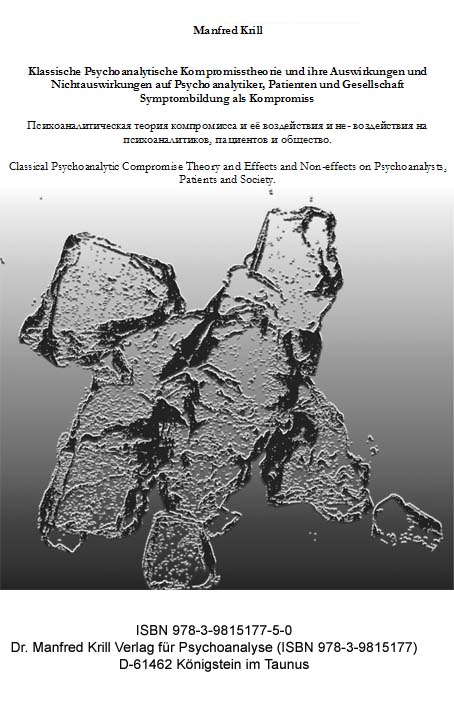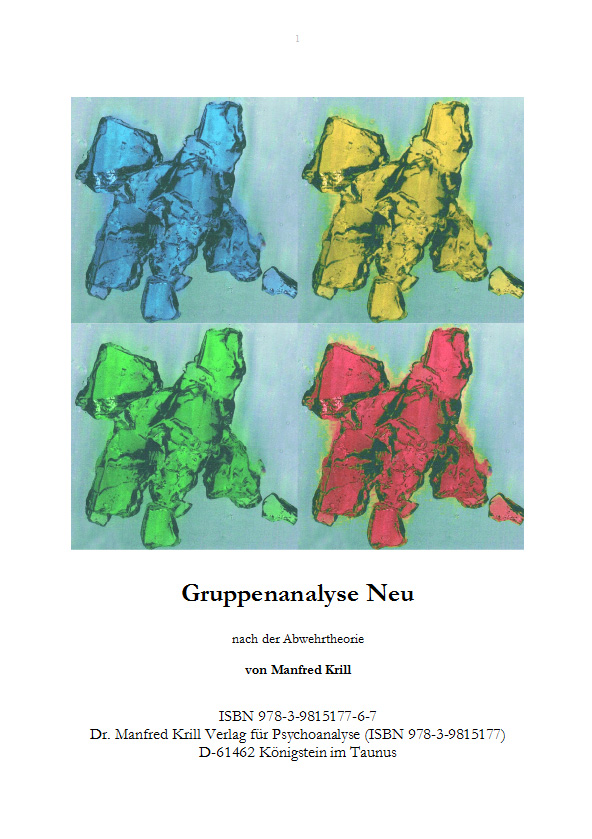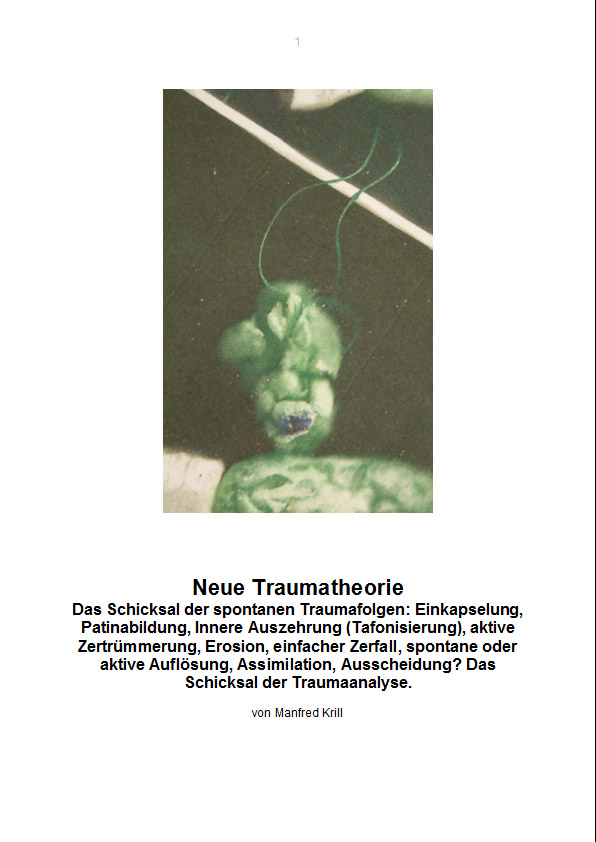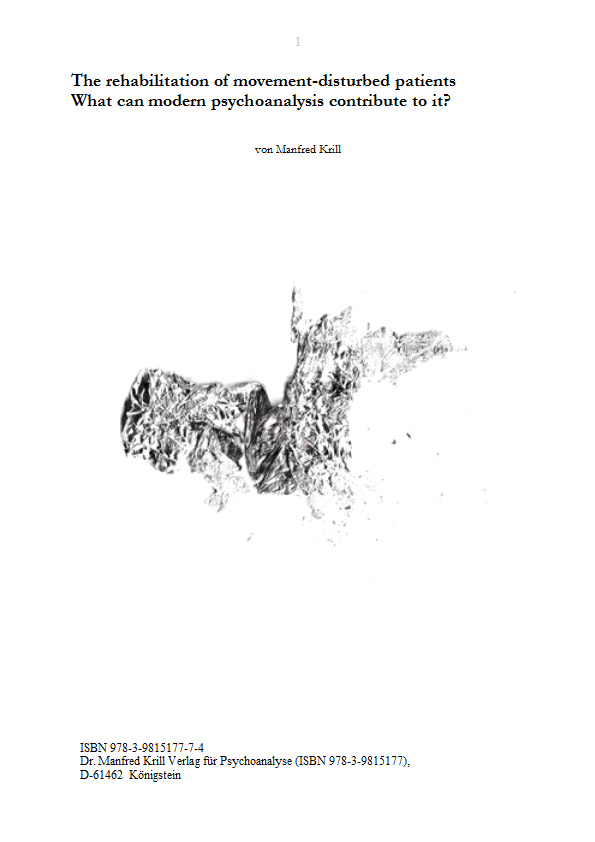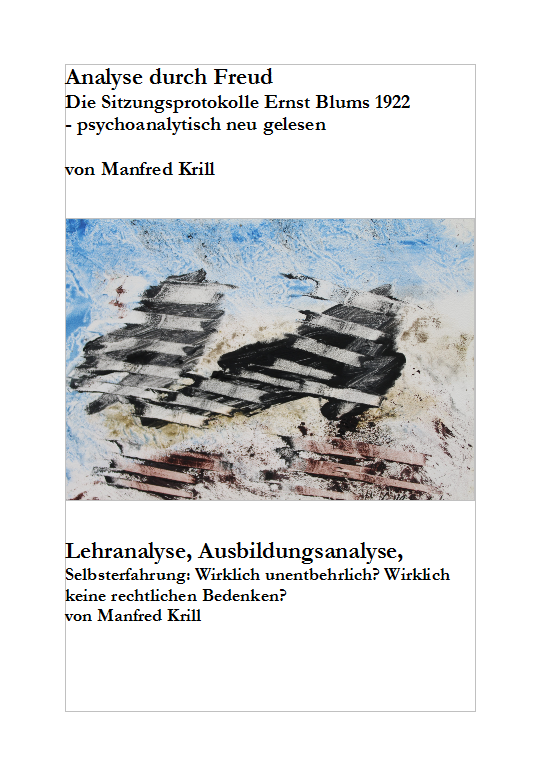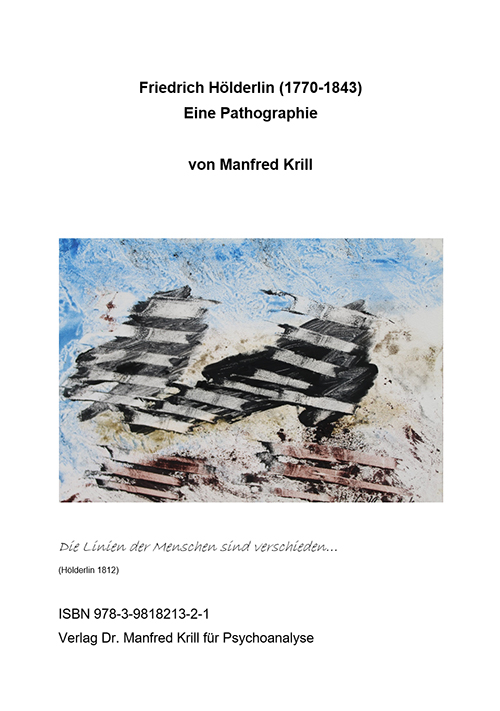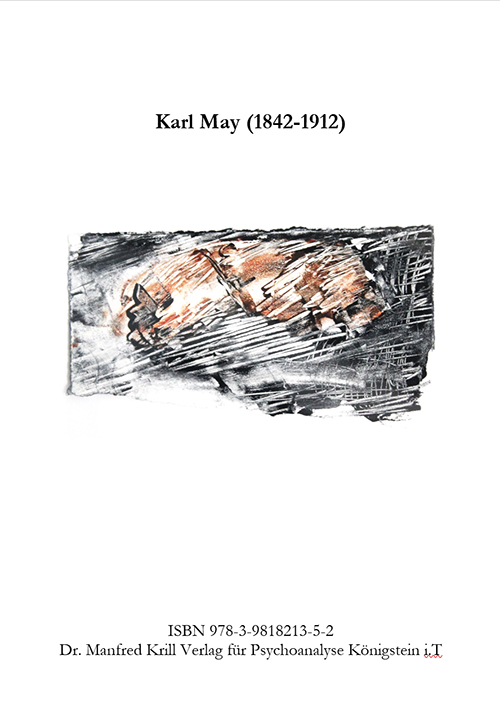Rezension
Dr.
phil. Jörg M. Scharff
Die
leibliche Dimension in der Psychoanalyse,
Brandes
& Apsel, 1. Auflage, 2010, 205 Seiten
von
Manfred Krill
ISBN 978-3-9815177-7-4
Dr. Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse
(ISBN 978-3-9815177)
D-61462 Königstein im Taunus
http://www.drkrillverlag.de
Impressum
Bibliografische
Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die
Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie;
detaillierte
bibliografische Daten sind im Internet über <http:/ dnb.ddb.de>
abrufbar.
Originalausgabe
Buch,
ungebunden
(C)
2014 Dr. Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse, Hainerbergweg 53, D-61462
Königstein
Satz
und Druck: Dr. Manfred Krill (Autor), Königstein
Schrift:
Arial
Das
Urheberrecht: liegt ausschließlich bei Dr. Manfred Krill. Alle Rechte sind
vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch
Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung
des Verlages reproduziert, übersetzt oder unter Verwendung elektronischer
Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Autor
und Verlag übernehmen keine Verantwortung und keine Haftung, die auf
irgendeine Weise aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen
oder Teilen davon entstehen könnten. Geschützte Warennamen oder
Warenzeichen werden nicht besonders gekennzeichnet. Hieraus kann nicht
geschlossen werden, dass es sich um freie Warennamen handelt. Ähnlichkeiten
mit Personen sind rein zufällig. Keine der Krankengeschichten hat reale
Personen zum Inhalt. Bei der Bewertung von Zitaten von Autoren und sonstigen
Personen sind nicht diese Autoren oder Personen persönlich gemeint, sondern
nur deren vermutliche Meinungen, Thesen, Behauptungen und sonstige Aussagen.
Printed
in Germany, 1. Auflage
ISBN
978-3-9815177-7- 4
Verlag ISBN 978-3-9815177 Dr.Manfred
Krill Verlag für Psychoanalyse, Königstein
Rezension
Dr.
phil. Jörg M. Scharff:
Die
leibliche Dimension in der Psychoanalyse
Brandes & Apsel, 1. Auflage, 2010, 205 Seiten
Mit
Analytiker, Therapeut, Arzt, Patient und Analoga ist nicht das Geschlecht
gemeint, sondern die Funktion. Wiederholungen gemäß den Wiederholungen im
Text sind beabsichtigt.
Wichtige
Stichwörter:
Leiblicher
Austausch, auch unter Analytikern in der Gruppe, „Zwischenleiblichkeit“,
„Leiblichkeit“ auch im Umgang der Analytiker miteinander in Seminaren,
Regression vs. Erwachsenenstatus und Progression, Antizipation,
Kindheitsthese, Infantilimorphismus (genetic fallacy) mit der üblichen
Detailverliebtheit, Abwehranalyse, Intellektualisierungen, Schneiderwitz,
scholastische Denkweise, Isolierungen, suggestive Manipulation, verdeckte
Fehlschlüsse, der „Dritte“, Durchbezahlen, Auftrag, „Psychose“,
Ignoranz, Desinteresse, Neglect, Couch, Imitation, Compliance, Soziologie,
Philosophie, „Räume“, Performance, Fairbairn, Melanie Klein, Bion,
Werner, Shapiro, Gray, Kernberg, Fonagy, Krill, Bollas, Rhode-Dachser,
Stern, Altmeyer, Dornes, Braten, The Boston Change Study Group,
Fallbeispiele, Phobie der Analytiker vor der Erwachsenen-Sexualität und -
Aggressivität, verkappter Antifeminismus, Dramatisierung, topographisches
Modell vs. Strukturmodell, unanalysierter
„Beifang“, Achtsamkeit, Behutsamkeit, Bruxismus. Gefühl der Schwere
des Erwachsenenkörpers vs. dem „kinderleichten“ (sic!) Körpergefühl.
Der
Autor hat die Tür zu einem wenig bearbeitetem Feld weiter geöffnet.
Die
theoretischen Ausführungen und Falldarstellungen sind sehr detailliert ausgeführt. Auch die Sprache
ist auf hohem Niveau, vermeidet
Sensationshaftes, ist angenehm zurückhaltend, was bei der auch lebhaften
und leibhaften Beteiligung nicht selbstverständlich ist, und nirgendwo behäbig.
Allerdings ist sie nicht frei von Intellektualisierungen und verschraubtem
Stil, zu dem freilich der komplizierte Gegenstand verleiten kann, so, wenn
es auf S 11 heißt:
„Angesichts
der in der Theorie schier unbegrenzten Möglichkeiten, ein jeweils
Unbewusstes zu deuten, gibt uns die sorgfältige Wahrnehmung sinnlicher
Details eine Feinjustierung an die Hand, die das Fragen des Analytikers im
orientierenden Rahmen eines sinnlich konfigurierten Erlebnisraumes ansetzen
lässt.“
Der
Autor möchte wohl schlicht sagen, dass analytische Deutungen durch das
Achten auf körperliche Wahrnehmungen gestützt und ergänzt werden können
besser noch von Anfang an eine Einheit bilden, und dass leibliche
Erlebnisse beider Teilnehmer bereits unbewusst im Dialog miteinander stehen,
dies schon in der leiblichen Dimension der Sprache („.. das leibliche
im Sprechen,...die nonverbalen Dimensionen im Sprechen wie Klang, Rhythmus
und Melodik..), dann aber ebenso außersprachlich:„..leibliche
Dimension in der Interaktion zwischen Patient und Analytiker analytisch zu
erfassen...Interagieren zweier verkörperter Subjekte... unbewusste
Verstrickung im Sinne des Handlungsdialogs (Klüwer 1983)...
Geschehenslogik.. interaktiv-dialektische Inszenierung, performativer Überschuss
(Küchenhoff 2007).. Performanz (Pflichthofer 2008, a, b, Dankwardt 2006) u.
a. (S 104- 105))
Der
performative Überschuss dürfte
auf die Alleinherrschaft der körperlichen
Performanz in der Evolution vor Entwicklung der Sprache zurückgehen
(Verf. hier). Man konnte sich allein
über den Körper ausdrücken (Verf. hier). Die heutige Gebärdensprache bei Gehör (-und Sprachlosen) zeigt, über welche Möglichkeiten
nonverbaler Verständigung wir noch heute verfügen (Verf.hier). Die Sprache
ist heute immer noch entbehrlich. „Jede intime Erfahrung wie der
analytische Prozess ist auch eine physische, die als nah, haltend,
containend, abgestimmt, gebunden erlebt wird.“(frei zitiert von S 107).
Vor
dem Sprechen steht der Körperkontakt, besonders der visuelle, besonders
durch Mimik, Bewegungen des Körpers, Kleidung, aber auch der akustische
(wie kommt ein Patient die Treppe herauf? Wie klingelt er? Zaghaft? Drängend?
Mehrfach? Kurz, lang?), der olfaktorische, taktile Kontakt, so beim Händegeben.
Nicht
erklärt ist hiermit die unbegreifliche
Begeisterung, entdeckt zu haben, dass ein Wort selbst die Handlung ausdrückt
und somit performativ ist. Ein
Beispiel ist die Taufe. Mit dem Spruch „Ich taufe dich hiermit...“ ist
tatsächlich die Taufe vollzogen, und aus dem Heiden ist ein Christ geworden
(Verf. hier). Na und? Was soll an diesen alltäglichen Vorgang so wichtig
sein? Die Begeisterung für
Performativität erinnert an die naive Begeisterung, die Reime hervorrufen.
Reime wirken ebenfalls sehr suggestiv, nicht nur auf Kinder. Man ist mit
Reimung allgemein vom tiefen Wahrheitsgehalt überzeugt, auch wenn es
inhaltlich noch so unsinnig oder banal ist („Nimm es wie die Sonnenuhr, zähl
die heitren Stunden nur“, „ Punk sei Dank!“, „Kopf kühl, Füße
warm, macht den besten Doktor arm“. „An apple a day keeps the doctor
away“. „Eben schließt in aller Ruh, Lämpel seine Kirche zu“ „Also
lautet ein Beschluss, dass der Mensch `was lernen muss“). Es ist rational
nicht verständlich, warum Soziologen und Analytiker so entzückt sind von Performativität. Der tiefere Grund dürfte darin
liegen, dass Ratlosigkeit herrscht und man daher bereit ist, nach jedem
Strohhalm zu greifen.
Zudem
wird „Performativität“ immer wieder in einen „Zwangs-Zusammenhang“ (Verf. hier) mit Regression, Infantilität und namentlich infantile Sexualität
gebracht, ohne dass hierzu ein Grund besteht.
Auch
die Liegesituation begünstige, so der Autor, das Auftauchen
eines archaischen Körpererlebnisses (Leikert 2008b), nach Fonagy &
Target frühe sinnliche Erfahrungen mit dem mütterlichen, unterstützend
-haltgebenden back-ground-object.(Grotstein 1980, alle vom Autor zitiert).
Weiteres zum Thema Analyse im Liegen auf der Couch s.u.
Der
Autor zitiert auch Alfred Lorenzer
(1981): „..hat...die Spuren der sinnlichen Interaktion mit den Primärobjekten
aufgegriffen // (Verf.) und die
Psychoanalyse als eine Hermeneutik des Leibes entfaltet“.
Der
Autor bemerkt nicht, dass sich der erste Teil des Satzes auf einen (früheren)
Zeitraum bezieht, der zweite Teil auf den Leib, und dass Lorenzer hier keine Disziplin hält. Die beiden Gesichtspunkte
werden miteinander vermengt. „Primärobjekte“ und Leib werden in einem
Atemzug (ebenfalls eine wohlbekannte, suggestive, Einfluss heischende Leib-
Sensation und körperliche Handlung !) genannt und somit als unbedingt
zusammengehörig suggeriert, ohne dies deutlich zu sagen. Dies ist ein bekannter Trick, rhetorisch- sophistisch, ein verdeckter Fehlschluss, üblich auch in der Politik, mit dem
Ziel, dass der Zuhörer / Leser
selbst (!) eine falsche Verknüpfung herstellt und auch aus diesem
Grunde nicht bemerken kann, wie er
manipuliert worden ist, sondern fest an sie glaubt, - eben weil er
selbst darauf gekommen ist.
Dies
zeigt, mit welchen Mitteln hier
gearbeitet wird, um Meinungen an den Mann zu bringen.
Auch
der Autor bemerkt nicht (wie schon Lorenzer nicht) die Willkür, wenn er einseitig die Primärobjekte erwähnt. Es mag
sein, dass es in der Kindheit so war, aber ist ein Baum das gleiche wie sein
Samen, und laufen in ihm die gleichen Vorgänge ab wie im Sprößling, und
wird der Baum bei Krankheit wie sein Samen behandelt („genetic fallacy“,
Shapiro 1982, Werner 1940: „constancy fallacy“) ? Was ist mit späteren
Objekten wie Freunden, Partnern? Ist man zu bequem, sich mit späteren
Entwicklungen zu befassen? Die ständige Verknüpfung mit der frühen
Kindheit kommt einer Stimmungsmache nahe.
Auch
die zitierte Aussage des Boston
Change Study Group (2008 a, S 566, im Buch S 110),.. „dass die körperliche
Choreographie sich in die sprachliche Dimension hinein verlängert.. die
sprachliche Kinetik hat ihr Fundament in der körperlichen und in der
interaktiven Bewegung mit anderen“ und seiner Zusammenfassung als
„Embodiment“ ist ja nicht zu bemängeln, - aber woraus
soll hervorgehen, dass die Choreographie immer eine infantile bleiben
und sein soll?
Darüber
fehlt es an Reflektion. Der Gedanke, dass sich
auch die infantile Leibbezogenheit zu einer jugendlichen und erwachsenen
weiterentwickelt (Verf. hier),
ist nicht aufgekommen. Statt dessen soll das Motto gelten: „Einmal Kindheit, immer Kindheit“. Renik, O (1999a mündliche
Mitteilung) hat Recht, wenn er hier Sentimentalität
und Romantisierung vermutet. Wir alle verklären ja die Kindheit und
Jugend, spätestens, wenn wir im Alter dazu Zeit haben, und dazu müssen wir
nicht einmal Analytiker sein.
Ein
weiteres Motiv ist Bequemlichkeit. Es ist doch so einfach und naiv- eingängig,
alles auf die „Wurzel“ zurückzuführen und psychotherapeutische
Behandlung als „Wurzelbehandlung“,
„Erneuerung von Grund auf“, Krill 2008)) aufzufassen und sich dabei
vor allem auch im Einklang mit
der psychoanalytischen Gemeinde (Krill 2008) zu wissen.
Das
Gleiche gilt für die Formulierungen Anderer, zitiert auf
den Seiten 110-111. („..sensomotorisch- affektive Erfahrungen.. durch
unseren Leib bewohnen wir unsere Welt...die Bedeutung einer Situation wird
handelnd hergestellt.. ist der Körper der Grund-Referent für die
Konstruktionen der Welt in uns ..
“) , Dantlgraber (2008): „Affekthören, Hörassoziationen“. .
Was
soll dies alles mit der frühen Kindheit zu tun haben? Nur weil dies schon in der frühesten Kindheit
erfahren wurde? Soll es keine derartigen Erfahrungen später mehr geben? Wie
steht es mit der Erektion und Ejakulation, nur um ein Beispiel zu nennen,
wie mit einem Orgasmus? Alles Kindheit? Was geht in einem Motorradfahrer, in
einem Piloten, in einem Arzt oder Anwalt vor? Nur Kindliches? Was geht in
einem Patienten vor, der wegen seiner Eheprobleme kommt? Geht es wirklich um
die Mutti und seine Gefühle für sie? Soll wirklich auch der Analytiker nur
aus seiner Kindheit bestehen? Die Verliebtheit
in die – tatsächliche oder auch nur vermeintliche - Kindheit
mitsamt der Verliebtheit in Details
treibt trotz deren enormen Verdrehungen durch nachträgliche Bearbeitungen,
durch Abwehr (Krill 2008, 25 ff), aber auch durch eine Kleinianische
Nomenklatur, die genau zu wissen glaubt, was sich in einem Säugling
abspielt, seltsame Blüten, und Psychoanalyse ist doch die letzte Rettung
vor einfältiger Gleichsetzung.
Wozu
hat Freud eine Abwehrlehre, den entscheidenden Schritt vom topographischen
Modell weg, entwickelt? Soll es in der Psychoanalyse keine Evolution gegeben
haben?
Wenn
auch gewiss Abwehr eine vereinfachte Version eines weit komplexeren Vorgangs
ist, so bleibt sie in unserem, uns nicht bewussten, mehr oder weniger
automatisch arbeitenden inneren Netzwerk, namentlich in der
Konfliktpsychologie der Psychoanalyse unentbehrlich.
Soll
das „Erschaffen neuer Wirklichkeiten, die erlebt werden müssen“ (Pflichthofer 2008b, 38 zit. vom Autor),
die „Hervorbringung...nicht nur das Verlauten zuvor existenter
Begebenheiten“ (Autor, S 129)
sich nur auf die Kindheit beziehen dürfen?
Hier
wird die Einseitigkeit des Autors (und
der von ihm Zitierten) deutlich, immer
nur an „frühe“ Erlebnisse zu denken,
wenn es um körperliche Erfahrungen geht. Sollen Erwachsene oder Jugendliche keine solchen
Erfahrungen gemacht haben und nicht noch entwickeln? Wollte man dem Autor
folgen, hätten Erwachsene keinen erwachsenen Leib.
Argumentativ
kann der Leib nicht dafür herhalten, Mutter-Kind-Erlebnisse als
alleinbeherrschend auch im Erwachsenen aufzufassen.
Soll die
Liegeposition des Patienten nur an Erfahrungen mit der Mutter erinnern dürfen?
Soll ein Patient nicht auch zu neuen körperlichen Erfahrungen finden können?
Im Gegenteil: Erwachsene fühlen
sich körperlich als Erwachsene, nicht als Kinder, nicht einmal als
Jugendliche. Sie weigern sich nicht nur, wieder zu Kindern zu werden, nein, sie könnten
dies auch gar nicht.
Welches
Motiv
sollte ein erwachsener Patient haben, sich bei neuen körperlichen
Erlebnissen wie die, auf einer Analyse- Couch zu liegen und hinter sich
einen Analytiker atmen und rascheln zu hören, vorwiegend oder gar ausschließlich
mit kindlichen oder gar frühkindlichen Erlebnissen zu verknüpfen? Keines. Nur der Analytiker
mit seiner Annahme, dass sich alles aus der Kindheit herleite, hat ein solches
Motiv.- Unzählige Male hat sich jeder Patient allein oder mit Anderen abends
ins Bett gelegt, - warum soll er sich da jedes Mal an seine Position im
Kinderbettchen mit der Mutter nebendran, oder als an ihrer Brust liegend,
erinnert und sich so wieder gefühlt haben? Dazu hatte er keinen Anlass. Er
ist ja erwachsen und hat jetzt andere Interessen. Und seine Mutter ist schon
längst nicht mehr dabei, stattdessen vielleicht eine Partnerin oder niemand
oder der Wunsch nach einer Partnerin, nach eigenen Kindern. Will der
Erwachsene wirklich noch eine mütterliche Figur dabei haben, auch nur in
Gedanken? Er hat längst eine Autonomie auch im Schlafverhalten und in
seiner Phantasiewelt, auch in der Art seiner Konflikte, erreicht.
M.a.W.:
An der Leiblichkeit des Zu-Bett-gehens ist nicht zu zweifeln, auch nicht an
der Reziprozität der leiblichen – seelischen Empfindungen (schon bei Griechen und Römern ist der Genitivus
subiectivus und der Genitivus obiectivus gleichlautend (desiderium patris:
Sehnsucht des Vaters, Sehnsucht nach dem Vater, was darauf hinweist, dass
die Gefühle immer wechselseitig hin
und her laufen und dies in der Antike so selbstverständlich war wie die
Alltagssprache selbst), wohl aber
daran, dass diese Leiblichkeit unbedingt „ein mütterliches, unterstützend-haltgebendes
back-ground-object“ (S 107) einschließen muss. Auch Erwachsene gehen ins
Bett, manchmal auch zu zweit oder zu dritt, - eine Vorstellung, die
manchen abhanden gekommen zu sein scheint, sie setzen sich sogar in
Flugzeuge, trinken und essen schlimme Sachen, gebrauchen schlechte und gute
Worte, fahren Auto (immer mit Mutti?), studieren, arbeiten, diskutieren,
schwitzen, frieren, werden müde, werden wach, verspüren Hunger und
Sattheit und Kopfschmerzen, reiben sich die Augen, husten, schlucken,
rauchen, vermeiden das Rauchen, lutschen statt dessen ein Bonbon, haben
Suhlgang, lassen Wasser, halten beides auch zurück, spucken, erbrechen,
niesen. Frauen haben die Periode,
werden schwanger, haben Heißhunger und Erbrechen, Andere verspüren
Juckreiz, kratzen sich.
Alles
frühkindliche Leiblichkeit? Nur, weil sie solches auch schon als Säuglinge
erlebten?
Durch
sein einseitiges Haften an „Regression“ hat sich der Autor selbst unnötig
in seinen Denkmöglichkeiten eingeschränkt.
Dasselbe
gilt sinngemäß auch für andere körperliche
Äußerungen beider erwachsenen Teilnehmer. Warum sollen diese kindlichen
und frühkindlichen Ursprungs sein? Händegeben? Räuspern? Atmen?
Sprechen? Augenbrauenhochziehen? Augenschließen? Rascheln? Blicken? Hören?
Riechen? Schnüffeln? Haben Erwachsene kein Recht auf Erwachsensein,
namentlich nicht beim Händegeben, Händeschütteln, Autofahren? Der Erwachsene ist und bleibt ein Kleinkind, so soll es sein. Der
Erwachsene wird in eine (seine?) Kindheit geschubst. Die falschen Vorgaben (auch
die Ausbildung, das Gutachterverfahren und das Kongresswesen)
erzwingen dies, geben zumindest diese Richtung vor. Dem einzelnen Analytiker
bleibt es unbenommen, davon wegzukommen, aber er wird erhebliche innere
und äußere Mühe damit haben.
Die
VT behandelt einen Erwachsenen nicht als Kind. Hat sie auch deshalb so gute
Erfolge? Wenn wir Erwachsene als Erwachsene behandeln, können wir uns
durchaus sehen lassen.
Als
Fall-Beispiel verwendet der Autor ein Zitat von Fonagy
und Target (2007a, 431): Der Patient erinnert sich an sein Weggehen nach
der ersten Stunde seiner vorherigen Analyse. Dabei war es ihm vorgekommen,
„als ob er mit seinen Zehen die Oberfläche eines jeden Steins abtasten
und von diesem wie erwartet würde.
M.
E. hat sich der Patient in der ersten Stunde noch nicht sicher gefühlt und
suchte nun woanders Sicherheit in Form von körperlichen Empfindungen, und
gleichzeitig trampelte aus Wut er auf dem steinharten Analytiker herum, -
verschoben auf die Steine, - keine Spur von Regression, sondern
(aggressives) Erwachsenenverhalten.
In
der nächsten Analysestunde sagte der Patient, er habe sich dabei „wie ein
Baby gefühlt, das vom Storch im Windeltuch getragen“ würde. Der
Analytiker wies dies, und in eine tangentiale Antwort ausweichend (Abwehr
durch Verschiebung des Themas Aggression gegen den Analytiker) - zurück mit
den Worten, er könne den Patienten aber nicht tragen.
Nach
Ansicht des Autors hat er den Patienten nicht verstanden und keine Resonanz
gezeigt.
Nicht
gedacht wird an die Möglichkeit, dass der Analytiker hier - richtig - eine
Verunsicherung des Patienten nach der ersten Stunde gefühlt und angenommen
hat, aber in der „Deutung“ durch den Patienten eine bloße compliance
des Patienten gefühlt und erkannt hat. mit dessen Wunsch, sich zu
unterwerfen und das zu sagen, was der Analytiker vermutlich gern hören würde
(s. Sampson & Weiss, Weiss, Mount-Zion-Gruppe 1977-82).
Ist
ja zu schön, der Storch... Das erinnert mich an einen erwachsenen
Patienten, der immer „Lokolade“ statt Schokolade sagte. Dies ist ein
Beispiel, wie grob ein Analytiker einen Patienten missverstehen kann, wenn
er nicht bemerkt, wie theoriegeleitet („Regression“, „frühe
Kindheit“, Infantilisierung der Patienten) er ist.
Der
Behandler hatte nicht dieses Brett vor dem Kopf, ihm wird dies aber
angekreidet, - als fehlende Resonanz, was soviel heißen soll wie fehlende
Empathie. Hier wird ein weiterer Brauch unter Analytikern sichtbar: Wenn ein
anderer Analytiker die Stunde anders versteht, werden ihm rundheraus der
Sachverstand und die Einfühlung abgesprochen, die der Beurteiler für sich
gepachtet haben will. Analyse ist nur das, was der Beurteiler selbst macht.
In
einem anderen Fallbeispiel für die o.a. Phobie vieler Analytiker vor der Erwachsenensexualität (wie
auf S 12, jetzt S140 ff, zit von Stoller 1986) „bietet eine Patientin den
Ansatz ihrer Brüste dar, in einem flott geschnittenen Oberteil“. Der
Autor (Stoller) berichtet, er habe dabei „eine noch nie erlebte Angst“
entwickelt, beteuert, diese Geste der Patientin habe keine „Borderline-
Qualität“ gehabt, er habe eine „Art Todesgefahr für sich und die
Patientin“ empfunden, es habe „das vage Gefühl der Gegenwart eines
Dritten gegeben, der feindselig triumphiert hätte, wenn alles zusammengestürzt
wäre... Dass ich mich vom Gestus der Patientin nicht einfach durch den
rettenden Sprung in eine begriffliche Festschreibung (aha, da ist sie
wieder, die Intellektualisierung, die Berufskrankheit vieler Analytiker,
sowie das Retten, Anm. d. Verf.).zu distanzieren versuchte..., sondern mich
auf die Intensität meiner körperlichen Gegenübertragungen einließ“. Oh
my god, was hat der Analytiker (Stoller)
hier für ein Glück gehabt, dass er mit dem Leben davongekommen ist,
mit einem rettenden Sprung. Was ist doch eine attraktive Frau für ein
teuflisches Ding, sie bringt jeden in Todesgefahr. Ein
Schelm, wer hier an Misogynie, etwa an Otto Weininger, denkt. Und nicht
auszudenken, wenn ein Dritter zugeschaut hätte. Und wie würde es ihm erst
ergehen, wenn er mehr zu sehen bekommen hätte. Und beinahe wäre es ein
„Borderline“ gewesen, - der Versuchung, Sexualität in das Reich
schwerer Krankheiten outzusourcen, hat Stoller noch gerade widerstanden. Früher
musste der Teufel dafür herhalten. Hier wird deutlich, wer der Gesündere
von beiden ist. Das Bedenklichste an solchen Fallauffassungen ist aber, dass
niemand Einspruch einlegt, sondern es bei frommen Zitaten bleibt.
Von
Abwehr der sexuellen Gegenübertragung,
hier in Form von Intellektualisierung und Isolierung (von sexueller
Erregung), Wendung gegen die eigene Person (Angst zur Selbstbestrafung für
die schönen sexuellen Phantasien), Vermeidung (das Thema zur Sprache zu
bringen) und Verleugnung (des provozierenden Sich-zur-Schaustellens der
Patientin) keine Rede ! Die Abwehr hat Stoller hier einfach weggelassen, bis
zu einem grotesken Neglect.
Hoch
ist der Autor Stoller immerhin dafür zu preisen, dass er das Zeigen der Brüsteansätze und die dadurch hervorgerufene
Gegenübertragung nicht der Kindheit
zuweist.
Auch
in der Couch nur den „durch die primären Objekte gegebenen
Halt“ zu sehen (S 145) greift zu kurz. Weibliche Patienten haben bei einem
männlichen Analytiker erhebliche Abneigung, sich auf die Couch zu legen, -
aber dies aus den bekannten anderen Gründen (sexuelle Konnotation, sie fühlen sich sexuell ungefragt ausgeliefert). Auch männliche
Patienten legen sich nicht gern hin, es sei denn, sie haben in der Literatur
davon gelesen, dies sei für die Heilung unerlässlich, - weil auch sie sich
in der Rückenlage – ganz selbstverständlich – ebenfalls hilflos fühlen müssen.
Die
Couch ist das Gegenteil von mütterlichem
Halt, wenigstens im Anfang. Es darf auch daran erinnert werden, dass das
Kind seine ideale Lage auf dem Arm an der Brust der Mutter findet. Flachliegen
bedeutet Trennung von der Mutter.
Wie
kommt es, dass dies übersehen wurde? Ideologische Blindheit, bloße Nachahmung ohne eigene Überprüfung.
ohne eigene Beurteilung.
Die
Abwehr wird auch in anderen
Falldarstellungen unterschätzt bzw. ganz außer Acht gelassen, so im
Fallbeispiel Anzieus (S 151), in dem ein Patient sich ausbittet, im Raum
herumgehen und die Gegenstände berühren zu dürfen, „ob sie wirklich
vorhanden sind“. Dies wird missverstanden als „Bedürfnis,....die Präsenz
sinnlicher Eigenschaften...in sich zu bestärken“. Auch hier wird der
Patient infantilisiert, - als ob er
tatsächlich darin unsicher sei wie ein Kleinkind. Hier handelt es sich
um eine der vielen notorischen,
leichtfertigen Verwechslungen von Klagen des Patienten mit
psychopathologischen und analytischen Befunden, zugunsten einer
Pathologisierung und Infantilisierung, also um billigste Küchenpsychologie,
- als ob nie eine Psychoanalyse entwickelt worden wäre.
Der
Sog im Analytiker, seiner
Fixierung auf die Kindheit nachzugeben, ist so groß, dass auch Übertragungsaspekte,
z. B der Wunsch nach vermehrter Zuwendung, und Gegenübertragungsaspekte und
eigene Übertragungen auf den Patienten, z.B. die unprofessionelle Neigung,
die angebotene Mutterrolle zu übernehmen, ganz aus dem Blick geraten sind
und der Analytiker die Begründungen
des Patienten wörtlich nimmt, als seien sie nicht symbolisch zu verstehen.
Hier muss er sich erneut die Frage gefallen lassen, ob ein Patient, der von
sich behauptet, er habe keinen sicheren Realitätssinn und müsse sich
deshalb konkret versichern, wirklich
realitätswahrnehmungsgestört sein soll, oder ob er, der Analytiker,
sich hier nicht naiv verhält. Fühlt er sich nicht manipuliert? Fragt er
sich nicht, was in der Patientin psychodynamisch vorgeht? Hat sie den
Wunsch, besonders beachtet zu werden und den Analytiker auf eine
Zuschauerrolle zu reduzieren? In sein Privatleben einzudringen? Ihn lächerlich
zu machen? Hat sich der Analytiker gefragt, warum er ihr dies erlaubt?
Nicht
einmal ein manifest Schizophrener
könnte eine derartige Störung des Realitätssinns aufweisen.
Nicht
einmal, wenn ein Schizophrener Stimmen aus seinem Bein oder aus einem
Nebenzimmer hört, sieht er nach, ob dort jemand ist. Er weiß, dass dort
niemand ist.
Hier
fehlt es elementar an Vergleich mit anderen Patienten.
Ebenfalls
ist es hier nicht erforderlich, einen „Rückgriff
auf einen der frühesten Kommunikationsmodi In Form einer Berührung der
Haut zwischen Mutter und Kind“ anzunehmen. Wieso Rückgriff?
Zweifellos war die erste Beziehung so. Aber sie hat sich weiterentwickelt
und somit verfestigt und wurde fortlaufend gebraucht. Würde man bei einem
Sehvorgang ebenfalls davon sprechen, hier sei ein Rückgriff auf die ersten
Tage des Sehens notwendig? Würde man von einem Rückgriff auf das Trinken
an der Mutterbrust sprechen wollen, wenn ein Erwachsener etwas trinkt? Auf
die frühe anale Phase, wenn ein Erwachsener Stuhlgang hat? Soll eine schizophrene Psychose oder eine hirnorganische Psychose mit
Desorientierung und Verlangsamung ein „Rückgriff“ auf einen frühen
Entwicklungsstand sein? Warum
soll die Kommunikation...mit Hilfe von Gesten, später mit Worten
eine... „Reaktualisierung und
Wiederbelebung dieser primären echotaktilen Kommunikationsgrundlage“
sein (S 157)?
Es
handelt sich hier um einen notorischen gedanklichen Kurzschluss aus
Voreingenommenheit. Nur weil etwas
schon früh da war, braucht keineswegs darauf zurückgegriffen zu werden.
es handelt sich um eine Körperfunktion,
die dem Erwachsenen zur Verfügung steht. Ein „Rückgriff“ soll es
nur deshalb sein, weil lt. Lehrbuch unbedingt alles auf die Kindheit zurückzuführen
sei.
Auch
bereits aus evolutionären Gründen sind die behaupteten Rückgriffe nicht möglich,
denn dies wäre viel zu umständlich für eine Entscheidung. Ein Lebewesen,
das sich in lauter Rückgriffen ergeht, wäre nicht überlebensfähig, noch
fortpflanzungsfähig.
Die
Suche nach kindlichen Vorläufern trägt religiöse Züge, - als ob darin
die Patienten fixiert seien und alles Heil versammelt sei.
Die
Formulierung auf S. 43: .. „Interpenetration
der Psychismen von Analytiker und Patienten..“ lässt keinen
informativen Vorteil gegenüber der einfachen Aussage erkennen, dass
Analytiker und Patient als Personen psychischen Einfluss aufeinander haben
und dies auch reflexiv wissen und fühlen.
Die
„Möglichkeiten, ein jeweils „Unbewusstes zu deuten“, sind keineswegs „unbegrenzt“ (S 11). Für jeden Therapeuten sind
diese vielmehr sehr begrenzt, wenn er nicht in Anderes ausweicht, sondern
bei seinen klinischen Aufgaben bleibt. „Unbegrenztheit“ wäre eine unnötige
Erschwerung der Aufgabe (Entscheidungstheorie!) und ein unbegründeter,
vollmundiger Anspruch. Alles, was wir tun, ist höchst begrenzt, und
Bescheidenheit ist das, was uns gut steht.
Der
Autor macht darauf aufmerksam, wie „Patient
und Analytiker immer wieder versuchen, die Aufmerksamkeit davon abzuwenden,
wie sehr ihnen die Dinge auf den Leib gehen (S 11), - eine sehr treffende
Formulierung. Damit ist Abwehr durch Negation, Verschiebung, Vermeidung und
Intellektualisierung gemeint, ohne dass der Autor allerdings dies so
nennt, offenbar weil er ohnehin den
Begriffen eines Abwehrmechanismus oder der Abwehr überhaupt abgeneigt
ist (s.u.), zugunsten von Formulierungen wie „Unterbringung in
„konventionelle Denkformen und Theoretisieren“,
ins „Denken über“ (S10).
Dass
dazu „Mut und Unerschrockenheit“
(wo ist das Risiko?) gehören würden (S 11), ist aber übertrieben- dramatisierend und selbstidealisierend (der Analytiker
als Held? Verf.: „Die Patienten
sind schwerkrank, leiden an Psychosenähe oder Borderline, sie wissen es nur
nicht, wir aber bringen ihnen das Wissen bei und wir sind die großen
Retter“ „Wir sind Heroen und bringen das Heil“. „Die Sprache der
Patienten ist zerstört, aber wir lassen sie wiederauferstehen, wir
rekonstruieren sie “, und andere unverkennbar quasi-religiöse Ansprüche
und Versprechungen.).
Solches
(der Analytiker als Held und Helfer) könnte man von der übrigen
Alltagsarbeit des Analytikers am Patienten auch sagen, wenn man denn dies wünschte.
Vernünftigerweise
lässt man das. Wir machen schlicht unsere Arbeit, zur Selbsterhöhung
haben wir keinen Anlass,
und die Patienten sind keinesfalls zu diesem Zweck gekommen,
auch nicht, um einen mutigen und unerschrockenen Analytiker zu erleben.
Sie
wünschen lediglich, Erleichterung von ihren Beschwerden zu erreichen. Sie
werden durch solche Ansprüche abgestoßen, und auch unser Ansehen kann
dadurch gewiss nicht steigen. Wir müssen uns nicht selbst herabsetzen, auch
nicht indirekt.
Der
Autor bemerkt, dass die eigene
allgemeine Beteiligung des Analytikers gern anerkannt und sogar nur zu gern
betont wird (auch in übertriebener Weise, in Form einer bisweilen
alleinseeligmachenden Beachtung der Gegenübertragung und / oder dessen, was
oft leichtfertig dafür gehalten wird), dass man
diese hingegen auf leiblichem Gebiet nicht wahrhaben will, sondern sogleich
all dieses Leibliche wieder „in den sicheren
Hafen konventioneller Denkformen und theoretischer Verfügung
unterbringen möchte“.
Der
Autor führt als Grund dafür an, dass es hier „um intime Resonanzen und idiomatische Einwirkungen“ gehe (S 11, -
meint der Autor damit „eigentümliche“? Dann wären „eigentümliche“
eindeutiger.).
Der
tatsächliche Grund muss aber ein anderer sein, denn solches ließe ich von
allen analytischen Vorgängen sagen. Hier, wie wiederholt im Buch, wird die
Unspezifität der gegebenen Begründungen übersehen. Denn
alles in der Analyse ist intim und eigentümlich.
Die
gesamte analytische Situation ist nämlich einmalig, und gerade dies wird ja
auch von der Psychoanalyse beansprucht und dient überdies auch für –
wenn auch stille- Heilungsversprechen gegenüber dem Patienten und den
Versicherungen.
Schon
die Behandlung im Liegen für eine „Lege-Artis“-Analyse und die
angesetzte, aber oft auch übertroffene Dauer der Behandlung beinhalten
einen außergewöhnlichen Anspruch
nach dem Motto: „Außergewöhnliche Heilung erfordert außergewöhnliche
Mittel“ und „Außergewöhnlich Mittel versprechen außergewöhnliche
Heilung“
Langdauernde,
hochfrequente Analysen kommen dadurch leicht unter Druck.
Nun
kann man sich nicht zur Rechtfertigung einzelne Gesichtspunkte herauspicken
mit der Begründung, sie seien eigentümlich.
Andererseits
ist dem Autor zugute zu halten, dass er natürlich versuchen musste, etwas
Besonderes auf diesem Gebiet aufzuzeigen und so allgemeine Ausführungen
hinter sich zu lassen, von denen es genug gibt, und er dies auch nachhaltig
versucht hat.
Dass
dies nicht immer erreicht werden konnte, hat viel mit der schwierigen
Materie zu tun.
Meine
Vermutung ist, dass der Autor meint, ohne dies klar zu sagen, dass im Analytiker
körperliche Vorgänge besonders schambesetzt sind, daher mehr abgewehrt
werden als manches Andere und daher ungern Anderen, so Kollegen und
Kolleginnen, mitgeteilt werden. Dies ist wohl richtig.
Nie
kann man z.B. lesen, dass der Analytiker während der Stunde eine Erektion
hatte, gewiss selten auch, dass er Herzklopfen bekam, Kopfschmerzen
einsetzten, Magenknurren hörbar wurde, oder er einen plötzlichen
Stuhldrang entwickelte.
Dies
kann kein Zufall sein, sondern weist
auf kraftvolle Abwehr hin. Hingegen ist gesellschaftsfähig geworden,
dass ein Analytiker in allgemeiner Form immerhin über sein sexuelles
Begehren in einer Stunde berichtet.
Andererseits
darf auch von psychiatrischer Seite (Verf.) ergänzt und eingewandt werden,
dass körperliche Vorgänge und deren
Darstellung nicht nur abgewehrt werden, sondern im Gegenteil weit öfter als
beeindruckender und realer als Anderes erlebt und auch mitgeteilt werden,
auch weit mehr als zur eigenen Person gehörig gesehen werden als Anderes.
Aber
der Autor wollte die Abwehr leiblicher Erlebnisse wohl auf die analytische
Situation beschränkt wissen, denn er beklagt nur die Abwehr dort, nicht im
allgemeinen Leben.
Es
wäre interessant, zu verstehen, warum ausgerechnet Psychoanalyse die Abwehr
leiblicher Erlebnisse –jedenfalls
nach den Beobachtungen des Autors, und
übrigens auch nach meinen, - derart
verstärkt. Man sollte doch erwarten, dass Analyse Abwehr auflöst und
somit leibliche Erlebnisse der Bewusstwerdung besser zuführt.
Versuchsweise
Erklärungen durch den
Rezensenten: In der Analyse fühlt
sich der Patient stärker beobachtet
als sonst im Leben, - sogar auf kleinste Regungen und Äußerungen wie sonst niemals, auch nicht von Seiten seines Lebenspartners oder
seiner Kinder oder Eltern oder Nachbarn. Daher verstärkt er seine Abwehr
wie jeder, der sich bedroht / beobachtet fühlt, - aus Angst, bei etwas ertappt zu werden, so einem aggressiven Gedanken /
Wunsch gegen den Analytiker, aus Schuld-
und Schamgefühlen wegen solcher „unerlaubter“ Wünsche, wegen Ängsten,
dass der Analytiker sich dafür rächen könnte (Vergeltungsangst)
oder auch ohne solche Motive zu weit in seine intimen Bereiche vordringen
und so seine Autonomie bedrängen könnte.
Es
geht um eine
keineswegs nur präödipale, sondern auch ödipale Autonomie (oder
meint jemand, „Autonomie“ sei ausschließlich ein präödipales oder -
allgemeiner - infantiles Ziel? Vermutlich ja: Regressionisten und Anhänger
der „infantilen polymorph-perversen Szenarien“, so u. a. S 35.), und es geht um eine reife Angst entgegen routinehaftem Denken, dass es bei Autonomie immer um die frühe
Mutterbeziehung gehen müsste, als ob also
später keine entsprechenden Wünsche, Ängste. Schuld- und Schamgefühle das Innenleben beherrschen würden
Die
Abwehr (gegen seine leiblichen Empfindungen und gegen die des Analytikers)
der Patienten (und des Analytikers) in der Analyse besteht in Negation (Verneinung) der
leiblichen Empfindungen, Vermeidung,
über diese zu sprechen, Identifikation
mit dem Aggressor Analytiker (der sich hütet, von seinen leiblichen
Empfindungen zu sprechen, - also macht es der Patient genauso), auch Reaktionsbildung
(der Patient möchte nur zu gern, geradezu exhibitionistisch, von seinen
leiblichen Erlebnissen Mitteilung machen, verkneift sich diese Lust aber aus
innerem Verbot).
In
common sense gesagt: Der Patient befindet sich in einer Ausnahmesituation, einer Notsituation,
wie sie selten ist, mit Hoffnungen, aber auch den o.a. unangenehmen
Affekten, und neigt daher instinktiv-
automatisch dazu, wie ein Igel alle Stacheln aufzurichten, d.h. alle seine
Abwehr zu verstärken.
Umso
mehr sollte der Analytiker die Abwehr im Patienten bearbeiten, wie auch in
sich selbst. Womit wieder das Thema Abwehranalyse
erreicht ist.
Um
auf die leiblichen Empfindungen zurückzukommen:
Diese
spielen namentlich auch, aber keineswegs nur, bei den coenästhetischen Formen der Schizophrenie und ihrer Vorläufer- und
Vorpostensyndrome die größte, namensgebende Rolle. In deren späteren
Erscheinungsformen werden sie gern nach außen projiziert und treten dann
als taktile, sensorische, akustische, olfaktorische oder gustatorische
Halluzinationen auf, selten auch als optische, und können mit schizophrenen
Wahnwahrnehmungen einhergehen, die dann Ausgangspunkt sein können für
schizophrenen (verfestigten) Wahn.
Hier
drängen sich dem Patienten Körperempfindungen
auf, weil sie nicht mehr
abgewehrt werden können (mangelnde Filterfunktion der Schizophrenen),
und der Schizophrene kann sich später
von so manchem dauerhaft distanzieren, nur
nicht von seinen körperlich erlebten Halluzinationen.
Daher
ist es umso bemerkenswerter, dass es
in Analysen von Neurosen anders oder nicht in diesem Maße der Fall ist
(nur erklärbar durch die Fähigkeit
von neurotischen Patienten, ihre Abwehr bei Bedrohung rasch verstärken zu können),
außer bei ausgeprägten
Angstneurosen.
Bei
Angst-Neurosen (i. Ggs. etwa zu
Zwangsneurose) verbleiben die körperlichen Erlebnisse im Vordergrund, und
von ihnen kann sich ein Angstpatient keinesfalls noch distanzieren, vielmehr
kommt er immer wieder auf diese zurück, so, um seine Angst vor weiteren
Angstanfällen zu begründen, aber nicht nur zu diesem Zweck, sondern weil
diese körperlichen Erlebnisse haften.
Namentlich
Herzklopfen und Schweißausbruch, in
der analytischen Literatur nicht genügend beschrieben und nicht
ernstgenommen, werden von den Angstpatienten mehr betont als die
Todesangst, sie werden immer wieder als erlebt beteuert und in allen
Einzelheiten, nicht selten mit Uhrzeit
des ersten (!) Auftretens, geschildert, und diese Patienten berufen sich
ständig auf diese, besonders auf deren erstes
Auftreten wie auf ein Schlüsselerlebnis, um sich Gehör zu verschaffen.
Auch
der Schizophrene kann sich im Gegensatz zu anderen Erlebnissen von erlebten
Körperhalluzinationen oder auch nur nicht- halluzinatorischen Wahrnehmungen
nicht mehr lösen.
Korrektur,
Distanzierung von den sinnlichen Erlebnissen ist bei diesen Erkrankungen
nicht möglich, offenbar, weil diese Erlebnisse als körperlich erlebt
wurden.
Man
kann spekulieren, ob der Autor diese wichtigen psychiatrischen Beobachtungen
für seine Gedankengänge hätte verwerten
wollen und können, wären sie ihm bekannt gewesen.
Aber
nicht nur Distanzierung, sondern auch Lenkung
der erlebten leiblichen Erfahrungen ist nicht möglich, weder dem
Patienten noch dem Analytiker, jedenfalls nicht mit analytischen Verfahren.
Wenn
in einer Analyse bei neurotischen Patienten und im Analytiker die
Leibsensationen nicht abgewehrt werden, sondern durchkommen,
bedeutet dies, dass der Patient schon
einiges an Abwehr aufgeben konnte ((so nach Sampson & Weiss
(1977-82), Mount-Zion-Gruppe (1986), dann, wenn der Patient – auch ohne
Abwehrdeutungen - genügend Vertrauen gefasst hat, sich also beim Analytiker
genügend sicher fühlt, oder wenn – gemäß der Abwehranalyse - die
Abwehr konsequent gedeutet und so aufgelöst wurde))
.
Dieses
Durchkommen zeigt, dass die Analyse erfolgreich verläuft. Vielleicht lässt sich dies in Zukunft als ein Meßinstument für den Erfolg einer Analyse während
des Verlaufs verwenden. Dies käme einer Revolution in der Therapieforschung und im Erfolgsnachweis gleich.
Faustregel
wäre dann: Je mehr Leibliches in der
Analyse erscheint, desto besser die Prognose der Analyse.
Sollte
sich dies bestätigen, hat sich der Autor mit diesem seinem Werk außerordentliche
Verdienste erworben, die sich noch gar nicht absehen lassen.
Dies
stützt die Forderung des Autors, künftig mehr auf Leibliches zu achten.
Auch
umgekehrt wäre es eine Aufgabe für die Zukunft, zu erkennen, in
welchen Situationen in einer Analyse genau sich Abwehr so versteift,
dass offensichtliche (hier im übertragenen Sinn gebraucht, vor allem offen
sichtbare, hörbare, vielleicht auch riechbare) Leiberlebnisse
auf beiden Seiten total oder fast völlig abgewehrt werden und in welchen
sie auf Seiten des Patienten (und des Analytikers) überhaupt nicht oder
wenig abgewehrt werden wie in der Angstneurose und bei den erwähnten
Schizophrenieformen.
Da
muss es einen Zusammenhang geben. Für die Angstneurose lässt sich bereits
sagen, dass diese ihre körperlichen Erlebnisse dann vorbringen, wenn sie
die Aufmerksamkeit des Analytikers erreichen und behalten wollen.
Der
Autor macht in diesem umfangreichen Werk kein Hehl aus seiner Überzeugung,
dass das – frühe - topographische
Modell Freuds im
Zusammenwirken mit der Objektpsychologie Kleinianischer Prägung anzuwenden
sei, nach welchem es darauf ankomme, das Unbewusste bewusst zu machen. Damit
muss eine Vernachlässigung der Abwehranalyse einhergehen.
Auch
wendet der Autor nachhaltig das Regressionskonzept
an. Gegen dieses sind immerhin gewichtige Einwände erhoben worden, so von
dem US-amerikanischen Analytiker Renik,
der einige Tage in Frankfurt – offenbar vergeblich - zu Gast war, - aber
auch wenn er nicht zu Gast gewesen wäre, bestünden diese Einwände. Man
kann aber dem Autor zugutehalten, dass z. Z. allgemein das
Regressionskonzept mit missionarischem Eifer verteidigt wird.
Das
Regressionskonzept verleitet bereits
zur mangelnden Begründung von Diagnosen. So wird häufig die Diagnose
einer „Borderlinestörung“ oder eines frühen Traumas gestellt, ohne
dass mitgeteilt wird, auf was sich diese Diagnosen stützen. Oft lauten die
„Begründungen“ nur, der Patient „bewege sich an einer Grenze“ oder
sei ein „Grenzgänger“, und der Analytiker müsse „höllisch
aufpassen, dass er nicht in eine „Psychose“(in welche bitte sehr?)
„abgleite“. Solchen Annahmen liegt blanke psychiatrische Ignoranz
zugrunde, und außerdem die übliche Eitelkeit, hiermit einen angeblich
schwer kranken Patienten zu behandeln und ihn „aus der Psychose zu
retten“. Es gibt kein Abgleiten von einer Neurose u d auch nicht von einer
Borderline-Erkrankung in eine Psychose (Krill 2008), und auch Analyse kann
keine schizophrene oder andere Psychose erzeugen.
Nicht
einmal wird mitgeteilt, nach welcher Nomenklatur hier eingeteilt wurde
(Kernberg? Rhode- Dachser? ICD-10? OPD? Andere?).
Die
routinemäßige Annahme von Regression muss nicht nur wegen der
Wahrscheinlichkeit von Fehldiagnosen, sondern auch wegen der daraus folgenden Fehlbehandlung katastrophale Auswirkungen
haben.
So
im Fall von Bollas (2000) auf S 168. In der Annahme, es
handle sich bei der Patientin um eine „Borderline-
Regression“ in „tiefer Verzweiflung“, glaubte der Analytiker, ihr
Küsse auf die Stirn geben zu sollen und sie mit einem Arm umfassen zu müssen.
Die vermeintliche Hilflosigkeit der
Patientin hinderte sie aber nicht daran, den Analytiker vor Gericht zu
bringen. Wo war die „Regression“ geblieben?
Zu
welchen diagnostischen Irrtümern und Fehlbehandlungen das
Regressionskonzept führen kann, zeigt ebenso
das Fall-Beispiel
(Gabbard
2005) einer Analytikerin, die sich, um es kurz zu fassen, immer mehr von
einer Patientin („missbrauchte Patientin“), ausbeuten
ließ, weil die Diagnose intensive („omnipotente“ nach
kleinianischer Nomenklatur, aber Allmachtswünsche sind nicht erforderlich,
um die Seelenlage in der Analytikerin zu kennzeichnen, es reichen auch
„Machtwünsche, Größenwünsche“) Rettungswünsche in ihr bewirkt
hatten. Der Autor hier rät – intellektualisierend und isolierend - von
der hier vorliegenden „Konzentration auf ein ausgewähltes
entwicklungspsychologisches Konzept“ ab, übersieht aber, dass er damit
die Sache verharmlost und den inneren Konflikt der Analytikerin nicht
beachtet. Die Analytikerin hat hier eine „Neubeelterung“ (S 169) betrieben und sich als „bessere
Mutter“ präsentiert. und auf Belohnung spekuliert, die nicht eintrat. Sie
hat die Patientin zu klein gemacht, um ihre Wünsche nach Rettung ausleben
zu können. Gleichzeitig hat sie dafür gebüßt (Selbstbestrafung) in Form
der Überforderung, aus Schuld- und Schamgefühl für diese verbotenen Wünsche
Sie hat durch ihre
Voreingenommenheit eine chaotische Situation erzeugt, die erst mit dem
Gerichtsverfahren wieder übersichtlich wurde.
Verdienstvoll
sind die Ausführungen des Autors über die Auswirkungen
körperlicher Annäherungen des Therapeuten: Schon Küchenhoff (1990,
27) hatte darauf hingewiesen, dass sich
ein Patient unfähig oder gar schuldig fühlt, wenn er solche Angebote des
Behandlers nicht annehmen kann (Verf.
möchte hinzufügen: Auch nicht
beantworten kann, etwa dafür Dankbarkeit empfinden oder erweisen kann) , ob ferner sich ein Patient nicht
dadurch abgespeist fühlen muss, und dass es naiv ist („voranalytische
Naivität“) , dem Patienten einfach
„etwas Gutes“ zu geben, wo
es doch darauf ankomme, dass altes Scheitern, altes Trauma zunächst einen
Platz in der Analyse einnehmen müsse, dass ferner der Patient auch die Versagung (Winnicott 1983) durch den Analytiker benötige, dass auch umgekehrt
das Nichtgewähren suchtartige Abhängigkeit vom Analytiker bewirken könne (sehr
wichtige Beobachtung! S 170).
Auch
die stereotype Herleitung
aus der Kindheit
wird vom Autor nachdrücklich betont. Von dieser Macht der Gewohnheit (die
er mit den meisten Analytikern und Ausbildungsinstituten in allgemeiner
compliance teilt) kommt er wiederholt nicht los:
So
heißt es auf S 14: „Der gestisch-leibliche Modus ist zugleich das Medium,
in dem sich bevorzugt all das aktualisiert, was (noch) nicht sprachfähig
bzw. konflikthaft ist und aus der bewussten Kommunikation ausgeschlossen
ist“... „können wir im kommunikativen Prozess zwischen Patient und
Analytiker die Spuren der echotaktilen Beziehung zur Mutter, oder frühen
vorsprachlichen sensomotorischen Interaktionen mit dem Primärobjekt
ausmachen“.
Glaubt der Autor wirklich, dass der
gestisch-leibliche Modus sich auf das Nicht-Sprachfähige oder Noch-
Nicht-Sprachfähige beschränkt?
Und
dass es etwa nur echotaktile Vorgänge und Entwicklungen in der Kindheit und
nur mit der Mutter gibt? Bleibt
der Mensch in seiner Entwicklung ab Kindheit stehen? Hat er gefälligst gemäß
dem Schneiderwitz stehen zu bleiben, weil die Theorie es so möchte? Alle
Räder stehen still, wenn die Theorie es will?
Ist
vielmehr der Erwachsene nicht ständig vom Nicht- Sprachfähigen oder zwar
Sprachfähigen, aber nicht Ausgesprochenen begleitet?
Wie
soll ein Erwachsener beschaffen sein, der etwa nicht aus Gründen des
Erwachsenenlebens ständig in
einen gestisch-leiblichen Modus verfällt? Der
keine echotaktilen Reaktionen zeigt?
Es
trifft auch nicht zu, dass das Nicht-Sprachfähige von der Kommunikation
ausgeschlossen wäre, im Gegenteil steht das Nicht-Sprachfähige in seiner
Bedeutung und Schnelligkeit weit vor allen verbalen Kontaktaufnahmen.
Wir
alle gestikulieren und betätigen unsere Mimik ununterbrochen, ohne dass wir
immer sagen könnten oder möchten, ob und was wir damit ausdrücken wollen.
Soll
es etwa keine späteren sensomotorischen Interaktionen mehr geben als nur in
der sprachlosen oder spracharmen Kindheit und nur mit der Mutter?
Man
könnte hier von einem falschen
Alleinvertretungsanspruch der Kindheit sprechen, wäre die Kindheit hier
eine Person und wäre sie gefragt worden. Fragen Sie Ihren Analytiker und
sein Ausbildungs-Institut nach den Nebenwirkungen der Ausbildung!
Explizit
(S 38) formuliert der Autor: „Das
Sexuelle in der psychoanalytischen Praxis - und natürlich ist hier das Drängen
der infantilen Sexualität gemeint.“
Die
„drängende“ Sexualität eines Analytikers bei
einer attraktiven, jüngeren Patientin ist alles andere als eine bloß
infantile.
Wäre
sie infantil, womöglich noch weiter
reduziert auf eine bloße Harnerotik, wäre die ganze Aufregung um die
erotische Beziehung zur Patientin entbehrlich.
Soll
/ darf nur die infantile Sexualität drängen? Soll es womöglich nur ein Harndrang sein,
dessentwegen er das Hemd über seine Hose zieht, wie er mehrfach erwähnt
(zuletzt S 32)? Ist der Analytiker ein Kind oder ein Erwachsener, der die
Gewalt der Erwachsenensexualität durchaus spürt? Kann seine Gegenübertragung
die eines Kindes sein oder ist es hier die benötigte Theorie, die seine
Selbstwahrnehmung entstellt?
Der
Autor ruft hier anschließend, wie auch an anderen Stellen die „Gruppe“, „die Kollegen“, nun Freud zu Hilfe (S 38):..
„auf eine Zukunft zu dritt - Freud, die Patientin und er“. Sucht er in
seiner Bedrängung einen rettenden, wohl verbietenden Vater? Oder bedeutet
das Heranziehen eines Dritten nur eine Ausflucht vor der drängenden
Erwachsenensexualität, eine Verschiebung auf eine Situation, die real gar
nicht vorliegt? Dem Leser kann dies vorkommen, als ob der Therapeut immer
wieder zu dieser Notbremse („Gruppe“, „analytische Gruppe“,
„Kollegen“, „der Dritte“, „Freud“) greifen muss, wenn die
Zweiersituation zu brenzlig wird. Hic Rhodos, hic salta! Er muss das Thema
schon da, wo es auftritt, nämlich in der Zweiersituation mit der Patientin,
abhandeln. Ist dies die phobische
Reaktion
(S 12), die der Autor selbst erwähnt?
Ein
solcher Alleinvertretungsanspruch scheint auch umgekehrt für die blinden
Flecken von Analytikern erhoben zu werden („Blinde Flecken“ S. 37).
Diese sollen offenbar nur auf präödipalem Gebiet eintreten („eigene
regressiv-infantile Gegenübertragungsverwicklungen“, S 37) und haften
bleiben. Auf ödipalem Gebiet hat es keine?
Und
was ein tatsächlicher weiterer blinder Fleck ist: Die Progression wird im
Buch notorisch fast ausgelassen (nur
als „Freiraum für ..Entwicklung“ (S 40) pauschal erwähnt, aber nicht näher
ausgeführt, wie es dieses wichtige Thema verdient hätte) - als ob es die
progressive Entwicklung und die Wünsche danach, die Ängste davor und die
Schuld-und Schamgefühle wegen Nichterreichen der angestrebten Ziele nicht gäbe.
Der
„blinde Fleck“ ist die Einseitigkeit der Betonung des Regressiven und Infantilen, also die
notorische Rückwärtsgewandtheit der Psychoanalyse. Auch
hier schwimmt das Buch mit der analytischen Umgebung mit.
Welches
Menschenbild liegt der Annahme zugrunde, dass alles auf die „Kindheit“
zurückzuführen ist? Ist die Implikation, dass nämlich der Erwachsene
somit entmündigt und entwertet wird, bedacht? Soll
das Kind den leiblich-gestischen Modus für sich gepachtet haben? Will
Analyse deshalb die Regression des Erwachsenen zum Kind oder gar Kleinkind,
das gefälligst Sitzen noch nicht erlernt haben soll, weil es noch zu klein
ist und deshalb zu liegen hat, erzwingen bzw. weiterhin behaupten, anders
sei eine Analyse nicht möglich?
Diese
Vorgefasstheiten können sich indes verbreiteter Anwendung erfreuen, sodass
sich der Autor damit in bester Gesellschaft sehen kann.
Wie
ein vergessener Platzhalter taucht dann der
„Dritte“ (S. 37), auch der „Bezug zur analytischen Gruppe“
auf. Hier wird es also auf einmal ödipal,
darf aber offenbar nicht so genannt werden,
weil es das theoretische Wunschbild von Regression und Infantilität in
Frage stellen würde.
Auch
an anderen Stellen ist offensichtlich von
Erwachsenensexualität die Rede, sie darf aber nicht als diese bezeichnet
werden, wohl, weil der Autor einseitig die infantile Sexualität betonen möchte. So heißt es auf S 41: „Im Feld dieses Zusammengehörig-
Widersprüchlichen lässt sich eine weitere Dialektik ausmachen: Die
Tatsache, dass die psychoanalytische Situation die direkte Triebbefriedigung ausschließt...“. Übrigens sehe ich
hier keine Widersprüchlichkeit und keine Dialektik. (s. auch unten). Ich
sehe nur verschiedene Gesichtspunkte.
Damit
kann im Zusammenhang nur die Sexualität unter Erwachsenen gemeint sein.
Denn
eine infantile Sexualität kann ein Erwachsener gar nicht
ausüben noch wirklich fühlen, auch wenn er sich dazu zwingen möchte, etwa
in compliance (Folgsamkeit,
Neigung zur Übereinstimmung)
mit dem Analytiker. Er ist dazu gar nicht in der Lage.
Ein
jeder kann ja bei sich versuchen, sich in seine Kindheit zu versetzen. Es
gelingt nicht, schon weil man den
schweren Erwachsenkörper und dessen (Leib-) Sensationen mitnehmen müsste.
Nicht umsonst geht das Wort Freuds um, das
Ich sei vor allem ein körperliches. Deshalb kann eine Regression nie
erreicht werden.
Hier
dürfte es sich um die bekannten Machtwünsche
(Der religiös kontaminierte Terminus Allmacht, Omnipotenz aus dem
Kleinianismus ist auch hier völlig unnötig und nur irreführend) vieler Analytiker handeln, nach denen alles möglich sein soll, wenn
nur die Theorie es so will. Papier ist geduldig, Theorie noch mehr).
Oder
soll er etwa innerlich Harnerotik betreiben? Vielleicht zusammen mit der
Patientin, mit Zeigen und Gesehenwerden? Nur mit Mühe könnten Analytiker
und Patienten sich begrenzt in
eine infantile Sexualität einfühlen, diese aber gewiss nicht mehr so
erleben, wie sie einstmals gewesen sein mag, abgesehen von der Nutzlosigkeit
solcher Bemühungen, sogar Abträglichkeit, weil diese vom aktuellen
Konflikt nur ablenken (Verschiebung, Intellektualisierung, Negation, grobe
Verleugnung, Unterwerfung unter eine Theorie).
Es
ist oft nicht das gesagt, was gemeint
ist, und dies führt zuweilen zu einem erschwerten Erkennen der
Gedankenführung.
So
ist auch der Zusammenhang des Gesagten mit dem Fallbeispiel (S 41) nicht
ersichtlich: Der Fall:
„Ein Patient beklagt sich, dass ich es mit der Stundenpünktlichkeit bei
ihm wohl nicht so ernst nehme,.. ergibt sich, seine Mutmaßungen mit seiner
Stellung in der Geschwisterreihe und den infantilen Rivalitätskonflikten in
Verbindung zu bringen...“ Der Therapeut nimmt einen Uhrenvergleich vor.
Dazu entblößen beide ihre Unterarme. Dies wird vom Therapeuten so
verstanden, dass –in Verschiebung – ein Penisvergleich nach Art eines
Wettbewerbs unter Jungen agiert wird.
Meine
Deutung: Wieder viel zu tief gegriffen, in die tatsächliche oder angebliche
infantile Sexualität (Penisvergleich von Jungen), während es tatsächlich
um die Rivalität zwischen Therapeut und Patient geht. Der Patient macht dem
Analytiker Vorhaltungen, dass er die Stunden nicht pünktlich einhalte.
Darauf geht der Analytiker nicht ein, vielmehr verschiebt
er diese Rivalität („Wer ist hier eigentlich der Pünktliche?“ Der
Analytiker oder der Patient?) in die
Kindheit des Patienten, in die vermutete Geschwisterrivalität des Patienten
innerhalb seiner Geschwisterreihe, - um nicht vom Patienten angegriffen
zu sein.
Anzunehmen
ist, dass der Analytiker genau gespürt hat, dass der Patient einen kleinen
Kampf mit ihm aufnehmen möchte, verdrängt dies aber, wendet dazu noch
Reaktionsbildung an. Statt auf den Angriff aggressiv, etwa mit einer
Gegenbeschuldigung, zu reagieren, nimmt er den Patienten in Schutz, indem er
den Uhrenvergleich anbietet. So gibt er dem Patienten zu 50% die Chance,
Recht zu haben. Auch Isolierung wird vom Analytiker gebraucht: Statt das
Aggressive in dieser Abfolge zu sehen und voll zu fühlen, trennt er den
aggressiven Affekt ab. Rationalisierung und Intellektualisierung sind
ebenfalls beteiligt, denn der Analytiker meint, das Ganze sei auch „in
einem objektiven Rahmen anzusiedeln“ (S 42). Es geht aber nicht um einen
„objektiven Rahmen“, sondern um die Beziehung zwischen Patient und
Analytiker. Der Patient möchte seinen Analytiker etwas angreifen, und was
der Analytiker darauf antwortet, sind nur Ausflüchte (evasions, otgoworki),
analytisch gesehen Abwehren, keine Deutungen, - weil hier Übertragung und
Gegenübertragung außer Acht gelassen sind.
Die
genannte Einseitigkeit ist auch
in einem anderen Fall
(S 113) nicht zu verkennen: Der Analytiker „wiederholt ganz langsam ihren
väterlichen Familiennamen“ und schreibt:
„Darin ließ sich die ganze tiefe Emotion der in der Übertragung
aktualisierten, kindlich-ödipalen Liebe fassen“. Immerhin hat es hier der
Autor bis zur Ödipalität gebracht, wer hätte das gedacht, - sonst ging es
doch eher um Symbolisierung bei frühkindlichster Störung. Aber auch hier
darf man fragen, warum es denn die „kindlich-ödipale Liebe“ sein muss
und nicht die reife Liebe einer erwachsenen Frau sein darf. Das ganze Ausmaß
der ausagierten Voreingenommenheit
zeigt sich schon darin, dass der Analytiker hier mit Suggestion arbeitet,
indem, er den Namen des Vaters erwähnt, und sich anschließend diese
Intervention selbst deutet. Die Patientin wird nicht gefragt. Die
„leibliche Resonanz“ (S 113 dito) mag hier bei dem „Namen des
Vaters“ (durchaus auch mit einem religiösen Touch) gegeben sein, aber
warum sollte die Resonanz bei einer reifen Liebe geringer sein? Weil
der Autor leibliche Resonanz von Erwachsenen nicht wünscht. Er möchte
Leiblichkeit immer mit Frühkindlichkeit oder höchsten mit infantil-ödipaler
Position verbunden wissen und vor allem auf diese reduzieren.
Ist
das die Phobie vor der Erwachsenensexualität, die der Autor selbst
beschrieben hat? (S
12)
Auch
die vom Autor zitierten früheren Autoren, die sich auch gern aufeinander
beziehen, und somit auch von sich abgeschrieben haben dürften
(Zitierkarussell) und ihre Ansichten damit begründen, wie Leikert (2005)
auf Ogden, S 116-117) können es
nicht lassen, den körperlichen Modus mit der Frühzeit und / oder der frühen Störung
und der Genese der normalen Entwicklung und der frühen Störung zu
verwechseln und gleichzusetzen.
Hier liegt ein kategorialer Denkfehler
vor, nämlich Verhaltensweise und Zeitraum in eine Kategorie zu setzen. Die
Verführung zur genetischen Ableitung des Erwachsenenlebens aus der
Kindheit, mit oder ohne deren Störungen, ist nicht auszurotten („genetic
fallacy“,
Shapiro 1981).
Die
Psychoanalyse ist belastet durch die verhängnisvolle Tradition, nur noch zu
fragen: Wie können wir das Erwachsenenleben aus der Kindheit erklären
(zeitorientiert, Infantilimorphismus)? Statt zu fragen: Was geht jetzt in
und zwischen den beiden Erwachsenen vor (innenlebenorientiert,
konfliktorientiert)?
Als
Beispiel mag die Erektion
dienen, - weil sie eine eindeutige leibliche Mitteilung an
sich selbst und den Anderen darstellt, wie schon das Feuchtwerden an der
Eichelspitze. Soll auch diese nur
eine frühkindliche Bedeutung haben? ist es Zufall, dass sie niemals erwähnt
wird? Oder ist das Nichterwähnen ein
Zeichen der Phobie der Analytiker vor der Erwachsenensexualität? Oder
ist es ein Zeichen der Verlegenheit,
in die der Autor kommen muss, wenn er auch dieses Leib- Phänomen als frühkindlich
einordnen müsste?
Dies
ist zu vermuten. Was nicht passt,
wird einfach fortgelassen. Nach dem Schneiderwitz hat ein Analytiker keine
Erektion zu haben, geschweige denn davon zu sprechen. Er hat sich der
Theorie von der Frühkindlichkeit in allen leiblichen Äußerungen zu fügen
und fügt sich auch. Es darf nicht sein, was nicht sein soll.
Es
wäre interessant, zu erfahren, wie der Autor den Fallstricken der Frühkindlichkeit entkommen möchte, an denen er selbst mitgewebt
hat.
Auch
andere Beispiele, die der Autor anführt, folgen dem gleichen
Muster: Die Beispiele sind voll von beeindruckenden Sprech- und anderen
Akten, die durch sich schon performativ wirken und die monoton auf Kindheit
zurückgeführt werden. So auf S 123:
Ein
Patient spricht von „Ficken“ , und von der entsetzten, lautstarken
Gegenfrage seiner älteren Schwester, als er acht Jahre alt war:
„Waas?“, die nun somit auch der Analytiker zu hören bekommt und von der
er „affektiv leiblich getroffen“ ist.
Was
hier gewiss nach einer Wiederholung des Ablaufs im Kindesalter aussieht und
auch ist, wird aber nicht weiter auf Übertragungsgehalt untersucht, etwa,
was der Patient jetzt damit dem Analytiker sagen wollte und welche Abwehr er
anwandte (Verschiebung auf Kindheit und auf eine weibliche Person,
Vermeidung eines wohl aggressiven Gefühls gegen den Analytiker, „mal
sehen, was der Analytiker macht, wenn ich ihn mit einem harten sexuellen
Wort erschrecke“).
Offensichtlich
macht der Analytikers nur zu gerne diese Abwehr mit und wendet sich
ebenfalls der Vergangenheit zu, verwendet dazu auch die übliche
Intellektualisierung („Schnittstelle...rätselhafte Botschaften“.-
wirklich rätselhaft?? Schnittstelle von was?? Anm. d. Verf..). Übertragungsdeutungen
hätten lauten können: „Sie möchten jetzt sehen, ob ich so erschreckbar
bin wie Sie seinerzeit. Sie fürchten zugleich, dass ich so erschrocken bin
wie Sie seinerzeit. Sie hoffen (fürchten, und beneiden mich dann) dass ich
tragfähiger bin als Sie seinerzeit.“
Was
soll damit gewonnen sein, wenn man den Patienten nur auf seine Kindheit und
seinen damaligen Schreck verweist? Der Analytiker hat nur bewiesen, dass er
Historie nachvollziehen kann, dass er sich in den damaligen Schreck einfühlen
kann, kurzum, dass er ein „guter Analytiker mit guter Empathie“ ist oder
jedenfalls so wirkt. Er hat sich
dargestellt, er war aber nicht beim Patienten im Hier und Jetzt.
Vor
lauter Stolz über die Entdeckung des beiderseitigen Leiberlebnisses hat er
übersehen, dass er sich damit nur selbst in den Mittelpunkt stellt, - abgesehen
davon, dass gute Empathie nichts Besonderes ist, jedenfalls nicht von
Analytikern gepachtet sein kann, sondern auch von Pfarrern, Freunden,
Nachbarn täglich erbracht wird, und dass bloße Empathie noch keine
Therapie sein kann.
Der
Patient spricht wohl eher, verschoben auf seine Kindheit, von seiner Rivalität
mit seinem Analytiker, - aber dies
ist dem Analytiker nicht infantil und nicht infantil-sexuell genug, um
beachtet zu werden, es könnte womöglich – „horribile dictu“ - eine
Rivalität unter Erwachsenen sein, so mit dem Analytiker, und da sei Gott
vor.
Die
Vorliebe für das - tatsächlich oder vermeintlich – Infantile hat sich
verselbständigt. Das
kostbare beiderseitige leibliche Erlebnis wurde auch hier nur dafür
verwendet, das Infantile zu verehren.
Zur
Verwirrung trägt der unklare
Frontverlauf bei: Immer wieder werden leibliche Phänomene den
seelischen gegenübergestellt. Hier
liegen aber die Meinungsverschiedenheiten schon längst nicht mehr. Das
gegenseitige Einwirken auch von leiblichen Äußerungen und deren Intensität,
auch schon in der Sprache selbst, ist ja unbestritten.
Tatsächlich
geht es hingegen um den Gegensatz
zwischen Erwachsenen- Innenwelt und (früh-)kindlicher Innenwelt.
Dieser
Gegensatz wird tabuisiert, weil man nur das (Früh)-Kindliche gelten lassen
möchte.
Verbreitet
ist offenbar eine Feindschaft zur Innenwelt des Erwachsenen, sogar schon des
Jugendlichen, und somit unreflektiert zu Jugendlichen und Erwachsenen überhaupt,
auch der Rolle des Vaters. Man will sie einfach ausblenden.
Die
Rolle des Vaters
wird ersetzt durch den „Dritten“, durch die Kollegenschaft und durch den
Analytiker selbst. Diese Instanzen und Mitspieler vertreten aber ebenfalls
die These von der alles beherrschenden kindlichen Welt, namentlich der These
von der ewig fortdauernden Kind- Mutterbeziehung, sodass hier nur eine
Schein-Ödipalität erreicht wird, die der Absicherung der These von der Frühkindlichkeit
zuarbeitet.
Den
genannten Mitspielern fällt hier nur eine dienende Rolle zu, nämlich auf
die frühe Mutter- Kindbeziehung zu verweisen und einen Ausbruch aus dieser
Auffassung zu verhindern.
Aus
diesem Zirkelschluss kann es deshalb von innen heraus kein Entkommen geben.
Der
häufigste Typ von heutigem Analytiker will
in den erwachsenen Patienten nur Kleinkinder sehen, und sich als großen
Retter, zumindest als besseren Elternteil.
Eine
häufige klischeehafte Figur von Analytiker nach Lehrbuch ist der Analytiker
als Vater, der Analytiker als Mutter, auch mal als Großvater oder Großmutter,
jeweils nur der Kleinkinder.
Jugendliche und Erwachsene haben
bekanntlich keine Eltern und Großeltern.
Mit
der Kindheit soll es mit dem Seelenleben zu Ende gegangen sein.
Freud
wurde an der falschen Stelle angezapft, - an seiner Achillesferse „frühkindliche
Sexualität“, an seinem Fuß statt an seinem Kopf.
Motive
sind die Verehrung des frühen Freud und die (auch seine) Phobie vor der großen
Gewalt der Erwachsenen –Sexualität und Aggressivität. Es hat sich
herausgestellt, dass die, welche ständig über Sexualität reden, die
meiste Angst vor ihr haben, was gerade analytisch gesehen nicht verwundern
kann (kontraphobisches Verhalten).
Psychoanalyse
muss dazu kommen, dass sie die Aufgabe
hat, die Konflikte jeder Alterstufe und eher noch die zukünftigen („Antizipation“) zu erkennen und zu behandeln. Auf dem Sterbebett
geht es nicht mehr um Partnerschwierigkeiten oder frühkindliche Sexualität.
Auch
die hegelianisch- marxistische,
compliancehafte Anleihe „Widerspruch“, „Dialektik“ (so S 41)
wird nicht benötigt, da eine zusammenhängende Lehre nicht besteht.
Es handelt sich um Sexualität, Abwehr der Sexualität und
Symptombildung, - mitnichten um einen Widerspruch, sondern allenfalls einen
Gegensatz. Statt „Dialektik“ ist genauer zu sagen:
Kompromissbildung. Wir müssen uns im klinischen Bereich bewegen, oder
wollen wir dem Patienten weismachen, er leide an „Widersprüchen und
Dialektik“? Abgesehen davon, dass wir theoretische Erklärungen ohnehin
nicht geben, da sie nutzlos sind, sogar nur Intellektualisierung als Abwehr
fördern.
Der
Autor legt sich für dieses Thema einseitig
auf Bion
(und den Kleinianismus fest. Bion war Analysand und Schüler von Melanie
Klein.
Bion
ist gewiss originell, aber schwer zu verstehen, über große Strecken
verstiegen, teilweise auch verworren, was mit Tiefsinn verwechselt wird und
deshalb große Anziehungskraft auf „Tiefenanalytiker“ ausüben muss, hat
vergeblich versucht, sich in mathematisch aussehenden Formeln von
Scheintiefsinn zu retten.
Sein
Konzept vom „Angriff auf das
Denken, Antidenken“ ist eine Idee nahe einer Marotte, - was nicht
erkannt wird, zumal der Begriff „Denken“ von ihm in anderer Bedeutung
gebraucht wird als im Sprachgebrauch (wie Anderes schon bei Melanie Klein)
und seine Nomenklatur durch ihre Rätselhaftigkeit die analytischen Gemüter
begeistert, wie es schon zuvor mit anderen Begriffen wie „double bind“,
projektive Identifikation“ (s. Krill 2008, 88ff) geschehen war. So sollen
„Gedanken“ vor dem „Denken“ entstehen und erst zum Denken hinführen.
Dazu kommen Übersetzungsfehler, so heißt „to think“ nicht nur denken,
sondern auch (meist!) glauben, meinen. Wenn heute so leichthin gesagt wird
„Ich denke mal“, ist damit nicht ein Denkvorgang gemeint, sondern eine
Meinung (falscher Anglizismus).
Bion
fehlt vor allem oft der klinische Bezug. Seine Falldarstellungen zeigen, ähnlich wie bei Fonagy und Kernberg,
B., auch vielen anderen Analytikern, keineswegs überzeugend das, was sie
demonstrieren sollen, sie sind somit seinen eigenen Maßstäben nicht
gerecht geworden. Theorie kann nur so weit brauchbar sein, wie es wenigstens
die selbstgemachten Falldarstellungen zeigen.
Werden
seine Aussagen mehr oder weniger pauschal geglaubt und wörtlich
nachgebetet, machen sie sich bibelgleich gewissermaßen selbständig und
gewinnen die Oberhand über den Analytiker, der sich einem scheinbaren
Riesen ausliefert. Die Eigenständigkeit, das eigene Urteil des Analytikers
muss verlorengehen, wenn er sich und seine Analyse auf Gedeih und Verderb,
also Verderb, derartig ausliefert.
Jede
Psychoanalyse ist unter solchen Umständen zum Scheitern verurteilt, sie
wird von der phantasierten Macht einer Autorität erdrückt, die sich weit
von der Klinik entfernt hat.
Wie
war noch der Schneiderwitz? Wenn der Maßanzug nicht passt, muss sich eben
die Figur ändern, bis er passt.
„Befunde“
(S 96-97: „Denkstörung“, „Vernichtungsgefahren“, „Omnipotenz“,
„Halluzination“, - die allesamt nicht vorliegen, aber biongemäß
geliefert werden) haben sich dann an Bion anzupassen, nicht Bion- Athleten
an Befunde.
„Omnipotenz“,
vom Autor immer wieder erwähnt, ist ein typisches, immerfort gedankenlos
wiederkehrendes Versatzstück aus dem Kleinianismus, nie klinisch
dargestellt, auch nicht in Traumanalysen, nie unterschieden von den bloßen
ubiquitären Machtwünschen, aber besser klingend. Die Spanne zwischen den
anspruchsvollen, verblasenen Aussagen und dem tatsächlichen Verlauf von
Psychoanalysen wird allgemein immer größer, ist schließlich nicht mehr überbrückbar
und muss in verquasten Sätzen enden.
Häufig
Bion zu zitieren, kann den klinischen Nachweis in einer sorgfältigen
Einzelfalldarstellung nicht ersetzen (s.u.).
Hier
sei nur an die ausführlichen Einwände
(gegen das Regressionskonzept und bloße Herleitung aus der Kindheit)
der einflussreichen und in ihrer Sicht konsequent argumentierenden US-
amerikanischen Psychoanalytiker Shapiro
(1981) erinnert, der das „race back“ zu frühen und frühesten
Entwicklungsstadien mit den Worten geißelte: „Darf es etwas früher
sein?“, - hierzu auch folg. Zitat:
aus „On the quest for the origin of conflict, Psa Q, 50, 1-21:
„Diejenigen, die flink
und gerissen genug sind, einen immer früheren Ursprung für eine gegenwärtige Symptomatik zu nennen, fällt die
Siegerkrone zu...Melanie Klein und ihre Schüler waren die Sieger
der Rückwärtsschau...
Zirkelschluss, gleiche seelische Zustände in der Vergangenheit auffinden
zu wollen, um aus ihnen – auf einem gleichsam linear-kontinuierlichen Pfad
- die Konflikte von Erwachsenen zu erklären...überhaupt die
Vergangenheit zu bemühen, um einen gegenwärtigen Zustand zu verstehen...“.
und
Paul Gray (Lit. 1973-1992), der
einen allgemeinen Rückfall
vom – späteren - Strukturmodell Freuds auf das topographische Modell
heftig beklagte („Heiteres Ratespiel, Angler nach dem Unbewussten,
Verschiebung der aktuellen Konflikte auf eine frühere Zeit und auf andere
Personen, aus kollusiver Abwehr, besonders gegen aggressive Phantasien in
der Übertragung und Gegenübertragung“, s. Krill 2008).
Über
die vielen Zitate von Freud (aber nie Anna Freud, kaum zufällig, s.o.), Merleau-Ponty
und Anderen, kann aber leicht in Vergessenheit geraten, dass Zitate
keine Argumentation und namentlich keine
Darstellungen von inneren Abläufen, welcher Art auch immer, also ob
mehr „psychischer“ oder „leiblicher“ Art, im Patienten wie im
Analytiker ersetzen können. Bloße Zitate weisen auf Argumentationslosigkeit
hin.
In
der Begriffswelt greift der Autor des Öfteren auch auf andere eingängige
Begriffe zurück, ohne diese in Frage zu stellen, so auf „Zwischenleiblichkeit“, ein Kunstwort nach Merleau- Ponty (S 10,
S 15). Es kann keine solche in der Sache geben. Die ständige Interaktion
bleibt davon unberührt, - sie findet aber in den Köpfen statt, und nicht
im Raum zwischen den Personen.
Es
kann nur die Vorstellung davon in den Teilnehmern geben. Zwischen den
Leibern ist nichts. Es ist wohl eine nützliche Hilfsvorstellung für
theoretische Erwägungen, aber man muss achtgeben, dass solche Vorstellungen
sich nicht verdinglichen
(„reifizieren“), als ob sie ein eigenes Leben mit einer eigenen
Psychodynamik haben könnten. Psychodynamik gibt es nur in den Personen,
nicht dazwischen, ungeachtet der Vorstellungen in jeder Person von
wechselseitiger Psychodynamik und wechselseitiger leiblicher Beeinflussung
und Sichhineinversetzen in die inneren Positionen und Vorgänge des Anderen,
so auch auf das eigene Verhalten, das beim Anderen etwas auslöst.
Das
gleiche gilt für Vorstellungen von „Raum“,
„Zwischenraum“: Es gibt keine solchen außerhalb der Personen, nur
die Vorstellungen davon in den Personen.
Der
Autor lässt offen, ob er diese Gefahr erkannt hat. Der Leser kann den
Eindruck haben, dass er sie gespürt hat.
Der
Autor greift stark auf das Konzept der Psychosexualität
zurück (S 12), leider nicht auch auf
das der Psychoaggressivität, wie sie vom späteren Freud mit der
Gleichstellung der aggressiven Triebe mit den sexuellen konzipiert wurde,
und auch nicht auf die von Freud
nie aufgegebenen Selbsterhaltungstriebe.
Der
Autor glaubt, dass auch heute noch Psychoanalytiker von einer phobischen
Haltung gegenüber der „Sexualität
(S. 12:
„phobischer Umgang mit dem Sexuellen“), (Anm. des Verf.:
der Autor meint hier die Erwachsenen-Sexualität, in ödipaler Position)
befallen seien, und diese Haltung dazu führe, dass in psychoanalytischen Veröffentlichungen „das Sexuelle immer
weniger thematisiert wird“ und dies zu einer abträglichen
Betonung , sogar Fokussierung der heutigen Psychoanalysen auf die prägenitale
Position, unter Ausschluss der ödipalen Position und späterer
Positionen führe.
Diesen
Eindruck habe ich auch selbst seit langem. Dies kann jeder in Seminaren,
Falldiskussionen, Prüfungssituationen beobachten.
Gefällig
ist allgemein, einem Analytiker, der eine ödipale Position vertritt, vorzuwerfen,
er habe nicht gründlich genug analysiert und deshalb „das Frühe“,
namentlich das Präödipale, das frühe Trauma, nicht gesehen. Deshalb
werden nur noch präödipale Störungen vorgestellt. Einem derartigen
Vorwurf, man habe nicht gründlich genug analysiert, wird so von vorneherein
der Boden entzogen. Der „Präödipale“ erhält immer Recht und besteht
auch das Abschlussexamen, wenn er
nur konsequent genug seine Linie verfolgt und ihm die entsprechende
Darstellung gelingt, er also in seinem Konzept bleibt.
Hinzu
tritt die von Shapiro (1981) beklagte Tendenz zum hemmungslosen „race
back“, zu immer früheren Positionen. Der
Autor betont hier zu Recht die weitere Motivation: Eine phobische Angst
der Analytiker vor der Erwachsenensexualität, und zu ergänzen ist, auch vor
der Erwachsenenaggressivität, wie ich sie beide auch an anderen
Stellen, zuletzt im Vorwort zu meinem Buch „Gruppenanalyse Neu“, 2013,
vermutet habe. Nirgendwo sonst habe ich von dieser Motivation lesen können,
und es ist ein Verdienst des Autors,
auf diese Motivation hinzuweisen, und dies im
Gegensatz zu seiner analytischen Umgebung.
Zur
„phobischen Angst vor der Erwachsenensexualität“: Freud hatte Großes vor.
Zweifellos hatte er sich die Befreiung
aller psychischen und körperlichen Funktionen einschließlich der sexuellen
von psychischen Hemmungen wie Ängsten, Schuld- und Schamgefühlen zum
Programm gemacht. Er hatte sich und eine erhoffte „bessere“ Zukunft
auch in einen Gegensatz gestellt zur angeblichen viktorianischen Prüderie
und zur angeblich viktorianischen Prüderie. Nicht nur, dass das
„viktorianische Zeitalter“ schon zu seiner Zeit längst vergangen war,
war es auch ein Vorurteil, in jener Zeit sei es besonders prüde zugegangen.
Sein Motiv, die vergangene Zeitperiode zu entstellen und sie entstellt
darzustellen, dürfte darin liegen, seine eigene Position der Entdeckung der
frühkindlichen Sexualität umso pointierter darstellen zu können.
Er
hatte aber damit zuviel versprochen.
Will
man Freud an seinen - falschen - Gegenüberstellungen und – falschen -
Versprechungen messen, muss man zu dem Schluss kommen, dass er in dieser
Hinsicht nichts erreicht hat. Es wäre einer wissenschaftlichen Mühe wert,
einmal die Versprechungen und
Erwartungen Freuds mit den tatsächlich eingetretenen Erfolgen abzugleichen.
Jedenfalls hier
liegen Freuds Verdienste nicht.
So
wurde Homosexualität erst in jüngster
Zeit geschützt, und Homosexuelle wurden, ausgerechnet in psychoanalytischen
Vereinen, erst seit ca. 1990 zur analytischen Ausbildung zugelassen, - aber
es ist ein großer Irrtum, sogar eine glatte Verleugnung und Idealisierung
von Seiten der Gutmenschen, zu glauben, Homosexualität sei nicht mehr
abgelehnt. Pädophilie wird
strafrechtlich verfolgt wie noch nie, und schon das ungefragte Berühren
einer Frau am Arm gilt als strafbarer sexueller
Übergriff. Bereits ein Verdacht
auf „sexuelle Gewalt“ genügt, jemanden für sechs Monate hinter Gitter
zu bringen (so Fall eines Meteorologen), und es gibt so gut wie keine Entschädigung.
Auch an seinem Freispruch gab es Kritik und Häme. In Schweden muss sich eine Frau auch hinterher (!) wohl fühlen. Ist dies nicht
der Fall, liegt Strafbarkeit vor. Einverständnis reicht nicht. Harmlose Baumpinkler
werden jetzt in manchen deutschen Städten mit Strafen von bis zu 600 Euro
belegt, dies gewiss nicht aus hygienischen Gründen, Hunde dürfen. Über Exhibitionisten
an Bahndämmen hat man früher hinweggesehen. Im Großen und Ganzen wird Sexualität
mehr denn je verfolgt, sodass auch eine ganz neue Sprache entstanden ist: Wörter
wie „Übergriffigkeit“, „Grenzüberschreitung“, „sexuelle
Gewalt“, „sexuelle Machtausübung“, „sexuelle Belästigung“ gab es
früher gar nicht, und von Vergewaltigung sprach man nur, wenn auch eine
vorlag, Vergewaltigung in der Ehe gab es als Begriff nicht. Auch in den
USA und den südamerikanischen Ländern geht es entgegen dem Gerede und der
bildhaften Freizügigkeit auf optischem Feld (Film, Fernsehen) umso prüder
zu, je mehr sich dort Psychoanalyse verbreitet hat. So ist FKK
verboten. Der Playboy hat sich
soeben für Züchtigkeit entschlossen, bildet in den USA keine nackten
Frauen mehr ab, neuerdings auch keine nackten Brüste. Die Zensoren sind es,
die gesiegt haben, nicht Freud. In Filmen werden dort in kleinlichster
Zensur regelmäßig schlechte Worte
und insbesondere Flüche streng aussortiert und durch einen Ton ersetzt,
oft mehrfach in einem Satz. So
werden selbst die Zuhörer und Zuschauer streng unter Kuratel gestellt, entmündigt,
geradezu zu Kindern gemacht, die solche Worte nicht hören sollen. Auch die
68ziger haben in dieser Hinsicht nichts von ihrem lautstarken Programm
erreicht, schon zu ihrer Zeit nicht. Als es den Tausch ihrer Freundinnen
angehen sollte, war Schluss. Auf der ganzen Welt sind- auch bei äußerst
prekären Verhältnissen- . Frauen- und Männertoiletten streng voneinander
getrennt, als ob das Wohl und Wehe der Menschheit davon abhinge - wehe, wenn sich einmal ein Mann auf eine Damentoilette verirrt, er
kann festgenommen werden, Entschuldigungen werden ihm nicht helfen. Eine
Ausstellung von Balthus im
Folkwangmuseum Essen wurde 2014 abgesetzt. Die Brüste sind im Alltagsleben
verhüllt, wenn dies auch noch andere Gründe hat, eine ganze Industrie lebt
davon. Nur verstohlen darf sich Sexualität zeigen: Im Busenausschnitt, in
den Falten der Jeans, die wie die Schnurrhaare einer Katze unübersehbar auf
den Punkt weisen. Der Mann darf anders als im angeblich prüden Mittelalter keinen Stock, keine Vorwölbung, zeigen, von der Brust darf die Frau
weniger zeigen als im Mittelalter. Öffentliche Badezuber, zu denen sich die
Frauen unbekleidet auf den Weg machten, für jeden Straßenzug, sind heute
im Ggs. zum Mittelalter undenkbar.
Und
in Afrika und Asien ist die Sexualität in großen Teilen unverändert
weniger eingeengt als bei uns, - ganz ohne Freud. Freud hat sich gründlich
verschätzt. Die Menschen hier fordern oft „ewiges Wegsperren“, ja die
Todesstrafe. Prostitution ist in zunehmendem Maße unter empfindliche
Strafen und Kuratel, dies nicht aus hygienischen Gründen, gestellt, in
Schweden und sogar in Frankreich ganz verboten.
Die
neuerliche Betonung von „multiplen
Sexualitäten“ mitsamt einer Flut von ausgebuchten Veranstaltungen und
Hochschulstellen (angeblich 199 neuen Professorinnenstellen allein im Jahr
2015) und einer schier endlosen,
kataloghaften (dies hat man doch immer der Psychiatrie vorgeworfen) Einteilung unserer Mitmenschen je nach ihrer sexuellen Orientierung,
als ob wir uns nicht mehr mit neurotischen Störungen, also Krankheiten, zu
beschäftigen hätten, haben die Funktion von Feigenblättern, um sich nicht mehr mit innerseelischen Konflikten befassen zu müssen
(weil dies zu anstrengend ist) und um die rigide
Strenge zu verdecken, - sie können nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir keineswegs „toleranter“ geworden sind, ganz im Gegenteil.
Besonders in den USA hat eine Hexenjagd auf vermeintliche sexuelle Gewaltausüber
auf dem Universitätsgelände (Campus)
eingesetzt. Verleumdeten Studenten half ein gerichtlicher Freispruch
nicht, sie wurden trotzdem als potentielle Störer betrachtet und durften
jahrelang die Universität nicht mehr betreten, wenn sie auch hinterher
erfolgreich dagegen prozessierten.
Studenten müssen sich nach ihren sexuellen Neigungen peinlichst ausfragen
lassen. Ein Film über den angeblichen „Hunting Ground“ der Universitäten
tat ein Übriges.
Vom
analytischen Standpunkt aus kann die übergroße Vorsicht und Rücksichtnahme
im Namen der Geschlechtergerechtigkeit gerade zur besonderen Abwehr
aggressiver Wünsche geführt haben, sodass
das Abgewehrte dann in Form einer quasi- paranoiden Weise (in Form einer
überwertigen Idee) zurückkehrt. Es
fehlt hier auch an einer
Strafbewehrung gegen Verleumder. Nicht reflektiert sind auch die Bevorzugung einer Opferrolle, besonders in demonstrativer Darstellung,
zugleich mit einem offensichtlich provozierendem Auftreten (so
neuerdings das massenhafte Auftreten in eng anliegenden Strumpfhosen, die
zugleich pädophile Regungen erwecken - „Kinderbeinchen“, und die vielen
Manipulationen am Mund in Richtung eines offenstehenden Kindermundes).
Für
den Leidensweg der Justizopfer oder
der Vorverurteilten interessiert sich niemand (s. auch Wormser Affäre,
achtziger Jahre, mit groben Fehlurteilen, Wegnahme der Kinder, Zerstörung
der Familien, ohne jede Wiedergutmachung).
Selbst
ein Meteorologe, der nach monatelanger Haft („Assangeisierung“) freigesprochen wurde, konnte nicht erreichen,
dass die Verleumderin bestraft wurde oder eine Entschädigung zahlen musste,
er musste weiterhin Häme in mancher Presse erdulden. In einem anderen Fall
wurde aber immerhin eine Lehrerin, die einen Lehrer mit einer erwiesen
falschen Beschuldigung (angebliche Vergewaltigung während der
Unterrichtspause, „gedinkelt“)
ins Gefängnis gebracht hatte, weil man ihr alles sofort glaubte, zur
Rechenschaft gezogen. Das natürliche Übergewicht der Frau in
Familienangelegenheiten wird dadurch verstärkt, dass dem Mann die
gesetzliche Macht durch rechtliche Gleichstellung genommen wurde. Keine Frau
wird festgenommen oder kommt gar ins Gefängnis, weil sie ihren Mann
geschlagen hat. Ethikplanstellen sind von Frauen besetzt. In Frankfurt gibt
es ca. 81 Frauenbeauftragte, keinen einzigen Männerbeauftragten. In den USA
wurde die Losung ausgegeben, den „Opfern“ sei unbedingt Glauben zu
schenken. Zweifel werden ziemlich regelmäßig als Einschüchterungsversuche
der Frauen beiseite geschoben. Soziologie, Pädagogik und Psychoanalyse
stehen bereit, dem „unterdrückten Geschlecht“ zur Seite zu stehen. Die
US-amerikanische Justiz ist besonders anfällig
für ideologische Ausrichtung, da sie sich nicht vom napoleonischen
Codex herleitet (in Anlehnung an Patrick Bahners, FAZ 23.12.15, S N 4), und
außerdem unter der puritanischen Tradition steht.
Das
Ende, also das Symptom, mit dem wir es jetzt zu tun haben, besteht darin,
dass „Missbrauch und Gewalt“
(„Missbrauch des Missbrauchs“) in aller Munde sind, obwohl diese
nachweislich weit weniger häufig sind als in früheren Zeiten. Dieses Phänomen
gilt es abwehranalytisch zu erklären.
In diesem Endergebnis sind die bekannten Konfliktkomponenten enthalten: 1)Wünsche,
einer Empörungsgemeinschaft, einer Gemeinschaft von Wutbürgern angehören
zu dürfen, wie es auch auf anderen Gebieten zu sehen ist („Gegen
Startbahn West, gegen Umbau des Bahnhofs Stuttgart“). Für einsame,
kontaktgestörte Personen ist die Gelegenheit ideal und einmalig, endlich
in einer Gemeinschaft Fuß zu fassen, die tägliche intensive Kontakte ermöglicht und sogar einfordert, gemeinsame
aggressive Aktionen erlaubt und ebenfalls fordert, zu denen sich sonst
keine Gelegenheiten ergeben, gemeinsam
Ängste vor dem gemeinsamen „Feind“ (die Polizei und der
angebliche Vergewaltiger oder „Übergriffige“) erleben zu dürfen, was
das Gemeinschaftserlebnis sehr
verstärkt („durch Angst zusammengeschweißt“), Schuld-und Schamgefühle
sowie Vergeltungsangst gemeinsam
abzuwehren. In den unzähligen, auch analytischen, Artikeln über
Missbrauch und Gewalt sowie „Geschlechterdifferenzen“ ist nie von den 2)
Einzelkomponenten (Wünsche, Ängste,
Schuld- und Schamgefühle, Abwehren)
des neurotischen Konflikts die Rede, namentlich auch nicht von Abwehr.
Auffallend häufig ist Abwehr durch Dramatisierung, Verleugnung,
Intellektualisierung, wenn es z.B. heißt: „Filmriss, Epidemie von
Vergewaltigungen auf dem Campus, Nötigung... wir haben uns die Verfolgung
von Missbrauch an Studentinnen zur Mission gemacht, es ist definitiv jeder fünften
Studentin passiert“, „wann Sex wirklich einvernehmlich ist: Eine
wissentliche, freiwillige und gegenseitige Entscheidung aller Beteiligten für
eine sexuelle Aktivität. dass das Einvernehmen auch unter Sexualpartnern in
einer festen Beziehung während des
Geschlechtsverkehrs bekräftigt
werden muss“ (eine weltfremde,
extrem sexualfeindliche, aggressive Verstiegenheit, Verf. ), „die
Flucht ergreifen oder um Hilfe zu rufen, obwohl
sich im selben Raum andere Studenten befinden, die Freundin dem Zugriff
eines Mannes entwinden.....was
ihr in der Stunde der Not widerfuhr, ihr angetan...Überlebende,
ich brauchte ein ganzes Jahr, um selbst an die Vergewaltigung zu glauben,
als Serienvergewaltiger anprangern, aus Protest gegen die Vergewaltigungen ein ganzes Jahr mit einer Matratze über den Campus laufen und sich
dafür feiern lassen und diese Tat als Magisterarbeit anerkannt zu
bekommen.. Peiniger, cockblocker, - eine Hetzjagd
auf junge Männer, um deren Karriere zu zerstören, auch nach
Freispruch, wie im Fall eines deutschen Studenten in den USA) (in Anlehnung
an A. Ross: Kein Sex ohne Yes, FAZ 23.1.2014.
An die Stelle von Freuds emanzipatorischen
Bestrebungen ist ein Neo-Puritanismus
von nie gekannter Rigorosität und eine oft feministisch getönte oder sich
feministisch gebende, aber heimlich misogyne, selbstanklägerische Dauerempörung
getreten, sowie ein Abgleiten in eine einfältige Opferideologie und in ein
bloßes Anprangern von sexueller
Kriminalität, als ob diese das einzige menschliche Problem wäre und nicht
andere Kriminalität weit schädigender wäre, und dies in unzähligen
nationalen und internationalen psychoanalytischen Veranstaltungen, Vorträgen,
Büchern und Zeitschriften und immer neuen hochdotierten Stellen in
Fachhochschulen und Universitäten (199 plötzliche Professorinnen), in
einem einzigen Trommelfeuer. Merkwürdig ist auch das Fehlen von Innehalten und Reflexion, etwa, was Einseitigkeit,
Pauschalität und Feindbildhaftigkeit angeht. Gemeinsam ist diesen Bemühungen,
dass sich niemand mehr die Mühe macht, nach Einzelkomponenten zu suchen.
Man ist weit hinter Freud zurückgefallen,
besonders, was sein Konfliktmodell angeht (Strukturmodell). Auch
hierin hat Freud rein gar nichts erreicht. Er wollte doch Freiheit von
Zwängen und Aufklärung unter die Menschen bringen, aber seine
– richtige - Botschaft ist nicht angekommen. Intoleranz, Fanatismus und
ein einfältiges, persekutorisches, sensationell aufgemachtes Täter-Opfer-
Modell des menschlichen Zusammenlebens haben die Oberhand gewonnen.
In einer Zeit, in der endlos
„Gewaltfreiheit“ gepredigt wird, kehrt das Abgewehrte, die allgegenwärtige
Aggressivität, auf ungeahnte Weise zurück (Wiederkehr des Abgewehrten,
unter willkommener Mitwirkung der Sensationspresse).
Erscheinungen wie Pornofilme, Swingerclubs,
Nacktbilder (die im Übrigen jetzt ebenfalls zunehmend eingeschränkt
werden) dienen als Feigenblatt für die tatsächliche Prüderie.
Der
Grund ist unschwer zu erraten: Freud
(und viele Analytiker auch heute noch, S 12) hatte in seiner offensichtlich
verheerenden Angst (Jung war darin wesentlich gelassener, Freud hatte
sich nie einer Analyse unterzogen, zu groß war seine Angst)
vor der Erwachsenensexualität und der Frau (unübersehbare misogyne Züge, so 1914: „..die kein Surrogat vertragen...nur zugänglich
für Suppenlogik und Knödelargumente“, Lit. bei Eickhoff 2001 und
Krill 2008, 52), - wenn er auch seine Kolleginnen auf intellektuellem Gebiet
anerkannte) nicht nur die infantile
Sexualität (mit Regressionspflicht und Erinnerungspflicht)
erfunden, zum Dogma erhoben und jeder Opposition gegen diese Konzeption eine
Abfuhr erteilt, indem er diese erbittert – und intellektualisierend - als
„Widerstand“ bekämpfte und diffamierte, sondern auch kontraphobisch die
Triebe direkt „befreien“ wollen, ohne
die Abwehr genügend zu bearbeiten, - nicht nur bei den Patienten,
sondern auch in der Gesellschaft nicht. Er hat sich nicht ausdauernd genug
und zu spät mit der von ihm und seiner Tochter Anna entdeckten Abwehr
befasst. Er hat, wenn überhaupt,
das Gegenteil seiner Absichten
erreicht, so auch eine allgemeine zwangshafte, zugleich compliancehafte, der
Empörungspresse nahestehende und von ihr profitierende Beschäftigung mit
der Sexualität („Jahrmarktseffekt“), die eher Züge einer Versklavung
als solche der Freiheit trägt und die geeignet ist, von inneren Konflikten
und deren Lösung abzulenken (so auch in der gebetsmühlenhaften Unterscheidung der Geschlechter, wo das
Geschlecht keine Rolle spielt). Darf
man eigentlich noch essen, trinken, radfahren, an Sportwettkämpfen
teilnehmen und auf die Toilette gehen?
Allerdings
treten andere Umstände hinzu: Die Sexualität unter Erwachsenen entschied
in der Evolution immerhin über die Zusammensetzung der nächsten
Generation, über Aufzucht, über Krankheiten, die man sich leicht unbemerkt
zuziehen konnte. Freud hat nicht erkannt oder jedenfalls unterschätzt, dass
Scham und Scheu deshalb tief verankert sein müssen und sich keineswegs
abschaffen lassen. Um Schuldgefühle und Ängste steht es hingegen
besser, sie sind tatsächlich einer analytischen Behandlung zugänglich.
Mit
dem Neo-Puritanismus und der Begeisterung
für die „verschiedenen Sexualitäten zeigt sich insgesamt, dass auch
Psychoanalyse vom Zeitgeist nicht
verschont bleibt und auch hierdurch von
ihrer therapeutischen Aufgabe abgekommen ist. Sie hat sich immer wieder
für außeranalytische Ziele in Dienst nehmen lassen („Kinderläden“,
mit deren schrecklichen Folgen, nach Vera Schmidt bis 1925, dann wieder nach
H.E. Richter ab 1970).
Nicht
weit entfernt vom Begriff „Sexualität“ stehen die Begriffe „Perversion“ und „polymorph-pervers“ (so
S 35: „infantil polymorph-pervers“), die häufig im Buch wie vorgestanzt
und klischeehaft, routinehaft auftauchen. „Pervers“ reicht nicht,
„polymporph-pervers“ klingt
besser, es gab auch schon den Ausdruck „zentral-pervers“ (DPV-
Mitteilungen ca. 2012), - der wollte ganz sicher gehen und es besonders gründlich ausgedrückt
haben, eine optimale Lösung wäre wohl „zentral-polymorph-pervers“.
Das Polymorphe ist aber nicht dargestellt (und das „Zentrale“ auch
nicht). Wäre nicht besser „monomorph“ statt polymorph? Nach Darstellung
des Autors ist Perversion gerade durch die Konzentration, auf die
Alleinherrschaft einer ganz bestimmten Art von Triebbefriedigung
gekennzeichnet. Im Fetischisten geht nichts ohne seinen Fetisch, im
Exhibitionisten nichts ohne Exhibition.
Benötigen
wir heute noch diese Begriffe? Haben wir sie jemals benötigt? Dies kann
sein, aber nicht dies ist der Punkt, sondern, dass
sie gebraucht werden, weil sie bloß imitativ übernommen werden, nicht
aufgrund eigener Nachprüfung und Beurteilung, also unakademisch, und mit dem erkennbaren Ziel, sich nicht mit der Psychodynamik beschäftigen
zu müssen.
Diese
Etikettierungen erklären
nichts, sondern verhindern das Verstehen. Sie.verdecken nur die inneren Konflikte, um
die es geht. Sie verhindern das Nachdenken und Nachforschen um die innere
Welt. Das Etikett als Feigenblatt. Motiv ist Bequemlichkeit. Vielen
Analytikern ist es zu mühsam, sich um die Psychodynamik zu kümmern.
Statt
sich Gedanken darum zu machen, ob ein Verhalten als „Perversion“ oder
nicht einzuordnen sei, sollte man sich mit dem befassen, was im Patienten
(und im Analytiker) innerlich abläuft. Dies ist freilich anstrengend.
Etikettierungen
hat die Psychoanalyse immer – zu Unrecht – der Psychiatrie vorgeworfen
und „tieferes“ Verstehen für sich in Anspruch genommen.
Aber
auf lange Sicht siegt immer erneut die Bequemlichkeit. Gerade das Wort
„polymorph-pervers“ ist eine typische, gestanzte, gedankenlose Zwei- Wörter-
Floskel, die ihre Verbreitung nur der Suggestion verdankt. „Pervers“
reicht anscheinend nicht, eindrucksvoller klingt es mit dem Zusatz
„polymorph“, als Fertiggericht, das man zu verzehren habe.
Welchen
Sinn soll es haben, Kinder (auch Erwachsene) hiermit durchweg zu
pathologisieren? Das Wort hat jetzt Konkurrenz erhalten von unzähligen
weiteren festen Wörterkombinationen, so gender mainstreaming. Freud hat
damit begonnen, der Kleinianismus hat dies fortgesetzt („Paranoid-
halluzinatorisch“) und ganze Kontinente haben diese suggestiven Doppel- Wörter
gedankenlos nachgesprochen. Sie haben sich nicht verbreitet, weil sie den
Sachverhalt treffen würden, sondern weil sie suggestiv sind.
Immerhin
liefert der Autor dann doch noch (S 64) eine brauchbare Definition für
„pervers“: Eingeschränkte, im Grunde nicht vorhandene Spielfähigkeit....
Unfähigkeit zu tolerierter Ungewissheit.. über das Sexuelle hinaus
allgemein auf die Objektbeziehungen, auf das Denken und die Verarbeitung von
Emotionen...frühe Störung in der Mutterbeziehung (womit der Autor dann
sogleich die Standard- Erklärung anfügt, - da
ist sie wieder, die beliebte böse
Standard-Mutter (Verf.
hier), wie früher einmal die double- bind -Mutter, die schuld an der
schizophrenen Psychose ihrer Kinder sein sollte, - jetzt
hat sie nicht richtig gespiegelt und ist dadurch schuld an der Erkrankung
des Patienten. Fonagy mit seinen kümmerlichen, laienhaften
Falldarstellungen, die nicht das zeigen, was er mit diesen zeigen möchte, lässt
grüßen. Es wird nicht lange dauern, bis man ein anderes Versagen der
Mutter als Ursache psychischer Erkrankungen ausmachen wird. Ein Schelm, wer
hier einen vertrackten Antifeminismus vermutet.
Übrigens
endlich ein Autor, der, wenigstens einmal, – korrekt – schreibt:
„Psychotischer Persönlichkeits- Anteil im
Bionschen Sinn.“
Besonderen
Wert legt der Autor auch auf die sog. Frankfurter
Schule mit den Konzept von der Szene
(S 11), das sich international nicht durchgesetzt hat und sich manche Einwände
gefallen lassen muss, - die schlimmsten, aber nicht die einzigen, sind die
der Überflüssigkeit und des
uneingelösten Anspruchs auf diagnostischen und therapeutischen Erfolg)
nach Lorenzer und Argelander. Der im Buch öfters verwandte Begriff „Szenario“
und „Protagonisten“ (S 12)
ist nicht besser, im Gegenteil, unbedacht klingt hier die andere Welt des
Theaters, der Weltbühne, an die man sich zwecks besserer Akzeptanz anhängen
möchte, und des Theatralischen, des Aufmerksamkeit Heischenden, des großartigen
Scheins an.
Ebenso
sind die beiden Teilnehmer keine Vorkämpfer,
keine Darsteller, keine Haupt- „Figuren“ („Protagonisten“)
wie etwa in einem Film, es
wird nicht eine Schau abgezogen, wenn wir unsere Arbeit machen.
Wir
benötigen keine solchen Anlehnungen an die Theaterwelt, wir haben uns mit
den beiden Innenwelten und
ihrem Einfluss aufeinander zu befassen und allenfalls damit, wie diese sich
uns zeigen. Wir möchten nicht
inszeniertes, sondern tatsächliches Leben untersuchen. Es handelt sich
auch nicht um irgendwelche aus dem Off hereintönende Erzählungen oder aus
dem Off auf die Bühne geschobene Verstorbene, auch nicht um ein
Puppenspiel.
Auch
die Patienten suchen uns nicht auf, um eine Theatervorstellung zu geben oder
zu sehen, auch wenn dies unterläuft. Aber es ist nicht ihre Motivation zur
Behandlung, und es ist auch nicht unsere. Weder der Patient will eine
„Figur“ sein noch der Analytiker.
In
seinem „abschließenden Plädoyer für das
szenisch-sinnliche Verstehen, Fazit“ (S
188-189, meint er hier „szenisch“ oder will er hiermit das Körperliche
einseitig betonen?) fasst der Autor noch einmal das komplizierte Thema
meisterhaft zusammen, verweist aber zur Begründung des Begriffs „Szene“
auf die „analytische Gruppe“ und auf die „Verständigung unter Kollegen“, auf Veröffentlichung und die Ausbildung (jeweils S 189).
Dies
bestätigt den Verdacht, dass es um außeranalytische
(i.S. von außerhalb der Behandlung liegende) Ziele geht, von denen der Autor doch gerade Abstand halten wollte,
ja, die gerade er an anderer Stelle als unzulässige Außeneinflüsse geißelt.
Die
„Szene“ wird also zur
Demonstration, um nicht zu sagen, zum Beeindrucken, gebraucht, nicht für
die Analyse selbst. Eine „Szene“ also für Zuschauer und den Analytiker,
nicht zugunsten des Patienten, darin also theaterhaft, showgeschäftig..
Wir
arbeiten jedenfalls nicht mit Theater- oder Filmeffekten, nicht mit
Fiktionen, sondern mit innerseelischen Abläufen. Es ist ein großes
Missverständnis, in der Theaterwelt eine Welt der Psychologie oder gar der
Psychoanalyse zu sehen. Sie ist eine eigene Welt. Soll Strindberg ein
Ehetherapeut gewesen sein? Theater war nie Abbild des Psychischen. Weder der
Analytiker noch sein Patient sind Schauspieler, Regisseure, Bühnenbildner,
Beleuchter, Kameramänner oder Puppen in einem Puppentheater.
Psychoanalytiker sind auch nicht etwa mit einem Netzwerk aus der Theaterwelt
vernetzt. Vielleicht möchten sie dies sein, aber sie sind es nicht, auch
nicht mit Schauspielern, Bühnenarbeitern, Regisseuren, Beleuchtern, Kameramännern,
haben auch mit Puppen nichts am Hals.
Aber
selbst für die Zuschauer dürfte der Begriff „Szene“ überflüssig,
sogar eher irritierend sein, weil er etwas Unseriöses, Flatterhaftes
ausstrahlt. Die Aura eines Wortes
(„Szenen einer Ehe“, „Scener ur ett äktenskap, Ingmar Bergmann 1973,
„Bettszenen“) ist nicht zu vernachlässigen. Den Sprachgebrauch zu
missachten, ist ein narzisstisches, selbstgefälliges Erbe Melanie Kleins
und nur eine Belastung für uns selbst, auch für unser Ansehen. Auch die
Zuschauer möchten nur erfahren, was sich in der Analyse in den Innenwelten
abspielt. An „Szenen“ ist niemand
interessiert. Das Wort
„Gesamtgeschehen“ (Verf. hier) etwa hätte es auch getan.
Auch
in diesem Schlusswort kann sich der Autor nicht von seiner (und vieler
Anderer) Fixierung an das Modell der Infantilität lösen (S 189:
„leibliche infantile Beziehungsmatrix“).
Das,
was der Autor sagen will, wäre auch nicht weniger gesagt ohne dieses
Konzept von der Szene, und anders, als der Autor schreibt (S11), ist das
Konzept von der Szene durchaus nicht „zentral“. Der Grund ist ganz
einfach: Es ist schlicht entbehrlich.
Hier
wie an anderen Stellen kann sich der Leser nicht des Eindrucks erwehren,
dass Haustradition bemüht wird, wo es ebenso gut oder besser ohne diese
ginge. Vielleicht stehen diese Verbeugungen
vor der Verdiensten des Hauses eher den Intentionen des Autors unbemerkt
entgegen und sind eher ein Hemmschuh, ein Ballast, für sein sonst
scharfsinniges Denken, - dieses übrigens zuweilen zu Intellektualisierungen
und Rhetorik abfallend.
Dankbarkeitsrituale
oder solches, was an diese erinnern kann („wo ich meine Ausbildung
machte“, - und was wäre, wenn er sie woanders gemacht hätte?), helfen
nicht weiter, da sie nicht argumentativ sein können, vielmehr auf
das Fehlen einer Argumentation hinweisen.
Das
erklärte Ziel (S.10) ist es, Unbewusstes
auch in der Verknüpfung mit Sinnlich- Leibhaftem, in sich und im Patienten,
zu erfassen. Der Autor ist sich der Schwierigkeiten bewusst - und widmet
sich ihnen ausführlich -, dies wenigstens ab und an in einer Analysestunde
zu leisten. Der Autor betont mit Recht hier die Gefahr, dass Erleben des
Leiblichen - in sich und im Patienten - leicht durch bloße Vorstellungen
davon und Denken darüber („Denken über“,
S 10), also durch Abwehr des körperlichen, „sinnlichen“ Erlebens in
Form von Intellektualisierungen
(Verf.) verhindert wird oder verlorengehen kann.
Der
Autor lässt hier wiederum eine gewisse Phobie
erkennen, diese Abwehrform zu nennen, er belässt es bei „Denken über“.
Warum darf denn der wichtige Begriff
„Abwehr“ beim Autor so gar nicht mehr auftauchen? Handelt es sich
hier um bloße Anpassung an das gegenwärtige Ausbildungsinstitut, an die
Sprache Klüwers oder liegen andere Gründe / Motive vor? Leben wir jetzt in
einer abwehrlosen analytischen Welt?
Wo ist denn hier der Respekt vor der Tradition?
Die
Vernachlässigung des Begriffs der Abwehr ist umso bedauerlicher, als Intellektualisierungen
in der psychoanalytischen Tätigkeit ohnehin ständig drohen. Es handelt
sich um die bekannte, vielbeklagte
und beklagenswerte Berufskrankheit der Psychoanalytiker, die besondere
Aufmerksamkeit verdient.
Eine
Gesamtwahrnehmung mitsamt der leiblichen Dimension, auch der gegenseitigen Rückwirkungen
(Reflexivität),
die wir pauschal und unbewusst, auch bewusst, verwerten konnten, hatten wir immer schon. Der Autor versucht aber
mit Erfolg, von der Pauschalität wegzukommen und zu einer detaillierten
Betrachtung zu kommen.
Bei
dem Versuch der gesonderten
Verwertung können wir aber auch
überfordert sein, sogar dem Tausendfüßler-
Problem erliegen.
Es
ist, wie erwähnt, schwer verständlich, warum der Autor manchmal zwar
Abwehren richtig beschreibt, sie aber nicht als solche benennt, wie etwa
Vermeidung, Intellektualisierung, ebenso warum er Regression
nicht als Abwehr im Patienten beschreibt, sondern nur als wünschenswerten
Zustand im Patienten, der eine Therapie von Grund auf ermöglichen soll und
mit dem der Patient am besten schon in die Therapie eintritt, - nach
Renik eine naive, sentimentale, romantische Vorstellung, von den
„tiefsten Tiefen“ aus, gleichsam aus dem Samenkorn, ein Seelenleben
wieder „aufbauen“ oder erstmals aufbauen zu wollen.
Wie
ausgeprägt die Abneigung des
Autors gegen die Abwehranalyse und deren Terminologie ist, zeigt auch in anderen Äußerungen, so auf
S 94: „.anders als bei den Neurosen (die im Verständnis des Autors
offenbar späte Störungen sind), wo die das Missverstehen des Patienten
strukturierende Absicht als unbewusste Sinnfigur in Gestalt einer sich
konturierenden dramatischen Szene (da ist sie, die Szene, wieder, Anm. des
Verf.) greifbar wird.“
Nur
nicht von Abwehr schreiben,
etwa in Form von Negation, Identifizierung mit dem Aggressor Analytiker,
Wendung gegen die eigene Person (Selbstschädigung des Patienten),
beiderseitiger Vermeidung (vom neurotischen Konflikt zu sprechen), aber auch
nicht in Form sog. „archaischer“, „früher“, „primitiver“
Abwehrformen. Hier kann der Leser explizit erkennen, wozu eine
intellektualisierende Sprache einschließlich fleißigen Zitierens von
Begriffen wie „Szene“, „Sinnfigur“ und „dramatisch“ dienen muss,
nämlich zur Ablenkung von unseren Aufgaben, einen inneren,
symptomrelevanten Konflikt zu lösen. Wir
benötigen keine „dramatischen Szenen“, keine „Sinnfiguren“ (ein
literarischer Terminus) und keine
„strukturierenden Absichten“ und auch keine verquasten Sätze, und wir befinden uns nicht in der Theater- und Filmwelt, es geht nicht um Bühneneffekte,
sondern um Motive wie Ängste,
Schuld- und Schamgefühle und deren Abwehr, um die inneren Konflikte eines
Patienten zu verstehen.
Der
Autor hält sich in seiner Nomenklatur an die Objektpsychologie, einschließlich
Kleinianismus. Aber auch von
kleinianisch-objektpsychologischen Abwehrformen ist wenig zu lesen.
Wie
kommt das?
Hat
hier ein Institut einen hemmenden Einfluss genommen? Auch eine Lehre von den
„unbewussten Phantasien“ (Klüwer),
die nach dem topographischen Modell zu entdecken seien, aber nicht aufgeschlüsselt
werden , etwa nach Trieben / Wünschen, Ängsten, depressiven Reaktionen auf
einen eingetretenen Verlust, Schuld - und Schamgefühlen, eingesetzten
Abwehren?
Ist
hier das Vorbild Klüwer? Glaubt der Autor, mit der bloßen
Aufdeckung unbewusster unangenehmer Affekte oder sogar bloßer „Phantasien“
ohne Interesse an unbewussten Motiven, womöglich, indem man den Patienten auf diese
hinweist (sind dies analytische „Deutungen“
oder nur sog. Material-Deutungen, diese dann auch meist ohne Berücksichtigung
der Übertragungen und Gegenübertragungen auf beiden Seiten)?), einen
Patienten behandeln zu können, - ohne Bearbeitung der stets wachen Abwehr
und ohne aktive Mitarbeit des Patienten selbst? Der Analytiker als Gutsherr
der Deutungen? Als Angler nach dem „Unbewussten“? Ist
Konfliktpsychologie begraben, hat man die Strukturtheorie aufgegeben?
Haben
ausgerechnet Frühe Störungen
oder solche, von denen man, oft leichtfertig, solches behauptet,
und Traumen keine inneren Konflikte, namentlich auch keine Abwehren? Wie
könnte dies sein?
Wer
soll mit welchen Mitteln diese Störungen von inneren Konflikten für alle
Zeiten befreit, gegen diese immun gemacht haben?
Die
Modeströmungen wollen es so, und sie bestimmen die Themen auf Kongressen,
Tagungen, Seminaren, in Ausbildungsinstituten. Die Themen sind von
vorneherein so formuliert, dass Erörterung von inneren Konflikten nicht in
Frage kommt.
Der
Autor hat aber immerhin doch noch ein Herz auch für die Konfliktpsychologie
(S 20-21), wenn er schreibt: „...nach wie vor große Fruchtbarkeit ...der
psychoanalytischen... Konflikttheorie, der Spannung zwischen Lust und
Hemmung..“ Aber er vernachlässigt sie.
Abwehranalyse
hat den Vorteil, dass sie sich nicht mit allen psychischen Vorgängen, etwa
mit „dem Innersten“ oder mit irgendwelchen – tatsächlichen oder
vermeintlichen- „Phantasien“ oder „Grundphantasien“(so Klüwer) zu
befassen hat. Sie sieht nach solchen, die konflikt–
und somit symptomrelevant sind und somit die Entwicklung stören. Es
wird zu wenig danach unterschieden, namentlich wird zu wenig nach gesund und
krank unterschieden, auch, weil man dies nie in der Ausbildung erlernt hat,
namentlich auch nicht in einem bloßen Psychologiestudium die Gelegenheit
dazu hatte, andererseits auch willkürlich pathologisierte, ohne einen
Abgleich mit dem Alltags- und Normalleben vorzunehmen, was die gleichen Gründe
hat. Wir müssen uns keineswegs mit allen Phantasien befassen. Es hat keinen
Sinn, allem die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen. Die Forderung nach
„gleichschwebender Aufmerksamkeit“ ist nicht nur illusorisch, weil es
eine solche nicht geben kann (Lit. dazu gibt es genug), sondern sie schadet
auch, indem sie zu unterschiedslosem Drauflosanalysieren verleitet, in der
Regel auch unter Missachtung der Übertragungen und Gegenübertragungen, und
wegen der notorischen Ablenkung vom Wesentlichen unnötig Langzeitanalysen
nach sich ziehen muss..
Ein
Beispiel: Ein 26j. Mechaniker bringt (eine leibliche
Handlung) eine Zeichnung mit in die Stunde und trägt dem Analytiker auf (!
ebenfalls eine leibliche Handlung), sie zu deuten. In der Gruppensupervision
wurde nun gerätselt über die Bedeutung dieser Zeichnung, statt darauf zu
sehen, was es bedeutet, dass der Patient dem Analytiker einen Auftrag
erteilt. Das war mehr sog. „Materialanalyse.“(„ist das eine Brust? Ist
das ein Hintern? Sind das zwei Welten? Ist das eine Scheide? Ist das Kot?
Meint er damit seine Mutterbeziehung? Oder beide Eltern?“, und ähnliches
„Angeln“ nach dem Unbewussten, Wühlen in Einzelheiten des Materials,
willkürliches Spekulieren damit, unter Missachtung der Übertragung/Gegenübertragungssituation)
Selbstverständlich wollte der Patient mit seiner Zeichnung auch etwas in
der Übertragung sagen. Aber die leibliche Handlung als solche war zuerst
und direkter als übergeordnete Übertragungshandlung zu analysieren (hier
z.B. als Versuch, die Initiative an sich zu reißen und den Analytiker zum
Zuschauer und Empfänger zu machen. den Analytiker zum Schüler zu machen
und ihn eine Aufgabe lösen zu lassen, und sich selbst zum zensurgebenden
Lehrer hochzustilisieren. Es handelte sich um einen Patienten, der seine Wünsche
nach Überlegenheit nur nach und nach demonstrierte, die meisten davon noch
in petto wie Pfeile im Köcher hielt. Ein analytisches Vorgehen wäre
gewesen, die Bedeutung dieser
Handlung zu analysieren, etwa „Sie können mir diese Zeichnung
mitbringen, aber es fällt Ihnen schwer, zu sagen, was in Ihrem Kopf dabei
vorgeht“... „wie sich dabei
fühlen“. Wenn der Patient
dann sagt, der Analytiker wisse doch mehr und solle sagen, was er davon hält,
wäre meine Antwort: „Das mag sein, dass ich etwas mehr weiß, aber auf
meinen Kopf kommt es nicht an, sondern auf Ihren, und es würde Ihnen wenig
nutzen, wenn ich Ihnen sagen würde, was in meinem Kopf vorgeht. (Erst im
Nachhinein bemerke ich, dass ich – nicht zufällig - von
meinem und seinem Körper spreche). Sie haben es in Ihrem Kopf und können
selbst darauf kommen.
Hiermit
würde die Abwehr seiner inneren Motive (wohl, die Handlungsinitiative zu
erreichen, nach Überlegenheit, vor allem auch des „verbotenen“ Genusses
daran ((besonders streng dieser abgewehrt, denn Überlegenheit allein ist
wenig, aber der Genuss daran viel)), an seiner Überlegenheit oder
phantasierten Überlegenheit)) in Form von Vermeidung, über diese zu
sprechen, und durch Verschiebung auf ein Blatt Papier, beides in der Übertragung,
gedeutet und der Patient auf seine eigene Fähigkeit, seine Abwehr zu
erkennen und danach selbst auf seine Motive zu kommen, verwiesen.
Er
bekommt das nicht vorgekaut. Der Selbsterwerb zählt.
Auch
die Gegenübertragung wäre hier zu beachten: Der Analytiker muss sich doch
wie ein Schüler behandelt gefühlt haben. (Deutung wäre evtl.: „Es liegt
Ihnen daran, mein Lehrer zu sein, aber es fällt Ihnen nicht leicht, darüber
zu sprechen und auch nicht, warum Ihnen dies wichtig ist. Sie können es einstweilen nur durch diese Handlung sagen... es fällt
Ihnen schwer, von Ihrem Genuss dabei zu sprechen“). Es geht dem
Patientin hier ersichtlich um intensive Wünsche nach Überlegenheit und
deren Genuss, sowie um deren Demonstration und um Ängste, sich diese nicht
erfüllen zu können, vermutlich auch um Vergeltungsängste für diese
„verbotenen“ Wünsche“.
Mit
meinen Abwehrdeutungen wäre ich hier
immerhin an der Leiblichkeit geblieben. Ich möchte zeigen, wie
nutzbringend konsequente Abwehranalyse auch für leibliche Äußerungen
(Papier mit Zeichnung ausgehändigt) in der Übertragung und Gegenübertragung
sein kann.
Die
konzentrierte Behandlung von inneren Konflikten ist übrigens auch der
Auftrag des
Patienten und seiner Versicherung. Wir sind damit keineswegs unterbeschäftigt.
Im Gegenteil haben wir Mühe, dies zu leisten, und können uns freuen, wenn
dies uns wenigstens teilweise gelungen ist.
Hingegen
ist häufig das Fingerspitzengefühl für die wichtige Unterscheidung von Pathologie und Gesundheit zu vermissen, oft auch
die dazu notwendige systematische Überlegung. Das „Material“
(nonverbales und verbales) wird statt dessen nicht nach Rang gesichtet,
sondern unterschiedslos als angeblich gleichrangig entgegengenommen, im
Sinne einer angeblich gleichschwebenden Aufmerksamkeit. Eine solche ist zum
Glück gar nicht erreichbar, denn sie würde einer Konzentration auf den zu
behandelnden Konflikt entgegenstehen.
Die
unbewussten Phantasien bds. und die leiblichen Botschaften bds. „verführen
sich gegenseitig“. Die Anspielung auf Sexualität („Verführung“) ist
irreführend und überflüssig. Es wird ja so z.B. auch Aggressives oder
Anderes mitgeteilt. Hier wäre auch mehr Genauigkeit gefordert.
Welche
„Phantasien“ sind gemeint? D
i e Phantasie gibt es nicht, und
wir brauchen sie auch nicht. Wir benötigen den Blick auf Abwehrformen, auf
Ängste, Schuld- und Schamgefühle und depressive Stimmung nach Verlust, und
zwar solche, die symptomrelevant sind.
Was
versteht der Autor unter Deutung? Offenbar nur
die Versprachlichung (S 12-14) des
„Geschehenen“. Was aber ist das „Geschehen“? Es handelt sich hier um
doch zu allgemeine Aussagen, - eine Präzisierung wie in der Abwehranalyse
ist offenbar nicht beabsichtigt.
Eine
bloß sprachliche Darstellung des sprachlichen Dialogs, des Handlungsdialogs
(Klüwer), der Role- Responsivness (Sandler), des Enactment (Jacobs) (etwa,
hier nicht vom Autor, sondern vom Verfasser:
„Sie entwickeln Angst bei dieser Vorstellung“, „Sie haben viel Angst
vor Ihrem Vater gehabt“, „Sie sind heute wieder besonders zugeknöpft“,
„Eben haben Sie sehr bewegt gesprochen“, „Eben haben Sie eine Unruhe
gezeigt“.. „genickt“, „sind Sie sich mit der Hand in die Haare
gefahren“ „Vorhin hatten Sie geweint“.. „Ihr Tonfall mir gegenüber
war jetzt aber ...“) ist noch keine Deutung im analytischen Sinne, sondern
nur Begleitung, Kommentierung.
Hier
handelt es sich um Wiederholungen von Geschehenem oder Gesagtem, oft mit
etwas anderen Worten, als ob damit schon etwas gewonnen wäre. Das Vorgehen
erinnert an das Nachplappern von Wörtern und Sätzen oder Nachführen von
Gesten eines Kindes durch seine Mutter. Fonagy („Mentalisierung“) lässt
grüßen. Neben der traditionellen Überschätzung
der Versprachlichung steht das Regressionskonzept
auch hier Pate. Die Erwachsenen werden behandelt wie Kleinkinder, aber
selbst diese wären damit nicht gut behandelt. Auch ein Kleinkind wünscht
keine Regression, sondern die Progression
Bei
dieser Gelegenheit ein
Wort zum analytischen Vorgehen (in
analytischer Tradition unglücklich „Technik“ genannt und damit eine Präzision
vorgebend, die nicht besteht).
Diese
ist beim Autor ersichtlich sehr eingreifend:
„...“den Patienten mit Argumenten und Richtigstellungen zu widerlegen (S
98)“. Dies kann nur in Ausnahmesituationen richtig sein. Analyse ist kein
Debattierklub, und der Analytiker hat nichts zu widerlegen. Der Patient soll
selbst darauf kommen, was Sache in ihm ist.
Warum
sollte der Analytiker „unerreichbar“ für den Patienten sein (S 99)?
Warum sollte ein Patient in der Analyse „in die Isolation getrieben“
werden (S 99)?
Warum
sollte der Analytiker „unter Druck geraten, mehr Wissen vorzugeben, als er
hat (S 99)?“.
Warum
sollte der Analytiker „in komplementärer Gegenübertragungsidentifikation
das Nichtwissen mit dem Tod des Analysierens gleichsetzen“ (S 99). Kann
das Analysieren sterben? Ist es ein eigenes Wesen mit Geburt und Tod oder
ist Analysieren die Tätigkeit des Analytikers?
Warum sollten „Versäumnisse und Fehler
des Analytikers über längere Zeit“(die nie zu vermeiden sind, und dies
weiß auch der Patient) eine „unvorstellbare und unverzeihliche
Katastrophe“ sein (S 99)?
Überschätzt
sich hier nicht der Analytiker dramatisierend in seiner Fähigkeit, Schaden
anzurichten, wie sonst im Allgemeinen, einen „tief gestörten“ Patienten
„zu retten“?
Der
Autor wendet anscheinend keine Abwehranalyse an. Bei dieser kann der Patient
selbst sein Ängste, Schuld- und Schamgefühle herausfinden, nachdem ihm
seine Abwehr gedeutet wurde. Ihm muss der Analytiker keineswegs sagen, nahe
legen oder ihm gar vorschreiben, was er fühlt, wovor er Angst hat und wofür
er Schuld- und Schamgefühle hat.
Der
Analytiker muss ihn nicht behandeln,
als ob er ein Kind sei, und ihm alles „vorkauen“, sondern kann seine
Mitarbeit als die eines Erwachsenen einfordern (was der Patient auch gern
erfüllt), indem der Patient selbst auf seine Abwehr und das Abgewehrte
achten kann. Und dazu braucht man keineswegs Langzeitanalysen.
Die
oben aufgeführten unguten Entwicklungen kommen nur dadurch zustande, dass
der Analytiker sich wie eine Helikopter- Mutter viel zu sehr abmüht und dem
Patienten alles „vorkauen“ will und sich dabei womöglich noch auf seine
Einfühlung beruft (und diese allzu gern seinen Kollegen demonstrieren möchte),
statt große Teile der Arbeit getrost dem Patienten zu überlassen.
Die
beklagte Klagsamkeit des Patienten soll „ein gefährliches destruktives
Potential des Patienten binden, das sich sonst in einer tödlichen
Erkrankung oder einem Unfall...“? Derart beunruhigen muss sich ein
Analytiker gewiss nicht. Gründlichkeit
und Gewissenhaftigkeit werden hier mit Dramatisierung verwechselt und durch
diese konterkariert.
In
seinen spezielleren Ausführungen ist der Autor nicht immer klar verständlich,
so auf S 15, wo es heißt: „Das Erleben von Bedeutung und Sinn gruppiert
sich vorwiegend um die Empfindungen von Spannung und Entspannung, der
inneren Gliederung sinnlicher Ereignisse, um Prozesskonturen und
Bewegungselementen, in denen die sinnliche Umwelt mit dem Körper- und
Affekterleben verknüpft wird.“
Sich
gruppieren? Gliederung? Konturen? Elemente?
Weiter
heißt es: „Die Beziehungsebene ist
archaisch, Subjekt und Objekt sind nicht getrennt“.
Dies
ist wenig wahrscheinlich, um es milde zu sagen. Bei den beiden Teilnehmern
handelt es sich um Erwachsene, und sie behalten auch ihre normalen
Funktionen. Eine Regression bis zur
Auflösung der Subjekt-Objektgrenzen, die immer wieder leichtfertig,
lehrbuchhaft, behauptet wird, kann
gar nicht stattfinden, und wenn sie sich noch so sehr „entspannen“,
etwa auch noch so sehr auf ihre leiblichen Vorgänge achten.
Der
Autor hängt offenbar der verbreiteten Auffassung an, als sei der
Ausbildungskandidat ein Instrument, auf dem man nach Belieben spielen kann
und das dann die Töne von sich
geben wird, die man wünscht, -in Wirklichkeit lernt der Lehranalytiker erst
am Ende dieses „Instrument“ kennen, - als sei Erwachsenen alles möglich, wenn es nur
der Analytiker, der Schreibtisch und die Lehrbücher im endlosen „race
back“ (Shapiro 1981) so wünschen und so konstruieren.
Hier sollen wohl die „Machenschaften“
Heideggers walten.
Es
ist unbekümmerter, psychoanalytischer Brauch, hierbei keine Rücksicht auf
klinische Befunde zu nehmen, die Anderes besagen. Freie Fahrt für den
freien Theoretiker.
Patient
wie Analytiker haben gefälligst, wenn die Analyse „gut läuft“, keine
Selbst-Objektgrenzen zu haben, denn die Theorie von der Regression verlangt
es so. Es
ist wie im Schneiderwitz: Der Kunde hat die Figur zu haben, für die der
Anzug gemacht ist, - andernfalls muss er eben seine Figur ändern. Das Pferd
hat die Hufe zu tragen, die der Schmied angefertigt hat, und nicht die,
welche ihm passen, und muss dann eben seine Gangart ändern oder das Gehen
ganz lassen und schwimmen gehen.
Nicht
einmal ein manifest Schizophrener hat einen Verlust der Objekt-
Subjektgrenzen aufzuweisen, außer vielleicht für Momente im winzigen
Wahnbereich, und auch hier nur teilweise. Wenn ein Schizophrener Stimmen aus
dem Nebenzimmer hört, öffnet er die Tür nicht, - weil er doch weiß, dass
diese Stimmen nicht real sind. Wenn er anklagende Stimmen aus seinem Bein hört,
schlägt er nicht auf sein Bein ein. Er weiß immer, wer er ist und wer der
Andere ist, wie die Aufgabenverteilung ist, was er denkt und fühlt und was
der Andere ungefähr denkt und fühlt. Es handelt sich um eine allseits unter Psychoanalytikern ohne psychiatrische Ausbildung beliebte Floskel
ohne klinische Belege, ein willkürliches psychoanalytisches Postulat,
ein Produkt letztlich des Glaubens an
eine beliebige Formbarkeit des Menschen zu einer „Regression“ unter der
Einwirkung der Analyse. So mächtig
ist aber Psychoanalyse keinesfalls, - wie sie auch entgegen verbreitetem
Glauben und Reden nicht in der Lage ist, eine echte schizophrene Psychose
auszulösen.
Hier
handelt es sich um Machtwünsche und
um Idealisierungen der Psychoanalyse ins Großartige hinein, ins Gute wie
ins Böse (fast eine Dämonisierung).
Diese
sind es, die dazu geführt haben, dass nicht nur außerordentliche,
lebensfremde Heilserwartungen (die dann enttäuschen mussten) Fuß fassen
konnten, sondern auch übertriebene Vorstellungen von Schäden, die sie - außer
natürlich dem Verlust an Lebenszeit, besonders der „childbearing years“
(Wohlberg), auch einer
Verunsicherung oder einer zunehmenden Intellektualisierung - , anrichten könne.
Viele
pauschale Behauptungen der heutigen Psychoanalyse ohne klinische Belege
erinnern an mittelalterliche Scholastik. So stritt man sich in einem Kloster
generations-übergreifend, wieviel Zähne ein Pferd haben möge, nur
hineinschauen ins Maul wollte niemand außer schließlich einem Novizen, -
der dann mit seinem Anliegen grob abgewiesen wurde.
Der
Autor bleibt denn auch den Beweis für
eine Aufhebung der Selbst-Objektgrenzen (so im Fall: Ich verrätsele
mich immer- da, wo ich spreche, bin ich nichts, S 67 ff, ferner S 83:
„Selbst-Objekt- Abgrenzung fließend“)
schuldig.
Dieser
Beweis ist klinisch zu führen, nicht deduktiv aus einer Theorie, die
solches fordert. Aber der Autor verbleibt damit freilich in bester
Gesellschaft, ist darin keineswegs ein Außenseiter, sondern kann
allgemeiner Zustimmung sicher sein. Wer dem Regressionskonzept, das im
Zeittrend liegt, anhängt, kann so denken. Aber ei Zeichen von unabhängigem
Denken ist es nicht.
Zum
Schluss sei noch auf die erste Fallschilderung
des Autors (S 26-34) „Mach doch einfach ins Wasser...“ eingegangen.
Wahrheitsgehalt,
Brauchbarkeit sowohl des Textes als auch der Rezension / Kritik müssen / können
sich am konkreten Fall erweisen. Denn
Theorie ist nicht weniger geduldig als Papier.
Es
handelt sich hier um eine ungewöhnlich offene und um größtmögliche
Ehrlichkeit gegenüber sich selbst bemühte Falldarstellung eines
berichtenden Analytikers. Diese kreist um das erotische Umeinander eines männlichen
Therapeuten und seiner kurz vor 30 jährigen, blonden unverheirateten
Patientin, also um die „klassische“ heterosexuelle Verführungssituation.
Wer den Fall, also den Berichterstatter, und die Einwände des Rezensenten
im Einzelnen verstehen will, sollte den Fall selbst lesen. Der Rezensent
setzt einfach seine Einwände / Überlegungen zum Text sofort dazu.
Ihrem „flüssiges Erzählen hört der
Analytiker gerne zu, weil es ihn seinerseits zu vielen Einfällen anregt“.
Nein, nicht „weil“. Dies ist eine Rationalisierung,
ein Scheinbegründung. Nein, er hört ihr gern zu, weil er sich in einer
verlockenden Zweierbeziehung unter Erwachsenen befindet und die Patienten
attraktiv ist bzw. er sie attraktiv findet und weil abgesperrt ist (rote
Lampe im Flur heißt: Nicht betreten! Nicht stören!) Diese Lampe hat die
Funktion eines Sperrschlosses, das geschlossen ist, und bereits die Farbe
Rot hat eine unbedachte, wenn auch nicht vom Therapeuten zu vertretende,
erotische Konnotation. Er hat nicht nur „ein positives Hintergrundsgefühl“,
wie er angibt. Mit dieser Formulierung wehrt er ganz andere, gewiss mehr
vordergründige und lokalisierbare leibliche Gefühle und vor allem deren
rechte Einordnung als erwachsen-sexuell ab.
Hier
liegt Abwehr durch Verschiebung
„nach hinten“ („Hintergrund“ statt „Vordergrund“, denn es
handelt sich nicht um das Hintere, sondern das Vordere am Mann), Isolierung
vom sexuellen Gefühlsinhalt, Idealisierung der analytischen Situation
(zu einer nichtsexuellen, obwohl sie dies ganz offensichtlich nicht ist und
naturgegeben nicht sein kann, denn so sind wir veranlagt, ohne uns übrigens
selbst so gemacht zu haben), Intellektualisierung
(„eigenartige Veränderung“ im Analytiker, „positive Erwartung einer
Idee“). „Eigenartig“? Die Veränderung ist nicht eigenartig, sondern
selbstverständlich.
Der
Analytiker fühlt sich „wie trocken gesetzt und zugleich überschwemmt“,
in „gestauter Anspannung“, „alle Spannung sich in einem....
gemeinsamen Auflachen“ löste (Selbstwahrnehmung der Mundtrockenheit bei
Erregung und der sexuellen Bereitstellung an anderer Stelle einschließlich
lubricatio, Verschiebung des
gemeinsamen Höhepunkts auf gemeinsames, harmloses Lachen, „ dessen
Wellen sich der Analytiker sich gerne eine Weile überließ.. lustvolle
Heiterkeit“), interpretiert dies aber z.T. viel zu körperfern (Intellektualisierung).
Es sind die Wellen der Erregung und die sexuelle Lust der Erwachsenen, deren
Wahrnehmung abgewehrt werden muss, und nicht die „Prozessgestalten“
(Intellektualisierung).
Die
Erinnerung an eine urethrale Absicht in ihrer Kindheit (s.Titel des Textes),
bei der sie versucht ihre Badehose beiseite zu schieben, um leichter ins
Wasser urinieren zu können, und das Gefühl, von ihrem Onkel dabei ertappt
zu werden: Dies nimmt der
Analytiker als „selected fact“, „als ausgewählte Tatsache“ und
bringt diese mit der Übertragungs- Gegenübertragungsituation zusammen.“
„Die
Patientin ist in Analyse und die dadurch ausgelöste
Regression...“.,,,“die psychoanalytische Situation induziert. .eine
psychisch regressive Bewegung“...:
Der
Analytiker scheint Regression in
der Analyse für selbstverständlich zu halten oder sogar für ein
Erfordernis. Dass eine Regression in einer Analyse stattfinden soll und überhaupt
kann, wird aber heute durchaus auch bestritten (so von dem US-
Amerikanischen Analytiker Renik, auch von Gray, Krill 2008). Andernfalls
sollten auf der Couch Schnuller und Windeln bereitliegen, auf Kosten von
Mutter Krankenkasse. Beides ist auch auf dem Hin- und Rückweg zu tragen, um
sich einzustimmen Untersuchungen haben gezeigt, dass dann die Stunden
wesentlich erfolgreicher verlaufen und Einwände gegen die Regression
verstummen.
Sie
müsste auf jeden Fall klinisch, also mit dem Verlauf der Analyse,
dargestellt sein, und dies ist hier nicht der Fall.
Von einer Progression
ist nie die Rede, obwohl diese von jedem Patienten ersehnt wird, denn sie
gehört zu den normalen Wünschen.
Der Patient dürfte seine progressiven Wünsche nach Entwicklung, Wachstum,
Konfliktfreiheit und namentlich nach immer besserem Kontakt mit Anderen (eine
innere Hoffnung und Voraussage, vermutlich die gesamte psychosoziale
Entwicklung wiedergebend)
antizipierend längst – wohl auch mit Hilfe von Träumen- mit der äußeren
Wirklichkeit und mit der Wirklichkeit abgeglichen haben, die er im
Kontakt mit dem Analytiker erfährt, und so zu vermehrten Eigenanstrengungen
gefunden haben, die Außenwelt und den Analytiker besser zu verstehen und in
diesem Sinne zu rasch wirkenden (Abwehr-)Deutungen und direkt ermunternden
Interventionen zu bewegen.
Der
Analytiker muss, wenn er schon an die Notwendigkeit einer Regression in der
Analyse glaubt, achtgeben, dass er mit Deutungen in dieser Richtung
nicht nur das Innenleben, namentlich den inneren unbewussten Konflikt des
Patienten nicht verstanden und somit seine stillschweigenden Versprechungen
nicht eingehalten hat, sondern auch keinen Kollateralschaden anrichtet,
sozusagen als unerwünschte Nebenwirkung. Dieser kann darin bestehen, dass der
Patient in die falsche Richtung gezwungen wird, sozusagen
entwicklungsdisform die falschen Weichen gestellt werden. Und es spricht
viel dafür, dass mit „Regression“ eine falsche Weiche gestellt wird,
denn seit frühester Kindheit ist der Verlauf , das Verhalten, die inneren
Vorgänge auf Zukunft, auf Entwicklung, auf Richtigkeit der Vorhersagen
eingerichtet. Es ist ja immer die Frage, was eine Deutung aktiviert
(stimuliert) und was sie unterdrückt. Die verbalen und leiblichen Äußerungen
der Patienten sind nicht so sehr vergangenheitsgerichtet, sondern
aufgabengerichtet, d.h. sie sind besser als Suchbewegungen
in Richtung Zukunft zu verstehen und entsprechend therapeutisch zu würdigen, d.h. abwehranalytisch
auf Abwehren solcher Suchbewegungen zu untersuchen..
Die
leiblichen Äußerungen zeigen
wahrscheinlich weniger die Vergangenheit, namentlich die Mutter-
Kindbeziehung, als die Zukunft, in die sich das Individuum bewegen möchte
und bewegen wird. Die traditionelle Rückwärtsgewandtheit
der Psychoanalyse hat den Blick auf Progression, auf die Zukunft verstellt.
Zu den leiblichen Äußerungen gehören. z.B. auch die cerebralen Vorgänge,
die bereits nachweisbar sind, bevor, man weiß, was man sprechen, bewegen,
denken wird. Das Händegeben am Anfang oder Schluss einer Sitzung ist vor
allem ein Fingerzeig (präsent!), der auf das Vorhaben hinweist („Wir
wollen eine Stunde beginnen“ „Wir wollen diese Stunde hiermit beschließen,
und „Ich will jetzt nach Hause gehen“ bzw. „Ich will jetzt den nächsten
Patienten behandeln“. Mit einer bestimmten Mimik wir mehr ausgedrückt,
wie es in einer Beziehung weitergehen soll und wird, als, wie die Beziehung
in der Vergangenheit war. Die leibliche Dimension ist auf ihre Fähigkeit zur Voraussage nicht
untersucht worden, abgesehen davon, dass diese diagnostisch und
therapeutisch weit gewinnbringender sein dürfte als eine Verbindung mit der
Kindheit, namentlich der Mutter- Kindbeziehung. Die Mutter-
Kindbeziehung ist sogar besonders weit weg und nähert sich in ihrer
Bedeutung der Anekdote, also einem Fragment, das seine Erwähnung nicht wert
ist, wenn es auch der bloßen Unterhaltung, dem Amusement, auch der
Ablenkung von etwas Wesentlicherem, dienen kann. Auch wäre eine
Formulierung denkbare wie: Die „Mutter-Kind-Beziehung hat ihre
Schuldigkeit getan, sie hat nun ausgedient, indem sie ein Muster gesetzt
hat, das fortan abgewandelt wird, abgewandelt werden muss. Um es auf den
Punkt zu bringen: Die Mutter- Kindbeziehung ist am wenigsten in der
Zukunftsperspektive präsent, sie ist entfallen. Man kann sich vielleicht
noch an sie erinnern, aber man benötigt sie nicht mehr. Sie war wichtig,
sogar lebenserhaltend, jetzt ist sie es aber nicht mehr, schon lange nicht
mehr. Unter diesem Gesichtspunkt kann auch gefragt werden, ob das notorische
Rekurrieren auf die Kindheit in der Psychoanalyse nicht nur den Blick für
die Entwicklungspotenzen (und Voraussagen)verstellt, sondern auch
entwicklungsdisform wirkt.
Ein
Beispiel aus eigener Praxis:
Eine
32 j. Patientin mit einer mittelgradigen Claustrophobie (Angst in U-Bahnen,
Aufzügen, Flugzeugen, aber auch in allzu engen Beziehungen) kam wegen
dieser Phobie, aber auch wegen unerfüllter Schwangerschaftswünsche. Die
Analyse zog sich hin, die Abwehren insbesondere durch Vermeidung von
Engesituationen und die dabei entstehenden Ängste, erdrückt zu werden,
keine Luft mehr zu bekommen, sich nicht durch Fortlaufen befreien zu können
und so schließlich sterben zu müssen, konnten mit Erfolg bearbeitet
werden, sodass die Patientin sich den gefürchteten Situationen nunmehr mit
nur noch wenig Angst aussetzen konnte und sie darin nicht mehr behindert
war. Es blieb aber der unerfüllte Kinderwunsch. Pärödipale und ödipale
Konflikte waren eruierbar und wurden bearbeitet, sodass auch hier Ängste,
besonders die, nicht so gut wie ihre eigene Mutter sein zu können,
vermindert werden konnten. Sie wurde aber erst schwanger, nachdem ein
Perspektivewechsel vollzogen wurde. Es ging nicht mehr um Ängste, die in
der Vergangenheit geortet werden konnten und die wohl noch weitergewirkt
hatten, als vielmehr um ausgiebige Zukunftsphantasien, ebenfalls unter
Bearbeitung der dabei auftretenden Abwehr von Wünschen („Hoffnung“
einer präsumptiv Sich-in- guter- Hoffnung- Befindlichen) und Ängsten. Die
Zukunft wurde mit Befruchtung, früher Schwangerschaft,
Schwangerschaftserbrechen, Anschwellen der Brüste, Verhalten des Ehemanns
und von Bekannten und der Eltern und Geschwister, dickem Bauch,
Sitzplatzvorteile, Schwangerschaftsgymnastik, Ernährung,
Schwangerschaftsurlaub, das regelmäßige Aufsuchen von Ärzten, Mitteilung
an die Verwandten und Bekannten, Aufsuchen einer Klinik (mit Namen und
Anschrift, in der Nähe ihrer Mutter), Geburt im Kreissaal unter Assistenz
erfahrener Schwestern und Ärzte, auch eine kürzere Reise, dann das erste
Halten des Kindes, das erste Stillen, das Sillen zu Hause, die ersten
Krabbelversuche, das erste Laufen, das spielen mit anderen Kindern, der
erste Schultag usf. in unzähligen Einzelheiten ausphantasiert, somit
vorphantasiert und Abwehren dieser Wünsche bearbeitet.
Selbst
wenn in der Analyse eine „Regression“ erreicht würde oder der Patient
sie bereits erreicht hätte (was
ich beides bezweifle), würde ein
Analytiker nicht darum herumkommen, die Konflikte auf dieser
Entwicklungsstufe analytisch zu lösen. Davon ist aber nicht viel zu sehen.
Die
offenbar angestrebte „Mentalisierung“ soll ohne Bearbeitung früher
Konflikte zustandekommen, offenbar nur durch Empathie und fleißiges
„Spiegeln“ (falsches
Wort, gemeint ist eine emotionale Antwort des Analytikers).
Das
kann nicht reichen.
Nachträgliches
Verstehen und Nachfühlen kann ohnehin nicht den gleichen therapeutischen
Stellenwert haben wie Antizipation der Zukunft.
Deutungen
dürften nicht immer nur dort wirken oder nicht wirken, wohin sie zielen,
sondern auch „danebentreten“, dort sogar vielleicht mehr.
Das
Gleiche dürfte auch für Äußerungen der Patienten nach vorherigen
analytischen Deutungen gelten. Neben Äußerungen und Übertragungs- und
Gegenübertragungsreaktionen der Patienten auf Deutungen hin gibt es immer
eine Art „Beifang“, der
definitionsgemäß unerwünscht ist, als Abfalls“ unbeachtet bleibt und
vernichtet wird (durch Verdrängung, Negation, also Neglect). Umgekehrt wäre
es auch interessant, gerade diesen Beifang zu untersuchen. Es kann sich um
besonders interessantes Material handeln, das sich durch Unauffälligkeit
und Banalität tarnt. Das einzige Zeichen von Abwehr kann darin zum
Vorschein kommen, das es auffällig
unauffällig ist. Ein solcher Beifang kann zu einer „Antistory“(Power
2001, Krill 2008) gehören und zur „Antivignette“
(Grossmann, L 1999, Blechner 2001), Krill 2008) werden (Krill 2008,
230-234).
Mit diesen ist
bei Fallvorstellungen und Vorträgen naturgemäß kein
Staat zu machen, vielmehr nur Bloßstellung und Spott zu ernten.
Tatsächlich
weiß aber jeder von uns Analytikern, dass viele Stunden und große Strecken
in der Stunde von beiderseitigem
Unverständnis, Verwirrung, verständnislosem Angespanntsein, also einer
„schlammigen Situation“ (Grossmann, L.1999, Krill 2008, 229)
und „Fehlstellen“ (s. Krill Gruppenanalyse Neu 2013)
gekennzeichnet sind.
Nicht
weniger wird das Phänomen verworfen, dass oft
der Patient unbewusste Vorgänge im Analytiker besser erkennt als dieser
selbst (Hoffmann I. Z. 1983). Auch dies wird als Abfall entsorgt, durch
Nichtbeachtung.
Diesem
„Beifang“ und „Abfall“ in Form von „schlammigen Situationen“
ergeht es noch heute so wie bisher mit der leiblichen Dimension bis zur
Erscheinen dieses Buches. Da müssen Verbindungen bestehen, die noch zu erforschen wären. An Gemeinsamkeiten ist im Augenblick nur
die Verachtung zu erkennen,
welche diese Phänomene erfahren. Wie
wäre es, wenn sich der gleiche Autor dieser Frage annehmen würde?
In
Einzelfalldarstellungen dürfte der Weg vorgezeichnet sein. Aus vier Stunden
müsste ein Autor eine auswählen, deren Darstellung besonders prestigeträchtig, stimmig, einheitlich, storyhaft usw.
erscheint, also zum Vortrag bestens geeignet erscheint.
Dann
sollte er die schlechteste Stunde
ansehen, eine Stunde, die er auf keinen Fall vortragen möchte.
Aus
dieser schlechtesten Stunde müsste er aus sog. „Fehlstellen“, Unverständnis, unvorhersehbaren Reaktionen des
Analytikers selbst und des Patienten eine These formulieren, und in den
folgenden Stunden wieder die schlechteste heraussuchen. – Dann mal sehen, ob man einen Verlauf erkennen kann. Das hat noch niemand
getan, und hier könnte sich ein Analytiker durchaus noch Lorbeeren
verdienen.
Unter
diesem Gesichtspunkt sollten Einzelfallbeschreibungen noch einmal genau
gelesen sein.
Der
Analytiker meint nun, die „durch die Analyse ausgelöste Regression
spreche Resonanzfelder im infantilen Unbewussten an, die das Erleben in der
analytischen Situation...organisieren“, also in diesem Fall in die „verführende
Aufforderung“(die noch dadurch nonverbal unterstrichen wird dadurch, dass
die Patientin dabei ihr Hemd über die Hose zieht. als sei dieses zuvor
verschoben gewesen, - wodurch sie die o.a., an den Analytiker gerichtete
Bewegung wiederholt und so in der Aufforderung an den Analytiker mündet,
ebenfalls „ins Wasser zu machen“, was mit der Angst einhergehe, vom
Analytiker darin ertappt zu werden wie seinerzeit vermeintlich vom Onkel.
Der
Autor macht nicht verständlich, warum dies Verhalten der Patientin „eine
wunderbare Paradoxie“ sein soll.
Es
ist kein Widerspruch erkennbar, sondern eine in typischer Weise
unvollkommene Abwehr: Der Impuls, den Analytiker zu verführen, wird
abgewehrt durch das Überziehen des Hemds. Wie immer, gelingt
die Abwehr nicht total bzw. sie braucht auch nicht vollständig zu sein,
weil die Angst dazu nicht reicht. Vielmehr setzt sich der abgewehrte Wunsch
mit einem kleinen Teil durch, wie immer. Deshalb heißt es ja, dass Symptome
Kompromissbildungen sind zwischen dem Triebabkömmling (dem Wunsch) und der
Abwehr.
Der Autor möchte aber das Abwehrmodell
partout nicht anwenden, sondern greift zur sensationell klingenden Formel
einer angeblichen „Paradoxie“ (Intellektualisierung als Abwehr gegen die
beiderseitigen sexuellen Strebungen).
Es
liegt weder eine „Paradoxie“ vor noch wäre diese „wunderbar“. Diese Wörter klingen nur schön, nämlich
nach Philosophie und Religion, und diese Fächer haben in der klinischen
Arbeit mit Patienten nichts zu suchen, sondern dienen nur dem Ausweichen vor
der therapeutischen Aufgabe, - dem Neglect
der inneren Vorgänge in der Patientin, nämlich des inneren unbewussten Konflikts zwischen dem o. a. Wunsch
und der Abwehr aus Schuldgefühl und Scham gegenüber dem Analytiker in der
Übertragung.. Nicht nur vom inneren
Konflikt, sondern auch von der Übertragung ist der Autor hiermit
abgekommen. Als Abwehr im Analytiker selbst ist Intellektualisierung
anzunehmen.
Dass
der Analytiker bei sich ähnliche Regungen und Abwehren spürt wie die
Patientin, konnte erwartet werden und trat auch ein, so in einem
Distanzierungsversuch durch einen Fast-Versprechen („bis Montag, - das war
nicht der nächste Tag) und sein Ziehen seines Pullovers nach unten über
seine Hose (S 28). Dass der Autor dies als „Szene“
(S 28) bezeichnet, zeigt noch einmal, dass mit dieser Bezeichnung nicht das
Geringste gewonnen ist. Er kann dies gerne tun, aber im Verständnis der
Psychodynamik im Analytiker sind wir damit keinen
Deut weitergekommen.
Im
Gegenteil meine ich, dass sich hiermit der Therapeut selbst von seinen
Aufgaben ablenkt, und zwar durch Abwehr durch Verschiebung und Agieren. Er
lenkt sich ab von seinem Konflikt zwischen seinen erotischen Wünschen und
seinen Schuld- und Schamgefühlen sowie seiner Angst vor Entdecktwerden und
Vergeltung.
Er
kann diesen Konflikt in sich einer Lösung zuführen, indem er die Abwehr
aufgibt und diese unangenehmen Gefühle in Ruhe zu ertragen lernt, sodass er
solche Abwehr nicht mehr nötig hat.
Der
Leser wird jetzt vielleicht eher verstehen, weshalb ich nicht an den Wert
des Wortes „Szene“ glaube, sondern, dass er der Sache abträglich ist,
d.h. das Verständnis der Prozesse zwischen Patient und Analytiker
verhindert. Der Therapeut klammert sich an das Wort „Szene“ und glaubt fälschlich,
dass er damit etwas verstanden hätte. Hier wirkte sich Abwehr des inneren
Konflikts im Analytiker durch Intellektualisierung ungünstig aus.
Seltsam,
zumal isoliert auftauchend, aber umso interessanter sind die Gedanken des Therapeuten über sich als
„Beobachter auf dem Trockenen“ (einer Leib-Sensation!) und um einen
Dritten, der ungebeten zutritt (S 14).
Dies
kann den Wunsch des Therapeuten ausdrücken, „sein Weibchen“ (Verf.)
gegen einen anderen Mann zu verteidigen, also für sich zu behalten, seine
Angst, sie an diesen zu verlieren, seinen Triumph, Platzhalter zu bleiben, -
denn der Gast wird gemeinsam abgelehnt.
Der
Therapeut fühlt sich in eine ödipale Situation ein, aber der Gast soll
„ungebeten“ sein. Hiermit erfüllt sich der Analytiker erst recht den ödipalen
Wunsch, denn darin wäre er sich mit seiner „Partnerin“, der Patientin,
einig, - dass der Gast nämlich von beiden abgelehnt wird und verschwinden
oder gedemütigt werden soll.
Hier
von „Inzest“ zu sprechen, ist übrigens völlig unnötig und
analytisch unrichtig, an den Haaren routiniert herbeigezogen, offenbar nur
theoriegesteuert, ein Versatzstück aus der Lehre. Klinisch lässt sich
nicht belegen, dass einer der Beteiligten (Kind, Onkel) unbewusst an einem
Inzest Interesse gehabt hätte oder eine auffällige Abwehr gegen solche Wünsche
gezeigt hätte. Wenn der Therapeut selbst solche Wünsche in sich als von
der Patientin und ihren Erzählungen angeregt vermuten sollte, kann er diese
nicht seiner Patientin anheften. Es ist auch sonst nichts gewonnen mit
diesem routinemäßig bereitstehenden Begriff („Wo Kindheit, da immer auch
Inzest“?, so scheint es üblich zu sein).
„Inzest“
wird benötigt, um eine Hölle glaubhaft zu machen. Unter „Inzest“ geht
z. Z. in manchen Instituten nichts, genausowenig wie unter „Frühe Störung“.
Natürlich
entwickelt diese Patientin wie auch Andere in einer solchen Situation
sexuelle Wünsche mit ihrem Analytiker. Dies ist ja durch die ganze
Anordnung (Regelmäßiges Treffen, Intimität, diese in wechselseitigem
Austausch, Abgeschlossensein) und nach der Theorie so gewollt und in Kauf
genommen. Es soll ja eine Übertragungsneurose entstehen, und in dieser soll
die Neurose „verbrennen“.
Aber
hier von Inzestwünschen zu sprechen,
ist abwegig und nur durch die Tradition bedingt. Hier wird eine Tochter-
Vater- Beziehung suggeriert, um der Lehre zu genügen. Tatsächlich handelt
es sich um zwei Erwachsene, die sich in einer quasi- sexuellen Situation
befinden und Mühe haben, Sexualität nicht auszuüben.
Wer
soll mit wem und wozu Inzestwünsche entwickeln wollen und können? Nur weil der Analytiker älter ist und sie
angeblich auf ihn ihre Gefühle für ihren Vater überträgt? Weit wahrscheinlicher ist, dass sie ihn (sie hat ihn ja schließlich
auch unter anderen Analytikern ausgewählt, - warum hat sie keine
Analytikerin gewählt?) attraktiv
findet und ihn in ihren Wünschen zu einem jungen, kraftvollen Mann macht,
ferner zugleich an ihren Freund denkt (davon erfährt man in Fallgeschichten
selten etwas, schon weil dies dem Analytiker wenig gefallen kann, denn auch
er ist ja verliebt und „freut“
sich auf die „künftigen Ideen“) und sich an dem Gedanken erfreuen
kann, zwei Männer zu haben, für alle Fälle zwei Männer, und dass etwaige
Gedanken an einen Inzest auf beiden
Seiten von dieser durch die Situation angeheizten Aufregung ablenken und zur
Abkühlung dienen sollen, damit die sexuellen Wünsche sich nicht Bahn
brechen, wie bereits überhaupt das
ständige kontraphobische (der phobischen Analytiker, s.o.),
nur scheinbar offene Sprechen über
„Sexualität“ in dieser intimen Situation (nicht selten
„bohrend“, insistierend:„war da nicht doch etwas?“ lockend, empört,
latent vorwurfsvoll, erfreut etc., - dies nicht vom Autor, nur üblicherweise,
- gleich ob er dies erkennt oder nicht).
Eine
junge attraktive Frau hat derart viele Angebote, - warum in Gottes Namen sollte sie an einen Inzest denken? Nur um
Freud und dem Lehrbuch Genüge zu tun? Sie hat Besseres zu tun, auch gegenüber
ihrem Analytiker.
Der
Analytiker stiehlt sich aus dem Erwachsensein mit seinen sexuellen und
aggressiven Gefahren heraus: Er hat sich in einen Bereich von „tuscheln
...Kindergartengruppe“ (Zitat) begeben, - also möglichst weit weg von den
aktuellen Gefahren des abgeschlossenen Zusammenseins mit einer attraktiven
Patientin, - wie wenn sein Leben davon abhinge.
Auch
bleiben die inzwischen aufgetretenen Einwände gegen das Inzestkonzept
unbeachtet. Gewiss gehört von der Westermarck-Hypothese,
aber sie nicht in Betracht gezogen?
Es
gibt Inzest, aber wenn dieses Wort unbegründet verwandt wird wie hier, gehört
dieses Wort zur erstarrten
psychoanalytischen Sprache, ähnlich
wie viele kleinianischen Begriffe, meist in Form von Doppelbezeichnungen wie
projektiv-identifikatorisch, oder polymorph-pervers, phallisch-narzisstisch,
Spannungs- Feld, sexuelle Belästigung, oral-sadistisch, sado-masochistisch
usf.
Der
psychodynamische Hauptgrund,
immerfort von Inzest zu sprechen und sich damit zu beschäftigen ist, dass
beide Seiten ein Interesse haben, von Anderem in der Analyse abzulenken,
so z.B. von depressiven oder aggressiven Regungen (kollusive Verschiebung
und von der erotisch aufgeladenen Übertragungs- und Gegenübertragungs-
Beziehung auf eine anderes Thema und andere Personen und Zeiten, vom
Analytiker weg, auf andere Wünsche, andere Ängste, andere Schuld- und
Schamgefühle, andere Abwehrformen).
Der
Analytiker fragt sich, ob in der Analyse die Patientin bzw. „das kleine Mädchen“
nicht zum Objekt seiner „eigenen
infantilen Sexualneugier“ wurde, zumal er sich gerade mit Freuds
„Abhandlungen zur Sexualtheorie“ und einem Zeitschriftenartikel darüber
befasst und eine Abwehr dagegen in sich verspürt habe (er sei kurz
angebunden gewesen - also Abwehr, etwa in Form von Verneinung-).
Hier
ist wieder das Stereotyp von der
Regression und der Herleitung aus der Kindheit beider Teilnehmer zu
erkennen. Warum soll es denn die infantile Neugier des
Analytikers sein und nicht seine gegenwärtige, erwachsene?
Warum
die Verharmlosung zu einem infantilen Drang? Warum darf es nicht einfach der
gegenwärtige, erwachsene sexuelle Wunsch des erwachsenen Analytikers sein?
Weil, wie der Autor selbst betont, die
Angst der Psychoanalytiker vor der Erwachsenensexualität groß ist, und
weil dies einen Neglect nach sich ziehen muss.
Wie
wenn er damit zuerst eine Pflichtübung hätte absolvieren und dazu wieder
zu gewohnten Bildern aus der analytischen Lehre von der alles beherrschenden
Kindheit hätte finden müssen, kann
der Therapeut im Folgenden dann doch noch, unter erkennbar vielen
Skrupeln, seiner Erwachsenensexualität
etwas abzugewinnen (S 30-31): „...sie klopfte ihm auf die neugierigen
Augenfinger (eine glückliche Zusammenziehung! Verf.).. .was interessierte
den Analytiker an ihr? ... Was lief denn wirklich zwischen ihnen ab? (ja,
das ist es, sehr ehrlich Verf. , der hier auch an das Sprichwort erinnern möchte:
„Da läuft etwas zwischen den beiden“ und an das performative
Sprichwort: „Es läuft“ oder: Läuft`s?)
...“das heimlich ersehnte und geschickt organisierte Zusammentreffen des
analytischen Paares (ja, das ist es! Verf.) auf einer kleinen Lustinsel ?..Möglichkeit
eines solchen Treffens...“...Stimme und Sprechen eine Qualität von „süß“
angenommen hatten (S 30)... Einladung zum Tanz...Zunge und Lippen
weich...“ Es geht bis
zur Buchstaben-Erotik: M und N sind erotisch, S und t nicht.
„Besser,
es würde niemand eintreten...intime und unerlaubte Vorgänge, von denen die
Öffentlichkeit auf jeden Fall ausgeschlossen werden müsste...choreagraphische
Tanzaspekte und stimmliche Gesangsaspekte (S 31) seines Sprechens .. schwamm
er in der Triebbewegung der Patientin mit......überflutete es ihn...von
innen“ .... ein zweideutiges Beziehungsangebot, über das in jeder
Stunde...stets neu entschieden wird (das besser nicht, - dies ist gewiss
auch vom Autor nicht wörtlich gemeint. Es wird nicht neu entschieden,
sondern steht als Rahmen fest. Andernfalls wären beide Teilnehmer so beschäftigt
mit diesem Thema, dass eine Therapie der inneren Konflikte der Patientin, um
die es ja schließlich geht und wegen derer die Patientin gekommen ist, unmöglich
wäre. Hierzu die Warnungen Paul Grays vor zu großer Beachtung von Übertragung
und Gegenübertragung auf Kosten der Beachtung der inneren Konflikte, -Anm.
des Verf.).
Kaum
dass diese Sätze heraus sind, fällt der Autor (S 33-34) wieder in seine These
von der „Regression“ zurück, auf „infantil- regressive Verfassung“,
auf sich als „Opfer infantiler
Überzeugungen (S 34) ...infantil- polymorph-perverse Erregung mit ihren
Vorlust(!)-Quellen...Inzest...
infantile Harnerotik“.
Der
Ausflug in die Erwachsenensexualität durfte nur kurz währen.
Das ganze Vokabular der Infantilität und
eines kindlichen „Inzests“ wird immer und immer wieder bemüht,
wo es doch sichtlich um handfeste
erotische Wünsche von Erwachsenen ging, die alles andere als infantil sind,
die aber anscheinend zu fürchten sind wie Teufelszeug.
Wie
wenn es jetzt zuviel wäre von der Erwachsenensexualität, wendet sich der Analytiker in seinen Gedanken hilfesuchend
seinen Kollegen zu und holt deren Meinung ein, fürchtet sich vor deren
Vorwürfen, fühlt sich ertappt.
„Schwein...Übergriffe...
zog zum zweiten Mal seinen Pullover über seine Hose...“
Die
„Kollegen“,
wie auch die „Gruppe“ (so
S 52) oder die „analytische
Gruppe“ kommen in seinen Gedanken immer wieder vor, obwohl der Autor
gewiss nicht weniger als Andere weiß, wie zweifelhaft der Wert solcher
Gruppen für die eigene Arbeit ist (Krill 2008, 222 ff : schlammige
Situation).
Die
wiederholte Anrufung hat eine
gewisse religiöse Note und zeigt nur, wie schwierig die analytische,
sexuell getönte Situation ist und in welche Nöte sie jeden Therapeuten
bringen muss, sodass gleichsam nach Gott, jedenfalls nach der höchsten
Autorität, gerufen werden muss. Es scheint hier speziell, dass der
Analytiker sie zur Verstärkung
seiner Abwehr gegen seine verbotenen Wünsche und gegen seine Ängste,
Schuld- und Schamgefühle in Gedanken benötigt.
In
seinen Gedanken bestrafen ihn die
Kollegen außerdem für seine erotischen Erwachsenenphantasien.
Dann
aber macht der Analytiker in Gedanken
seine Kollegen, die ihm Vorhaltungen machen und alles besser wissen
wollen, klein, sogar zu „Drei- bis
Fünfjährigen“. Was tut der Analytiker hier? Er hat es auf einmal
erneut mit der „Kindheit“ zu tun. Warum?
Auf
S 171 meint der Autor, die „psychoanalytische Kollegengruppe stehe für
den „Dritten“ (der
„Vierte“ dürfte die analytische Literatur sein, der „Fünfte“ das
analytische Institut, wann kommt der sechste und siebente?). Es
gibt nicht nur das von Shapiro (bereits 1981) beklagte „race back“ zu
immer früheren angeblichen Entstehungszeitpunkten, sondern ebenso ein phobisches Wettrennen fort von dem inneren Konflikt des Patienten und
dem Übertragungs-Gegenübertragungsgeschehen. Man flüchtet
zu Anderem, indem immer mehr Andere eingeführt werden ,- weil die
analytische Aufgabe schwierig ist und Angst macht.
Der
Autor fügt
an, wenn ein Analytiker der analytischen Gruppe nicht berichten könne,
sollte dies ein ernsthaftes Warnzeichen sein. Als ob es hier keine „schlammige
Situation“ mit viel unterwürfiger Zustimmung, blanker Rhetorik,
oberflächlicher Betrachtungsweise und groben Missverständnissen gäbe
(ausführlich dargestellt in Krill 2008, 227 ff). Von der Vielzahl der Voten
ist selten etwas zu gebrauchen (hierzu auch mündliche Mitteilung von
Morgenthaler 1969, sein Urteil fiel noch weit harscher aus). Mir scheint es
eher bedenklich, hiervon das Heil zu erwarten, statt selbst konsequent
analytisch zu arbeiten. „Wer viel fragt, kriegt viel Antwort“, heißt es
nicht umsonst. Der Wert der Intervisionsgruppen unter Kollegen dürfte eher darin liegen, dass
der jeweils Vortragende sich selbst über den Patienten klarer wird, wenn er
über ihn berichtet.
Diese
wiederholte Anrufung des
„Dritten“ scheint vor allem eine vorbeugende Funktion zu haben. Denn
nimmt sich ein Analytiker vor, seinen Kollegen zu berichten, schützt er sich innerlich vor Entgleisungen, die, so auch nach
Ansicht des Autors, leicht geschehen können, wenn man sich auf das gefährliche
Gebiet des leiblichen Austausches begibt. Er unterwirft sich dem strengen
Urteil der Kollegen wie einem besonders strengen Überich, nur dass dieses
nach außen verlegt wird, und schützt sich so.
Andererseits
betont der Autor auch ( S 172), dass eine „überichgeleitete
Einstellung ..einen professionellen Umgang mit dem Thema der körperlichen
Berührung verhindert“.
Das
ständige Denken an das, was die analytische Gruppe zu der analytischen
Behandlung sagen wird, sagen würde oder sagen könnte, ist nichts anderes als eine solche
Unterwerfung an eine besonders strenge Instanz (externalisiertes Überich)
und insofern der Therapie abträglich.
Nicht
zufällig verzichten ja auch viele Analytiker ganz bewusst auf Teilnahme an
Intervisionsgruppen.
Der
Autor räumt auch ein, dass „niemand vor einem Agieren in der einen oder
anderen Richtung geschützt“ sei (S 172).
Hier
ist sehr deutlich das Fluktuieren im
Therapeuten zwischen seiner Erwachsenen- Position und der eines vorgeblichen
Kindes zu sehen. Wenn die Angst vor der Erwachsenen- Sexualität – und
Aggressivität zu groß wird, kommen die Kindheit und die analytische Gruppe
gerade recht, sich von diesen Aufgaben, Wünschen, Ängsten, Schuld- und
Schamgefühlen zu verabschieden, - Phobie vor dem Erwachsenenstatus.
Diese
Falldarstellung ragt trotz aller Einwände stilistisch, in ihrer Ausführlichkeit
und in ihrem analytischen Niveau über alles Bisherige heraus. Sie erreicht
literarisches Niveau, hat den Rang einer Novelle erreicht.
Ein
Rezensent kann aber desungeachtet die
ungünstigen Folgen eines solchen Vorgehens, namentlich von
Intellektualisierung und Verschiebung auf Vergangenheit mit Rekurrieren auf
infantiles Geschehen, erkennen.
Wenn
es heißt: „...kann der Dritte aber auch Abwehrcharakter bekommen in der
Gestalt aller möglichen Aufträge, die von außen die Entwicklung des
analytischen Paares an sich ziehen wollen-, z. B. gesund werden, reif
werden, moralischen Anforderungen entsprechen, sich sexuell frei oder nicht
so frei geben usw. Es gibt auch ein die analytische Arbeit störendes
Drittes“(S 41), dann meldet sich hier wie ein böser Geist wieder die oft uneingestandene,
selbstzufriedene, um nicht zu sagen solipsistische, antitherapeutische Haltung, - als ob Psychoanalyse im Weltraum schwebe und
nicht in der Gesellschaft eingebettet sei und sein muss und wir
selbstherrliche Künstler wären oder sein dürften.
Mit
der Verunglimpfung des „Auftrags“
wird ein Sündenbock gesucht für das Scheitern von Psychoanalysen.
Der
Auftrag von
Versicherungen und von den Patienten, zu einer Besserung der Beschwerden zu
erzielen, ist es aber gewiss nicht,
der Psychoanalysen zum Scheitern bringt. Der Wunsch des Patienten nach
Gesundheit gehört zur natürlichen Grundausstattung und sollte nicht
diffamiert werden. Er schadet keiner Psychoanalyse, sondern nutzt ihr, schon
durch seine Mitarbeit und seinen psychischen Einsatz.
Der Auftrag ist sogar das Einzige, was die Psychoanalyse als besonders
aufwendige Behandlungsmethode legitimieren kann. Woher sonst soll sich Legitimation
herleiten lassen? Und woher sollten ebenfalls Analytiker ihre
Legitimation beziehen? Dem Autor schwebt offenbar eine
von allen Zwecken gereinigte Psychoanalyse vor, mit einer eigenen Ästhetik,
die es zu verteidigen gälte, - gegen was genau eigentlich und wozu? Ist
Psychoanalyse Selbstzweck? Eine heilige Kuh? Wo heilige Kühe, da auch
heilige Hirten. Auch Religiöses? Hierzu gesellt sich nicht zufällig die
neuerdings propagierte „Zeitlosigkeit“. Von dieser ist es zur
„Ewigkeit“ nicht weit. Hat die neuerliche Betonung von „Präsenz“
etwas mit dem religiösen Begriff der „Erscheinung“ zu tun? Vielleicht
nicht im Begriff , aber in der Aura und im Anspruch?
Ruft
nicht die Versichertengemeinschaft: „Wir sind das Volk?“ Sollen diese
ihre Interessen antitherapeutisch eingestellten Analytikern überlassen?
Oder Soziologen und Philosophen, die nie einen Patienten gesehen haben? Und
sollen Analytiker nur teilnehmende Voyeure sein? Um sich selbst zu Inhabern
von Gegenübertragung zu stilisieren („Selbststilisierung“,
Selbstidealisierung“, auch als Abwehr gegen Zweifel?).
Sollen
Analytiker Verhinderer von guten Lebensläufen sein, mit rechtzeitiger
Schwangerschaft („where are my
childbearing years“? Wohlberg) und rechtzeitigem Aufbau eines Familienlebens? Dies ist weit und breit kein Gegenstand der
Auseinandersetzung, sondern klar Tabu. Wo bleibt hier der Analytiker als
Tabubrecher? Die Darstellung der Couch als Deck- Blatt auf vielen
analytischen Büchern kann kein Alibi dafür sein, dass Patienten nicht
selten ihre Zeit vertun.
Die
Fehler in einer Analyse liegen nicht im Auftrag, sondern woanders (s.o.).
Wie
konnte es überhaupt zu einer solchen Beurteilung kommen? Zugrunde liegt ein
Ideal von Analyse i. S. einer eigenen Welt, die von Störungen aller Art zu
beschützen sei, - also einem Analyse-Zoo,
mit
Eintrittsgeldern). Der
Zoodirektor sorgt für Ordnung. Er übersieht aber, dass Analyse kein Zoo
ist, sondern ständigen Einflüssen von außen und noch mehr von innen, aus
dem Innenleben beider Beteiligter, unterliegt. Umzäunen hilft nicht.
Der
Verweis auf ungute Auswirkung von„Aufträgen“ ist selbst eine Ablenkung,
eine Ausflucht, ein Abwehrvorgang.
Das
Erkennen eigener grober Fehler,
schon bei der Auswahl geeigneter Patienten, erst recht beim weiteren
Verlauf, wird zu diesem Zweck
abgewehrt durch Verneinung, Verkehrung ins Gegenteil, Idealisierung der
Analyse, Verdrängung und vor allem durch Intellektualisierung.
Die
Überheblichkeit, die durch eine solche Haltung zum Ausdruck kommt, die aber
auch noch andere Gründe und Erscheinungsformen hat, hat uns schon viel
geschadet. Sind wir die Gutsherren über die Patienten und deren Anliegen?
Darf nur der Analytiker Interessen haben und nach diesen handeln? Was soll
dies für eine Dyade sein? Doch nicht etwa eine parasitäre? Oder möchten
wir als solche gelten?
Das
Durchbezahlen von Stunden
über längere Zeit hinweg trotz unverschuldeter Umstände wie
unverschuldeter Krankheit oder unverschuldeter Unfälle ist ein alter
Streitpunkt. Der Autor (Bericht eines anderen Analytikers) erwähnt hierzu
einen derartigen zwei(!) monatigen Ausfall der Sitzungen durch einen
unverschuldeten Unfall. Dies könnte bei 5 Sitzungen. / Woche womöglich
einem Honorar von ca. 35.ooo E. entsprechen
Er
schreibt von Rechtfertigung im Fall des Bestehens auf den Honorarzahlungen,
aber auch im Falle des Erlassens. Dann schreibt er aber: „Was wird als Nächstes
passieren? Ein verstauchter Fuß: „Ich kann nicht kommen...“
Werden
hier Patienten unter Generalverdacht gestellt? Zweifellos gibt es Patienten,
welche eine Krankheit vorschieben und so die Therapie blockieren. Am ärgerlichsten
ist für den Analytiker wohl die telefonische Mitteilung, es sei „etwas
dazwischengekommen“. Solches haben wir gewiss alle schon erfahren.
Die
Vereinbarung mit dem Patienten, oft sogar schriftlich, sollte aber nicht wie
ein ehernes Gesetz fungieren. Hier ist daran zu erinnern, dass selbst
staatliche Gesetze nicht unerbittlich angewandt werden. Es gibt neben dem
Befolgen von Regeln auch zwangshaftes Sich- Anklammern an diese. Es soll
keineswegs behauptet werden, dass dies so war. Keine Regel kann uns aber zwingen, unbarmherzig zu sein. Es gibt
einen Ermessenspielraum, oft schon sogar im Gesetz verankert, aber vor allem
dann durch den Richter. Von einem bestimmten Punkt an dürfte auch Sittenwidrigkeit
in Frage kommen. Angesichts der unabsehbar anwachsenden Missbrauchsdebatte
ist auch nicht auszuschließen, dass man das Durchbezahlen eines Tages, wenn
nicht schon jetzt, als finanziellen
Missbrauch oder Ausbeutung eines Kranken ansieht, denn mancher Richter
wird sich wundern, wie es sein kann, dass jemand monatelang im Krankenhaus
liegt und trotzdem laufend für diese Zeit Rechnungen über erfolgte
Behandlungen erhält. Der Patient, vor allem aber sein Anwalt, kann sich mühelos
und mit guter Begründung auf seelische
Notlage und psychische Abhängigkeit
vom Analytiker berufen, die ausgenutzt worden sei. Niemand wird danach
fragen, ob dies auch so vom Analytiker gemeint war und ob und was er sich
dabei gedacht hat. Eine Leistung,
welche den Honorar-Rechnungen gegenübersteht und diese begründen könnte, ist
ja effektiv nicht erbracht worden. Eine Rechnung ohne entsprechend
erbrachte Leistungen ist schon jetzt immer verdächtig auf Betrug, auf vorneherein
ungültige Abmachung, auf Nichtigkeit, auf einseitige Benachteiligung einer
Vertragspartei, oder wird leicht so eingeordnet. Dies sind zwar außeranalytische
Erwägungen, diese wirken aber in die Analyse hinein, wenn diese nach
Genesung des Patienten wieder aufgenommen wird, z.B. in Form von Schuldgefühlen
im Analytiker, von ängstlicher Erwartung des Zorns des Patienten und den
verzwickten Übertragungs- und Gegenübertragungs- Reaktionen und deren
Einflüsse aufeinender.
In
einem mir per Supervision bekannt gewordenen Fall zitierte der Patient die Meinung seiner Ehefrau zu den gestellten
Rechnungen, weil er sich nicht traute, seine eigene Meinung dazu zu
sagen (Abwehr seines Grolls durch Verschiebung auf eine andere Person). Der
therapierende Analytiker hatte höflich und ohne eigene Intervention zugehört,
hatte dann aber selbst bei sich
Atemverhaltung und schließlich einen unguten Tonfall bemerkt, beim
Patienten eine erregte, lautere Stimme, sich dabei auch verschluckt,
sich hierfür entschuldigt, noch einmal geräuspert, ehe er sich fasste
und zur inneren Ruhe kam.
Er
hatte seinem Patienten nicht gerade ein Beispiel für gelungene
Verbalisierung geboten, nahm aber immerhin seine körperlichen Äußerungen
wahr. Einen Erkenntnisgewinn konnte er daraus aber nicht ziehen, wie auch
der Patient nicht, denn das Hin und Her über Schuldgefühle und Zorn
einschließlich seiner Gegenaggression für die erwarteten Vorwürfe war
ohnehin zu erwarten. Damit soll nebenbei zudem gezeigt sein, dass die
leiblichen Sensationen auf beiden Seiten nichts zu weiteren Erkenntnissen
beitragen konnten. Keinesfalls konnten diese leiblichen Erlebnisse das Verständnis
der Stunde für sich vereinnahmen.
Aber
schon vor allem aus analytischer
Sicht kann es einem Analytiker nicht gut bekommen, einen Patienten in
einer solchen Atmosphäre von Misstrauen und Betrug zu behandeln, noch kann
dies einem Patienten gefallen. Was hätte er davon? In solchen Fällen läge
eine derartig tief greifende Störung der Analyse vor, dass diese nicht mehr
möglich wäre: Arbeitsbeziehung nicht zustandegekommen, viel zu negative Übertragung
mit unübersichtlichem Agieren mit Täuschung und Lügen, sogar bewusster
finanzieller Schädigung des Therapeuten, der die ausgefallenen Stunden
nicht einfach mit anderen Patienten auffüllen kann, aber, unter uns gesagt,
ja auch einmal vertieft lesen, sich Bewegung verschaffen oder seine
schriftlichen Praxisarbeiten, darunter auch Rechnungen (wie erholsam gegen
die Schmach des Honorarausfalls) an seine Patienten und die
Krankenversicherungen, aufsetzen kann, und der sich auch klarmachen kann,
dass er ja nicht das ganze Honorar verliert, sondern nur seinen Nettoanteil
nach Abzug der zu zahlenden Steuern, - und
ist bedacht, dass Ausfallshonorare ohnehin nur ein Bruchteil seiner
Einnahmen ausmachen (immerhin demnächst mit Zuschlägen bis fast 97
Euro/Std. , dies oft ohne eigene Angestellte und ohne wesentliche
Raumkosten, und er kann doch 8 Std. tgl. Patienten haben zu je 50 Min.,
Andere arbeiten 14 Std. tgl., also er verhungert ja nun wirklich nicht, er
muss sich doch wegen des Ausfallshonorars keine Sorgen machen, Sorgenfalten
adè, bitte lächeln), - und erzwungener Wut in der Gegenübertragung, alles
von der Bedeutung folgenreicher Symptome, - wenn diese nicht mit Erfolg
sofort gedeutet werden können.
In
solchen Fällen hätte die Analyse sofort beendet sein sollen, und zwar
nicht aus wütender Gegenübertragung heraus, sondern wegen
Aussichtslosigkeit, dies auch im wohlverstandenen Interesse des Patienten,
der sinnlos Zeit, Mühe, Geld opfert und so vergeblich auf bessere Zukunft
hoffen würde. Ich bin in fünfzig Jahren Praxis bestens ohne
Ausfallshonorar ausgekommen, bis heute, wahrscheinlich besser als die mit
Ausfallshonorar. Aber die „Lehre“ will ja angeblich Strenge, Härte. Hart
gegen sich selbst und grausam gegen Andere?
Es
soll dem Patienten helfen, Motiv in Ehren, aber kann solches ihm helfen?
Sind nicht Analytiker mit Ausfallshonorar selbst Opfer? Ich fürchte,
letzten Endes leiden sie noch mehr als ihr Patienten darunter, und dies
wiederum kann sich nur ungünstig auf die Therapie auswirken.
Übersehen
wird also, welche psychische
Belastung das Ausfallshonorar für den Psychotherapeuten mit sich bringt.
Zeit für eine kleine Innenrevision, verehrte hoch- mögende
Analytikerschaft. Gibt es bei Ihnen etwas wie eine psychische Ökonomie? Der
Sinn dafür kann sich noch entwickeln, dafür ist es nie zu spät.
Zum
Setting im Liegen:
Über dieses ist viel geschrieben worden. Hier sei nur auf das, was im Buch
vertreten wird, eingegangen. Der Autor zitiert (Reiche R 2001):.. „eine
Situation, durch die basale soziale Konventionen der Reziprozität, der
affektiven Kontrolle, der Maskierung und des Anstands systematisch außer
Kraft gesetzt werden.... Diese Situation kommt so in der Lebenswelt sonst
nicht vor. .. dass sich die Form... mit Inhalt (...Material) zu füllen
beginnt.“
Dies
kann nicht zutreffen. Reziprozität, affektive Kontrolle, Maskierung und
Anstand sind nicht weniger als bei anderen Begegnungen gegeben, sogar
eindeutig mehr, was die Maskierung angeht. Sie sind nur anders, völlig
ungewohnt. Ohne diese wäre es ja ein Tollhaus. Maskierung ist bei der
Liege-Analyse auf beiden Seiten sogar noch mehr der Fall, allein schon, aber
nicht nur, auf optischem Kanal. Warum soll der Anstand außer Kraft gesetzt
sein? Einer Rhetorik kann man nicht gestatten, die Psychoanalyse im Liegen für
sich zu vereinnahmen.
Anderes
ereignet sich für den Patienten: Die ungewohnte Anordnung versetzt den
Patienten anfänglich in Angst und
Schrecken. Von Entspannung zunächst keine Spur. Die Patienten,
besonders Frauen, haben zunächst eine Abneigung
gegen diese Situation, weil sie sich
in eine eindeutig erwachsen-sexuelle und zugleich kindlich-hilflose Position
(wie kann es sein, dass ausgerechnet Analytiker diese simple Tatsache
nicht sehen wollen?) genötigt fühlen
(„höflich hingeschubst“, wie schon seinerzeit die Analytiker selbst
als Ausbildungskandidaten.)
Dies
muss irgendwie auch in die gesamte
analytische Behandlung und Ausbildung einfließen. Wer geschubst worden ist und zum Kind gemacht worden ist, ist versucht,
selbst Andere zu schubsen und zu Kindern zu machen. Der Zorn darüber
wird abgewehrt durch Identifikation mit dem Aggressor. Je mehr einer
geschubst wird, wie z.B. Ausbildungskandidaten, desto mehr wird er Andere
schubsen. Es geht ja nicht nur um die
Liegeposition, sondern um deren Implikation, dass in die Kindheit zurückzufallen
sei, und nicht einmal ein Ausbildungskandidat würde sich dem
unterziehen, wäre er nicht durch die Ausbildungsrichtlinien dazu gezwungen.
Die Lehranalyse ist ein grimmiges und quasi-religiös beschworenes Tabu.
Dem
stehen aber die elementaren Wünsche
nach Fortentwicklung, nach Progression, entgegen, nach Erwachsenwerden
und Erwachsensein. Die Teleologie umkehren zu wollen, muss scheitern.
Patienten
und Ausbildungskandidaten überwinden diese Abneigung, weil sie von dieser
Position gehört und gelesen haben und sie an
deren Heilkraft glauben. Dieser Anfangs-Schreck muss überwunden
(abgewehrt) werden, durch Wendung vom Passiv (der zu ertragenden ungewohnten
Situation) ins Aktiv, indem der Patient Einfälle produziert, und durch
Identifikation mit dem Aggressor, also durch Weitergabe an Andere.
Die
offensichtliche Vorstellung des Autors und des zitierten Autors, durch das
Setting im Liegen sei ein Hohlraum
entstanden, den der Patient auffülle, scheint mir rein mechanistisch und
intellektualisierend, auch isolierend (beides gegen die zwangsläufig
evozierten sexuellen Wünsche) zu sein, außerdem eine Anleihe an die z.
Z. so beliebten Raumvorstellungen, ohne
dass das eigentlich Analytische in Betracht gezogen würde, also das, was im
Patienten vorgeht, namentlich der Konflikt zwischen erwachsen-sexuellen Wünschen
und deren Abwehr wegen der Schuld- und Schamgefühle und Ängste.
Es
geht nicht darum, ob ein Raum aufgefüllt wird, sondern es muss die Frage
sein, was genau sich im Patienten selbst und im Analytiker abspielt. Diese Frage wird erst gar nicht gestellt.
Hier scheint das Gefühlsleben von Patient und Analytiker durch Isolierung
und Intellektualisierung als lästig abgewehrt zu werden.
Nach
Ausführungen von Küchenhoff (2006, im Buch zitiert S 173) und des Autors
selbst stellt der Autor in Frage, ob im „Couchsetting“
der Patient und der „Hintercouchler“ (Moser, Tillmann, 1977).. „immer
in der bestmöglichen Weise aufeinander bezogen sind“ oder ob das Gegenübersitzen andere
Wahrnehmungs- und Behandlungsmöglichkeiten bietet, nämlich die
visuellen mit weit differenzierteren Mitteilungsmöglichkeiten (S 174).
Der
Autor findet zu der Formulierung (S 173), nicht das Setting sei
entscheidend, sondern die „Arbeit an der Optimierung der Symbolisierungsfähigkeit...,
damit Worte das Erbe der nonverbalen und präverbalen Kommunikationsfähigkeit
in sich vereinen können“:
Hier
wird gemäß dem Regressionsmodell
unterstellt (aber nie beschrieben!),
dem Patienten mangele es an Symbolisierungsfähigkeit, - eben weil er so
regrediert sei und weil die Theorie solches verlange. Die gefundenen Worte
sollen das Präverbale und Nonverbale beerben. Das Nonverbale gewiss, aber
ob es immer das Präverbale sein muss, wird nie in den Fallbeschreibungen
dargestellt. Man kann auch sagen, die
Darstellung des Nonverbalen durch Worte ist schwierig genug, sie muss nicht
noch das Präverbale einbeziehen, um Symbolisierungsfähigkeit zu
beweisen.
Die
zweite Frage ist, ob nicht der
Verbalisierungsfähigkeit zuviel Aufmerksamkeit zuteil wird. Ist sie
wirklich für die Heilung so entscheidend? Ist nicht das Erleben wichtiger?
Wieder
schreibt der Autor auf der gleichen Seite: „...wenn der Analytiker sich
auf die innere Welt früher (! Verf.) unbewusster (Körper-) Phantasien
zentriert“. Und was ist mit den später erworbenen Körperphantasien?
Soll sich
mit diesen der Analytiker nicht befassen?
Und
woher will er wissen, ob diese früh oder spät erworben wurden?
Sie
kann früh erworben sein, - dies kann aber nicht heißen, dass der Patient
auf diese zurückgreifen muss,
wenn er eine Körperphantasie entwickelt. Er kann ganz einfach auf das zurückgreifen,
was ihm jetzt zur Verfügung steht, - er
muss doch dazu nicht regredieren.
Der
Autor neigt aber dazu, Leibliches
automatisch der frühen Zeit mit der Mutter zuzuordnen und folgt
damit unreflektiert der Tendenz zur Pathologisierung und Infantilisierung
durch „Regression“
oder Traumatisierung. Denn wenn „frühe“ Erscheinungen auf den Plan
treten, muss der erwachsene Patient ja sehr krank sein.
Hier
unterliegt der Autor- in bester Gesellschaft – dem Denkfehler, Zeit und Pathologie miteinander zu vermengen und zu
verwechseln.
Für
die Zukunft ist eine erweiterte Bearbeitung des Themas unter Einbeziehung
auch der ödipalen, der jugendlichen, der erwachsenen Position, hier namentlich der Erwachsenensexualität und Erwachsenenaggressivität
denkbar und wünschenswert, - warum nicht vom gleichen Autor?
Insgesamt
ein sehr umfangreiches, ein neues Feld bearbeitendes, verdienstvolles,
zukunftsweisendes Werk, das der Sache entsprechende Fragen aufwerfen muss,
das aber fortgeschrittenen Analytikern, die mit hochfrequenter Analyse
Erfahrung haben, zu empfehlen ist.
Der
Autor reflektiert auch immer wieder seine Beziehung zur
analytischen Gruppe, mit der er offenbar regelmäßig Kontakt halte (...“ im arbeitenden
Dialog mit sich selbst und seiner Gruppe“, S 54). Diese fungiert als ein
Quasi- Supervisor, und entsprechend sind die Hoffnungen, Ängste, Schuld-
und Schamgefühle und Abwehren dieser Gefühle in der Gegenübertragung des
Autors auf die Gruppe. Auf die
Schwierigkeiten von Fallvorstellungen in einer analytischen Gruppe (wie
übrigens auch vor einem Supervisor)
geht der Autor aber nicht ein, obwohl diese bekanntermaßen immens sind (Krill
2008, 227 ff: schlammige Situation). Es
gelingt nur noch, die Meinungen der solchen Gruppe zusammenzufassen, indem
einige Stimmen absichtlich unterdrückt werden und in daher einer etwaigen
Zusammenfassung nicht mehr repräsentiert sein dürfen, weil sie der
Mehrheitsmeinung und vor allem der Meinung des Seminarleiters zuwiderlaufen.
Über den möglichen Gewinn s.o.
Fast
immer bilden sich eine Dreiergruppe, meist von Gutvernetzten, im Institut
Einflussreichem (LA) mit anderen Gutvernetzten und im Institut
Einflussreichen, während die Feindseligkeitsverbindungen dazu neigen,
geradzahlig zu sein (eigene Beobachtung und gemäß Silvio Dahmen, FAZ
4.11.15, S N2)
Naturgemäß
sind die Netzwerke der Frauen in einer analytischen Gruppe, wie schon in der gesamten Kindheit und Jugend und später, enger
und feinmaschiger. auch weit fester, obwohl auch sie durchaus
Meinungsverschiedenheiten untereinander austragen. Der gegenseitige
Austausch unter Analytikerinnen ist weit intensiver, vor allem
anstrengungsloser.
Fall: „Ich verrätsele mich immer- da, wo ich spreche, bin ich nichts“
und Folgen (S
67 ff).
Hier
handelt es sich um eine sehr eloquenten, rhetorisch begabten Patienten. Er
erhält die Diagnose „Borderline“, aber nirgendwo ist vermerkt, nach
welcher Nomenklatur diese Diagnose gestellt wurde (Kernberg? Rhode- Dachser?
ICD-10?). Die vertrackten kleinianisch-- theoretischen Gedankengänge machen
es dem Leser schwer, den Überblick zu behalten und zu verstehen, was der
Autor selbständig sagen möchte und sagen kann. .
Dazu
kommen identifizierbare handwerkliche
Fehler,
so öfters das Wort „psychosenah“ (S 70, 72) oder „psychotisch-
panisch“ (S 71), ohne dass der Autor sich bemüht, das angeblich
Psychosehafte zu begründen. Für „pychosenah“ dient auf S. 72 lediglich
die Begründung: „Zustand, in dem er sich nicht in der Lage sah, die von
innen oder außen auf ihn einströmenden Reize adäquat zu bearbeiten“.
Aber
wer kann das schon? Adäquat bearbeiten? Dies nicht zu können, bedeutet
nicht einmal Krankheit. Der Autor unterscheidet hier nicht genug zwischen Phänomenen
des Alltags und krankhaften Symptomen. Hier wird kräftigst pathologisiert,
und dazu das Wort Psychose missbraucht, um sich Gehör zu verschaffen. Hier
wird der Wald (Psychodynamik und psychodynamische Diagnose) vor lauter Bäumen
(„Mikroprozess“) nicht mehr gesehen.
Vor
allem ist von „Psychose“ keine
Spur, nicht einmal gesagt, um welche Art von Psychose es sich dabei
handeln soll (eine hirnorganische Psychose? eine depressive Psychose, ICD F
33.3, ((immerhin 4 % der Bevölkerung))? eine schizophrene Psychose ((1 %
der Bevölkerung))?) noch bemüht sich der Autor um den Nachweis oder das
Glaubhaftmachen einer Psychose. Hier wird zudem sogleich eine Unfähigkeit
des Patienten, ein Defekt, unterstellt, statt die Psychodynamik der Übertragung
und Gegenübertragung darzustellen.
Auch
auf S 80 („..nicht in einer lärmend-offensichtlichen, also manifest
psychotischen Form..“ wie auch
auf S 97 (...„nicht in einer lärmenden Weise wie beim Psychotiker- übrigens:
Welche Art von Psychose meint der Autor eigentlich? Besteht dafür nur
Desinteresse?) lässt der Autor eine stabil
- laienhafte Vorstellung von einer schizophrenen Psychose erkennen, -
als ob diese solche Merkmale aufweise, am besten tobend, grimassierend, mit
den Augen zwinkernd, augenrollend, mundverziehend, schreiend und mit den
Armen fuchtelnd. Kein Interesse an der Sache? Woher sind solche
Vorstellungen bezogen? Aus schlechten Filmen, von unwissenden,
sensationsheischenden Regisseuren? Aber vor allem wohl aus der
psychoanalytischen Literatur selbst, aus immer wieder gedankenlos
Abgeschriebenem und Zitierten, ohne eigene Nachprüfung und Beurteilung.
Keinen Blick in ein Psychiatrie-Buch oder eine Zeitschrift für Psychiatrie
riskiert? So klingt es.
Nicht
nur Faktenabstinenz, sogar Faktenresistenz, erscheint der heutigen
Psychoanalyse in diesem Punkt wichtiger. Unbesiegliche Unwissenheit.
Auch
wenn oder gerade weil es Psychoanalytiker notorisch nicht lesen und hören
wollen,
darf man sie doch auf die Sache hinweisen, einfach dadurch, dass es hier
endlich und deutlich einmal steht. Diese könnten doch einmal ganz einfach
lesen, was sie sonst nie lesen, obwohl
sie über Psychosen schreiben. Nach der längst fälligen Abwehrdeutung
(Deutung der Abwehr durch Vermeidung: „Sie vermeiden, das zu lesen, was
Sie versäumt haben zu lesen, - weil Sie sich den Schmerz und das Schamgefühl
ersparen möchten, in Ignoranz verharrt zu haben. Sie können aber lernen,
diese beiden unangenehmen Gefühle zu ertragen, denn Sie sind ja kein Kind
mehr, sondern erwachsen“.), kann es sein, dass ihnen dies leichter fällt.
Der Rezensent vertraut auf Abwehranalyse, und kann es nicht übers Herz
bringen, ihnen, deren Patienten und deren Supervisoren samt Institut, schon
gar nicht den Ausbildungskandidaten, diese vorzuenthalten.
Uncharakteristisches
Basisstadium (Vorpostensyndrome, Prodrome, unproduktives, asthenisches
Basisstadium, vorauslaufende Defizienz, reiner Defekt, also reine Residuen,
oder Defizienzpsychosen , dynamische Insuffizienz, reiner Defekt (so ein
„braver, scheuer, zurückhaltender Mensch, Janzarik 1975, S 242), Kompensationsversuch,
komplizierter psychischer Überbau,
(Süllwold, Huber et al., - während der Psychoanalytiker Paul
Schindler auch die Möglichkeit sah, den reinen Defekt als Abwehr in
weitestem Sinne zu sehen, 50iger Jahre) ), produktives
Stadium (mit Kommentarstimmen, auch evtl. Hören des Eigenamens, einer
evtl. persistierenden Halluzinose (meist akustisch und olfaktorisch, selten
optisch) erstrangigen Wahnsymptomen mit thematischem Ausufern, unter Verlust
von engen Bindungen an individuelle Strebungen und Werthaltungen, schweren
Ausdruckstörungen und Verhaltensauffälligkeiten wie Grimassieren,
motorischen Auffälligkeiten bei der Katatonie), schizophrenes
Residuum mit den Erscheinungen der verminderten Leistungsfähigkeit
(„Potentialreduktion“ nach Conrad, „dynamische Entleerung“ nach
Janzarik, Verlust automatisierter Fähigkeiten, Störbarkeit, Unbeständigkeit,
Konzentrationsschwäche, Denkstörung (Sperrung, Gedankenabreißen,
Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Gedankenübertragung, „Hypnose“,
Gedankeneingebung, Denkzerfahrenheit bis zum Faseln, bis zur Verworrenheit,
geringer ausgeprägt als „Danebenherreden“, auch als beschleunigter
Gedankenduktus mit leichter Inkohärenz), Verlust an Initiative,
Entscheidungsfähigkeit und Durchhaltevermögen, mit der sozial enorm störenden
affektiven Verflachung, Verarmung in den Reaktionsmöglichkeiten, verbaler
Spracharmut) und bei Verlust auch
nonverbaler Fertigkeiten (kann nur wenig Information vermitteln durch
Gesichtsausdruck, Stimm- Modulation, Körperhaltung, Gang und Gebärde (Wing
1975, 35) und somit ein Verlust an Mitteilungsfähigkeit, Spracharmut,
Verlangsamung infolge ständig eindringender Nebenassoziationen und
erschwerter Entscheidung über die notwendigen Erinnerungen und Vergleiche
mit ähnlichen Situationen, sowie mit ausgedehnten Vermeidungen äußerer
Reize (so gesenkter Blick, Vermeidung von Lesen und Sprechen), um die innere
Verwirrung zu mindern („Pseudoneurotische
Schizophrenie“, pseudoneurotische Formen von autistischem Rückzug, oft
als „borderline“ bezeichnet, „blande Schizophrenie“,
„Minussymptomatik“, was sich auch als Abwehr
äußerer Einflüsse verstehen lässt, die dem Schizophrenem nicht gut tun,
- sozialer Rückzug also als Abwehr).
Ein
gefühlsmäßiges „Erfassen aus der Beziehung“, eine Anmutungsqualität
(sog. Präcoxgefühl, Bumke), ist oft möglich (Kurt Schneider, zit nach
Glatzel & Marneros 1975).
Die
„Minussymptomatik“ sowie der
ganze soziale Rückzug mit Verlust on Freundschaften, Partnerschaften und
Ehen (oder deren Vermeidung) lassen sich teilweise auch als Abwehrreaktion
gegen Scham und Angst vor der Entdeckung der Denkstörung verstehen (Wing
dito, 34).
Andere
wichtige Frühsymptome sind: Interessenverlust, dafür manchmal
absonderliche Interessen, Wahnwahrnehmungen (echte Wahrnehmungen, die aber
falsch interpretiert werden), Misstrauen, passagerer Wahn (mit oder ohne
Stimmenhören), der dann nach schon 2 Stunden, aber auch noch nach einer
Woche wieder abklingen kann, später evtl. verstärkt als echter,
einstweilen dauerhafter Wahn i.S. einer unverrückbaren Überzeugung
auftreten kann, Veränderungen im Wesen, das Anderen auffällt, das der
Erkrankte aber auch selbst genau spürt und – meist unbeholfen- selbst
beschreiben kann, aber dies auch meistens nur, wenn er genau danach
exploriert wird , ferner Antriebsverlust, sodass er z.B. morgens kaum aus
dem Bett kommt, psychische Empfindlichkeit auf früher belangslose Reize,
Konzentrationsstörungen, Denkstörungen (Danebenherreden, Nichtverstehen
einer Pointe in einfachen Comics, Gedankenlautwerden, Gedankensperrung,
Gedanken- Steuerung durch Andere, Gedankeneingebung, Gedankenausbreitung,
Gefühl, hypnotisiert zu sein, bestrahlt oder sonstwie beeinflusst zu
werden, Eindruck des „Gemachten“, Fälschlich werden solche oft nur
schwach ausgeprägten Symptome regelhaft als Adoleszentenkrise von
Nichtpsychiatern verkannt und bagatellisiert, wodurch wertvolle Zeit für
die Therapie verloren geht.
In
den ruhigen Stadien zeigt sich – abgesehen
von 10 % Totalremissionen -, dass
der Lebensweg nicht dort wieder aufgenommen werden kann, wo die
Kontinuität psychotisch unterbrochen worden war.
Für
ein Studium können Initiative, Ausdauer und Konzentration nicht mehr genügend
aufgebracht werden, im Beruf mangelt es an Selbstständigkeit,
Selbstsicherheit und Selbstverständlichkeit (Blankenburg 2012), und zu
Hause ist die Emotionalität zu den Angehörigen gestört und darf nicht
intensiv werden (Janzarik 1975, 234).
Schizophrene
verschlechtern sich sofort bei ungünstiger Einwirkung von außen (i. Ggs.
zur psychotischen Depression),
nämlich bei Überstimulation (Ereignisse,
Einladungen mit mehreren Personen, zu anspruchsvolle Gesprächskontakte)
wegen Störungen des Sprachflusses und Sprachverständnisses,
(während der Angstneurotiker hierin immer besser wird, wenn er sich
beruhigt hat, d.h. vergewissert hat, dass ihm keine Gefahr droht),
Konfrontationen mit
Leistungsanforderungen, bei zu intensiver Zuwendung, unübersichtlichen
Situationen, so auch unruhigen Straßen, öffentlichen Plätzen, vor allem,
wenn diese Situationen zu lange andauern, bei Zeitdruck), bei Ermüdung und
emotionaler Erregung, weil ihnen die
notwendige Selektion von Ereignissen, Erlebnissen, Sinneswahrnehmungen,
gezielten Erinnerungen schwerfällt, - und damit die Unterscheidung
zwischen bedeutsamen und unbedeutsamen Aspekten.
Ein
großes Therapiehindernis ist die ständige Fluktuation
im Befinden. Die Gestörtheit kann von Minute zu Minute schwanken. Dass
Grundproblem im Basissyndrom ist, dass der Schizophrene verwirrt ist durch
zuviel „Müll“ , d.h. mit zu
vielen Erinnerungen, Gedanken, Gefühlen, darunter auch stets
eindringenden unpassenden, weil ihm die
Selektion nach Bedeutung erschwert ist und zu viel Zeit braucht.
Um
das Richtige, Passende auszusortieren, braucht er viel Zeit, daher die Verlangsamung,
das scheinbare Trödeln, das Fehlen der raschen Erledigung, der Verlust
automatisierter Fähigkeiten bei auch einfachsten Vorgängen wie
Waschen, Anziehen, das Haus verlassen, die Haustür abschließen, Ausweichen
vor täglichen Kleinarbeiten, mit der Notwendigkeit, diese einfachen Abläufe
wieder einzuüben (Unterschied zur
Zwangsneurose: Hier konfliktbedingt
Ängste, etwas falsch zu machen, einen Schaden anzurichten, Schuldgefühle).
Um
sich geordnet und unauffällig zu verhalten, bedarf es größter
Anstrengung. Der ständig drohenden Verwirrung muss der Schizophrene mit ständig
erhöhter konzentrativer Anstrengung begegnen (in Anlehnung an Süllwold
1975).
Denn
im Gegensatz zu Neurosen und endogenen Depressionen sind Schizophrene durch
alltägliche Ereignisse ohne besondere Bedeutung für sie überaus
empfindlich und reagieren leicht mit einem neuen Schub. Die Bedeutung
der Ereignisse ist hier ganz unwichtig.
Ohne
eine inhaltliche Bedeutung zu haben, zeitigt deshalb auch die intensive
und langdauernde emotionale Zuwendung von Angehörigen katastrophale
Auswirkungen auf den Schizophrenen. Augenblicklich kann es zu einer
Exazerbation kommen.
Die
endogene Depression ist weitaus unempfindlicher gegen Ereignisse, eigentlich
empfindlich nur auf solche, die der Patient als schädigend erlebt.
Gruppentherapie
ist aus diesen Gründen extrem symptomprovozierend, und entsprechend
katastrophal fielen auch die Ergebnisse von Gruppentherapien aus, wegen der
damit verbundenen Überstimulierung
(Heinrich, K 1975, Wing J K 1975) besonders, wenn sich Omnipotenzphantasien
Unerfahrener mit der maßlosen Gegenerwartung der Patienten paaren (Huber
1975, 306, Janzarik 1975 306), außer, wenn die Gruppe streng kohärent, streng aufgabenzentriert, themenzentriert, mit klaren
Instruktionen und einer klaren Hierarchie, mit klaren Rollen und Aufgaben in
Richtung Realitätssinn, Eigenständigkeit, Selbstbehauptung, Ausdauer (Janzarik
dito), mit speziellen Trainingsprogrammen, mit Vermeidung von Lärm,),
arbeitet, und die Gruppe geschützt war
vor Spontaneität, so zwischen Betreuungspersonal, Ärzten und Patienten
oder gar sog. freier Assoziation, wie sie bei Neurosen üblich und förderlich
ist, und vor einer Mischung aus Privatheit und therapeutischer Aufgabe, wie
sie sonst üblich und günstig ist.
Vermeidungen
sind hier
– anders als bei neurotischen Störungen- zu
gewähren, sogar zu fördern, statt sie aufzulösen, - weil der Patient
diese braucht, um sich zu sammeln und vor einem Zuviel an Eindrücken zu schützen.
Diese
Defizienzen werden oft zu wenig beachtet.
Eindrücklich
ist auch die unterschiedliche Ermüdungskurve:
Der Schizophrene kann, wenn übermäßige Reize vermieden werden, im Gespräch
immer leistungsfähiger werden, bis die Sitzung zu Ende ist; - dann ist es
aber mit der gewonnenen Leistungsfähigkeit ruckartig zu Ende, und der
vorherige Zustand ist wieder erreicht . Beim Hirnorganiker hingegen sinkt
die Leistung von Anfang an mit laufender Beanspruchung ab.
Bei
den schizophrenen Vorpostensyndromen
(viele Jahre vorauslaufend) oder auch den späteren
Prodromen (3-5 Jahre vor Ausbruch des produktiven Bildes) und den
der produktiven Phase folgenden Defizienzsyndromen ist die psychodynamische
Unstetigkeit (innerer Konflikt!) der Neurosen, namentlich der engen
Wechselseitigkeit ihrer Ich-Umweltbeziehungen nicht gegeben, sodass hier
auch grundsätzlich der psychotherapeutisch-psychoanalytische Eingriff
schwieriger erscheint.
Während
produktiver Phasen, erst recht bei den schizophrenen
Kleist- Leonhardschen Emotionspsychosen, kommt wegen der emotionalen Überschwemmung
des Erlebnisfeldes ohnehin eine psychotherapeutische / psychoanalytische
Hilfe nicht in Betracht, wenn diese Überflutungen auch rasch wieder
abzuklingen pflegen.
Außerdem
machen die verschiedenen angewandten
analytischen Methoden (und die Abweichungen von diesen angegebenen
Methoden!) und die Persönlichkeit des Therapeuten die Lage, das
Vorgehen und die Ergebnisse noch variabler und unsicherer, d.h. noch
schwerer objektivierbar (Matussek 1975, 176).
Wie
steht es denn mit der leiblichen Dimension bei diesen Formen der
schizophrenen Psychose? Dazu
hätte der Autor, ebenso andere Autoren über dieses Thema, auch die
richtigen Patienten haben müssen, konnte er aber als Psychologe kaum haben.
Es wäre aber eine Aufgabe für die
Zukunft.
Eine
vernünftige Alternative ist: Wenn man nichts von schizophrenen Psychosen
versteht, insbesondere keine eigene Erfahrung davon hat, soll man auch nicht
darüber schreiben (frei nach Wittgenstein).
Wiedereingliederung
in den Universitätsbetrieb bei soviel Ignoranz adé. Wieviel Zähne hat ein
Pferd? Bloß nicht ins Maul sehen, war die Devise der Scholastiker.
Sehr
viele Psychiater lesen psychoanalytische Literatur, besuchen analytische
Seminare, aber welche Analytiker interessieren sich für psychiatrische
Literatur? Wer muss sich hier bewegen?
Wird
einfach eine „Psychose“ behauptet, darf natürlich der „präsymbolische
Konkretismus“ nicht fehlen. Dass der Analytiker.. gänzlich anders
verstanden und erlebt wird, als er sich selbst versteht und erlebt“, - na
und? Warum soll dies ein Zeichen von
präsymbolischem Konkretismus sein? Das ist doch Alltag. Sogar gesunde
Personen missverstehen sich in dieser Weise ständig. Bedürfnis, ins Blaue
hinein zu pathologisieren, ist eine Gewohnheit vieler Analytiker, auch aus
blanker Ignoranz der psychischen Variationsbreite und aus dem Bedürfnis,
sich dann so ganz nebenbei als großen Heiler eines Schwerstkranken
darstellen zu können und Verehrung zu genießen.
Außerdem
ist auch kein Versuch erkennbar, das häufige Unvermögen des Patienten zu
berücksichtigen, sich sprachlich treffend auszudrücken. Das Gegenteil ist
offensichtlich.
Das
Gleiche gilt für das Wort „bizarr“ (S 97). Es genügt dem Autor
offenbar, hier Schlimmes anzunehmen. Diese Nachlässigkeit ist auch
US-amerikanischen Gewohnheiten geschuldet, die, besonders an der Westküste,
mit dem Begriff „Psychose“ großzügigst umgehen.
Handwerkliche
Fehler bestehen auch in übermäßigem
Gebrauch von Metaphern (die nie etwas beweisen können) und in
sprachlichen, dramatisierenden Entgleisungen, die vom sonst hohen
Sprachniveau zurückfallen, wie auf „S 82: „tödliches Dilemma“ und
auf S 98 „tödliche Dimension“. Muss ein Dilemma immer gleich tödlich
sein? Reicht nicht „Dilemma“? So auch
S 82: „Vernichtung der Wirklichkeit“. Bis jetzt hat der Patient
immerhin überlebt, und welche Wirklichkeit soll vernichtet sein? Auch das
Mode-Wort „Gewalt“ (S 83: „vernichtende psychische Gewalt“) fehlt
nicht. Ist nicht mittlerweile fast alles „Gewalt“, und was, bitte sehr,
soll diese hier vernichtet haben?
Solche
Bekräftigungen von Beschwörungscharakter weisen immer darauf hin, dass den eigenen
Beschreibungen nicht geglaubt wird, und solches auch von Anderen nicht
erwartet wird, der Autor da also nachhelfen möchte, wo die Argumentation
nicht reicht.
Die
Psychodynamik lässt sich vielmehr kennzeichnen als ein narzisstisches Spiel des wortgewandten und wortreichen, wirklich
poetisch begabten (aber ohne Neologismen!) Patienten mit dem Therapeuten, von dem dieser sich beeindrucken lässt
und für das er den Patienten
bewundert.
Ein
weiterer handwerklicher Fehler ist das notorische
Gleichsetzen von Klagen / Beschwerden des Patienten mit Befunden,
wie es überhaupt in analytischer Literatur häufig gehandhabt wird,
kritisiert von Brenner 2003 und Krill 2008, 16, 20).
So
heißt es auf S 94:.. „dass die permanente Klage nur die äußere Seite
einer chronischen Verzweiflung und Angst vor katastrophaler Desintegration
war“. Dass vorgebrachte Beschwerden immer schon auf Motiven (Wünsche nach
vermehrter Aufmerksamkeit des Therapeuten, Angst, dass die Wünsche nicht
erfüllt, sondern abgewiesen werden, Schuld- und Schamgefühle, so bedürftig
zu sein und den Analytiker derart zu beanspruchen) beruhen und somit zuvor
der Abwehr unterliegen müssen, ist anscheinend nicht bedacht. Der Symptom
(Kompromiss-) Charakter der Beschwerden wird nicht beachtet. Soll das
Sich-Hilflos-Geben das gleiche sein wie hilflos sein? Wenn ein Patient sich
als schizophren bezeichnet, - soll er deshalb wirklich schizophren sein?
Weist die Klage, nicht zu wissen, was real und was unreal ist, darauf hin,
dass die Realitätswahrnehmung gestört ist? Ist ein Patient, der dauernd
Lokolage statt Schokolade sagt (eigene Beobachtung), wirklich
„regrediert“, - womöglich auf ein Alter, in dem er als Kind erst
sprechen gelernt hat?.
Hat
ein Patient, der von sich sagt, er fühle sich wie in tausend Stücke
zersprungen, deshalb ein fragmentiertes Selbst nach Kohut oder Fairbairn
oder wird hier die aggressive Phantasie, Andere in Stücke zu schlagen, nur
durch Wendung gegen sich selbst abgewehrt? Patienten, denen ein Leeregefühl
unterstellt wird: Sind sie
wirklich leer oder sind sie voller Angst und Trauer und geben Leere an, um
Zuwendung zu erhalten und weil sie wissen, dass der Analytiker solches gerne
hört, geradezu darauf fliegt? Und sofort zur „Auffüllung“ der
vermeintlichen Leere bereit ist? Der
Patient dürfte diese seine Aussage über sich selbst längst mit der
Wirklichkeit abgeglichen haben, viele Analytiker nicht. Es werden
„Befunde“ erhoben, wo keine sind.
Muss
ein Patient, der von sich klagt, in ihm wüte eine böse Macht, deshalb ein
böses Introjekt nach Fairbairn oder M. Klein in sich tragen?
Die
Abwehr dürfte darin bestehen, dass aggressive Gedanken ein(e)
Vergeltungs-Angst- Schuld –oder /und Schamsignal wegen dieser bösen
Gedanken ausgelöst haben, die dann ihrerseits Abwehr durch Verdrängung,
Wendung gegen die eigene Person und eine Vermeidung (des Themas) und
Verschiebung (nicht der Patient, sondern eine böse Macht in ihm soll
aggressiv und damit schuld sein), (nach Krill 2008, 20).
Aber
von dieser Psychodynamik wollen viele Analytiker heute nichts mehr wissen,
weil sie ihnen zuviel Mühe bereitet. Einfacher ist die statische
Vorstellung, es sei nun einmal ein böses Introjekt eingedrungen.
Modellvorstellungen setzen sich durch, weil sie einfacher zu handhaben sind,
als sich mit der Psychodynamik auseinanderzusetzen.
Und
ist diese Vorstellung vom bösen Introjekt im Patienten nicht auch eingängig-
angenehm für den Analytiker? Ist er doch so nicht vom Patienten
angegriffen, sondern nur von dessen Introjekt. Das „Böse“ wird so doch
nur „outgesourced“, und beide sind` s zufrieden (nach Krill 2008, 20).
Kollusive
Gegenübertragung und Übertragung nennt man das, - gemeinsame Abwehr des Bösen,
um „Ruhe“ zu haben. Aber wir haben nie Ruhe, - ist das vergessen? Die
Psychodynamik wird nicht beachtet, sondern durch statische Vorstellungen von
„Introjekt“ ersetzt. „Introjekt“ ist unreflektiert oft wie
„Defekt“ gebraucht.
Zum
Schluss noch einige prägnante und
einleuchtende Sätze (zitiert oder vom Autor selbst, S 178-185):
Der
Analytiker soll seine eigene leibliche Befindlichkeit als Resonanzraum zur
Verfügung stellen......für einen aufmerksamen Eigenbezug des eigenen Körpers
plädieren...höre ich nicht nur auf meine Gegenübertragungsgefühle,
sondern auch auf die körperlichen Manifestationen und Körperphantasien,
die sie begleiten...die ganze Person ist das Wahrnehmungsorgan...... es
gehen auch Kräfte von ihm aus, die vom Analysanden als ganzer Person
wahrgenommen werden... analytische Arbeit ist körperliche Arbeit....das Hören
ist nicht nur Hören auf den Analysanden, sondern auf das eigene Reagieren
und Ergriffensein. Hierzu gehören auch Bewegungen weg von der Präsenz des
Analysanden, Entzug der Aufmerksamkeit, Weghören und Wiederhinhören...gewisse
Leibferne der Psychoanalytiker... Widerstand, zusätzlich zum sprachlichen
Umgang miteinander ..
(den) körperszenischen Ausdruck mit einzubeziehen...Nacktheit des
unmittelbaren Eindrucks.... Empfindungsobjekt...läuft unseren Vorstellungen
von Abgegrenzheit ,, Neutralität und Abstinenz zuwider... sensomotorisch -
affektive Erfahrungen in der therapeutischen Interaktion, d.h. der Körperresonanz
zwischen zwei Personen ...sinnliche Umgangsqualitäten der inneren und äußeren
Objekte annehmen“.
Man
kann schon der Vielzahl der Formulierungen ansehen, wie schwierig der
Gegenstand ist.
Aber
eine Psychoanalyse zu kreieren und auszuführen, die nicht funktioniert, weil sie Therapeuten wie Patienten überfordert,
ist leicht.
Die
Frage ist, ob diese angestrebte
Optimierung durch besondere Berücksichtigung der Leiblichkeit und des
leiblichen Austausches wirklich
gebraucht wird. Brauchen unsere Patienten wirklich das Beste vom Besten? Wir
sehen ja heute auch auf anderen Gebieten üble Folgen des Optimierungswahns. Psychoanalyse
sollte sich, wie anderen Therapien auch, auf das beschränken, was die
Patienten wirklich brauchen. Sonst hätten wir viel Aufwand für wenig
Ertrag. Aufwand und Erfolg müssen in
einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Hiermit hat Psychoanalyse
ohnehin ein Problem (wohl auch bereits in der überzogen anspruchvollen,
zuviel versprechenden Ausbildung).
Sie heilt, - dies wird ihr aber wenig darin nutzen, in Konkurrenz mit
anderen Verfahren zu bestehen. Nein, sie muss angesichts des Aufwandes an
Zeit und Geld schon exzellent wirksam sein. Diese Überlegungen gehen aber
nicht gegen das Buch.
Der
Autor möchte aber das Konzept von der leiblichen Dimension auch theoretisch weiterentwickeln und kommt zu interessanten Anregungen,
die den Leser zum Nachdenken auffordern. So entstand im Rezensenten die
Frage, ob man den Erfolg einer Psychoanalyse künftig auch daran messen
kann, in welchem Ausmaß vom Patienten leibliche Sensationen geäußert
werden können.
Künftig
auf die Leiblichkeit mehr zu achten, könnte dann auch die Verlaufs- und Erfolgsforschung der Psychoanalyse sowie den Umgang
der Analytiker miteinander beflügeln oder wenigstens verstehen lernen.
Auch
hier spielt nämlich Leiblichkeit
die größte Rolle. Wir müssen dazu nur immer wieder klarmachen, dass Unfreundlichkeiten (wie natürlich auch die Freundlichkeiten) nicht
ohne aktive leibliche Vorgänge
auskommen:
Insbesondere Abwehr durch Vermeidung fällt
„ins Auge“, so anstrengende Vermeidung des Blickkontakts, zugunsten
eines Blicks, der geradeaus und versonnen in die Höhe und in die Ferne
einer Weisheit (meist offenbar einer angeblichen „Grundphantasie ( Klüwer?),
die das ganze Leben durchziehen soll, nicht direkt in den Himmel, sondern maßvoll
über die Köpfe der Anwesenden geht und Anwesende in die Position eines
Kindes nötigen möchte, das vergeblich den versöhnlichen Blick seiner
Mutter zu erhaschen sucht (einziges Gegenmittel: Nicht hinsehen, also
ebenfalls eine leibliche Anstrengung vollbringen. „Leib gegen Leib“),
betontes Wegsehen durch Betätigung der Nn.abducentes, aber auch reger
Blickaustausch und Sichzuzwinkern im „Klübchen“ zu zweit oder zu dritt
(Nervus facialis, Gesichtsmuskulatur, besonders der Lidsenker und Lidheber),
gestische Kumpaneien und Kopfschütteln (M. sternocleidomastoideus
beiderseits), um Andere auszugrenzen, Sichumdrehen beim Anblick eines
Kollegen und Fortlaufen in die entgegengesetzte Richtung (gezielte
Innervation der Rumpf- und Beinmuskulatur unter besonderer Inanspruchnahme
der Raumorientierung, Nichterwähnen von Voten (Betätigung der Mundschließmuskulatur),
unfreundlicher („versteinerter“) Gesichtsausdruck ohne Anlass (was ohne
heftige Innervierung des Nervus facialis nicht geht), Vermeidung der Begrüßung
(eine große körperliche Anstrengung, so Betätigung der Kopfsenker), der
Verabschiedungsworte (Mund fest zukneifen), Sich- Umdrehen bei Ansprache
(ein großer körperlicher Aufwand zerebral, zerebellär und in der Bein –
und Rumpfmuskulatur unter Inanspruchnahme der langen cerebro- und
zerebellar-spinalen motorischen und sensiblen Bahnen und des tractus
spino-thalamicus), festgefügte Sitzordnung (schwierige zerebrale
Raumorientierung, bei Rechtshändern vorwiegend rechtshirnig), Flüstern zu
Nachbarn (Weitstellung der Stimmritze, damit Andere nicht mithören können),
unabgesprochene, willkürliche Änderungen des Procedere je nachdem, wer
vorträgt (zerebraler, mühsamer Vorsatz mit Betätigung der gesamten
Sprechmuskulatur).
Nützlich
ist es allemal, sich klarzumachen, dass es sich auch bei Unfreundlichkeiten
unter Kollegen um aktive leibliche Anstrengungen handelt.
Ein
Schelm, wer denkt,
Analytiker seien fleißig und keine leibliche Anstrengung sei ihnen
zuviel, wenn es um den Umgang mit ihren Kollegen geht. Wozu in die Ferne
schweifen?
Aber
auch Positives ist dem abzugewinnen: Immerhin ist so die Bodenhaftung
gesichert, erweisen sich so doch Analytiker als echte Menschen. War das unbedingt vorauszusehen?
Entscheidend
aber ist folgende Überlegung: Soll jede, also auch diese Art von
Leiblichkeit unter Kollegen ebenfalls unter die frühe Mutterbeziehung
fallen? Soll
auch zwischen uns Kollegen dem Erwachsensein die Eigenständigkeit
abgesprochen werden? Damit
wäre der Kreis geschlossen. Alles wäre in „bester Ordnung“. Wir hätten
uns selbst auf wundervolle Weise exculpiert, müssten
uns allerdings fragen, wozu wir uns im zwischenmenschlichen Bereich
eigentlich der Mühe, erwachsen zu werden, unterzogen haben.
Oder
soll gelten: „Alles zu seiner Zeit“? Kindheit darf Kindheit bleiben,
Erwachsenheit Erwachsenheit?
Eines
muss klar sein: Jede Vorstellung von völliger Fixiertheit an die Mutter-
Kindbeziehung muss das Prinzip der Folge- Entwicklungen zum
Erwachsenenstatus verletzen, und umgekehrt müssen wir uns von der
Vorstellung einer Allgegenwart und anhaltenden, unabhängigen Bedeutung der
Mutter-Kindbeziehung trennen, wenn wir an eine Entwicklung im
zwischenmenschlichen Bereich glauben möchten.
Oder
sollte eine Todesanzeige mit einem Abbild des Verstorbenen sein frühkindliches
Portrait im Arme seiner Mutter zeigen? Dies wäre dann zumindest eine Überlegung
wert.
Auch
ist daran zu denken, dass die einseitige Betonung der Frühkindlichkeit ein
Ableger des verbreiteten Jugendwahnes sein kann.
Jedenfalls
in der Psychoanalyse (aber nicht nur hier) ist Erwachsensein oder gar
Altsein nicht gerade beliebt („Tantenbataillone“, „reife Jugend“,
„christmas cake“, „Einzelreisender“, „Wachstumschance“,
„Ausdauertyp“, „Hoffnungsträger“, „Demographieplus“,
„Kompetenzträger“, „Silberschatz“, „Humanreserve“,
„erfahrenes Humankapital“, „wir wünschen Ihnen Alles Gute für Ihren
weiteren Lebensweg“).
Hat
Freuds Anhänglichkeit an die Frühkindlichkeit seine (und unsere)
Trauer über die verlorene Kindheit und deren Romantisierung künstlich
verlängert? Geht es darum, dem
Altern ein Schnippchen zu schlagen? Unter dem Deckmantel einer
Psychotherapie-Gesellschaft?
Auch
aus Religionen kommt einem das
Unterfangen irgendwie bekannt vor: „Wiederauferstehung“? „Alpha kai
Ōmega“? „Neubeginn“? Dies sind Erklärungen der
suggestiven Kraft des Begriffs der „Frühkindlichkeit“.
Gesichtspunkte,
die nicht zur Sprache gekommen sind, sind die, dass wir alle an unserem Persönlich- Körperlichen festhalten möchten.
Wir möchten es uns auch unter keinen Umständen „weganalysieren“
lassen.
Ein
weiterer ebenfalls nicht: Brauchen unsere Patienten tatsächlich die
optimale Therapie? Sind unsere therapeutischen Ziele überambitioniert
und wir dadurch womöglich überanstrengt?
Können wir
es uns angesichts der Komplexität der Sache leisten, durch Hineinnahme auch
noch des Konzepts der Leiblichkeit uns an
den Rand der Verwirrung treiben zu lassen oder freiwillig dorthin zu
gelangen? Auf volltönende Ankündigungen hat der Autor verzichtet. Er hat
auch wohlweislich nicht aus dem Konzept der Leiblichkeit eine über 300
Sitzungen hinausgehende Analyse gefordert, wohl in der Erkenntnis, dass Die
Dauer zu beschränken ist, wenn Psychoanalyse erhalten werden soll.
Auch
neuere Konzepte können nicht untermauern, dass leibliche Äußerungen von
Erwachsenen / Jugendlichen auf Regression zur infantilen Mutter-
Kindbeziehungen oder gar mehr oder weniger mit diesen identisch sein sollen,
wie behauptet.
Namentlich
seien hier nur erwähnt, damit niemand auf den Gedanken kommt, sie seien übersehen
worden:
Die
intersubjektive Wende der Psychoanalyse mit dem Konzept des Anderen,
der Präsenz der Interaktion” (Buchholz 2005, S. 633f.). die
Beziehung zwischen Psychoanalytiker und Analysand als eine Beziehung
zwischen zwei Subjekten,
Rollenübernahme durch den Analytiker, „szenische Inszenierung“ (ein
Hendiadioin, Tautologie - oder soll es auch eine unszenische Inszenierung
geben? Anm. d. Verf.), Enactment, affect
attunement (Stern 1985), der adäquaten Spiegelung (es wird aber
nicht gespiegelt, - dies wäre das Ende jeder Beziehung, ein Beispiel für
die Gedankenlosigkeit, mit der Metaphern übernommen und verbreitet werden
-, sondern eine emotionale Antwort gegeben, Anm. d. Verf., s. Krill 2006,
2010, 2013) auf die Gefühle des Säuglings durch die Mutter (Fonagy et al.
2002), Theorie des virtuellen Anderen von
Braten (1992, 1998), die Konzeption
des virtuellen Anderen als ein angeborenes Design, das die Mutter als
den tatsächlichen Anderen im wechselseitigen Dialog erwartet
hatte... „der äußere,
tatsächliche Andere tritt gewissermaßen nur in die Fußstapfen, die in
Gestalt des inneren virtuellen Anderen vorbereitet sind” (Dornes, S. 306)
(zit. n. Rhode- Dachser 1993).
All
diese Gesichtspunkte können nicht eine fortdauernde Alleinherrschaft der frühen
Mutter- Kindbeziehung begründen.
Zwar
mag gelten: „Denn die abwehrende Reaktion des Säuglings auf die Erfahrung
des unbewegten Gesichts der Mutter muss etwas mit der Enttäuschung einer
vorangehenden Erwartung zu tun haben. Nahe an Bratens Theorie liegt auch die
Idee Bions von der angeborenen Präkonzeption der Brust, wenn man
“Brust” als Metapher für eine Objektbeziehung versteht (Dornes, S.
312). Der gemeinsame Grundgedanke ist, dass der Säugling über angeborene
Erwartungen verfügt, deren Realisierung oder Nicht-Realisierung – in
Bratens Terminologie “Erfüllung” oder “Nicht-Erfüllung” – seine
weitere Entwicklung maßgeblich beeinflussen (nach Dornes, S. 313.) (zit.n.
Rhode-Dachser, wie auch die vorangegangenen Zitate).
Ferner:
Die
Erwartung richtet sich dabei nicht nur darauf, dass die Mutter bestimmte
Handlungen ausführt. Die Handlung wird vom Säugling innerlich mitvollzogen.
Was dabei erlebt wird, ist am ehesten ein Gefühl der Bewegung (nach
Dornes, S. 315). Forscher haben herausgefunden, dass die Beobachtung einer
Handlung, die ein anderer vollzieht, im Beobachter (spiegelbildlich)
dieselben Neuronen aktiviert, die auch aktiviert werden, wenn er selbst
diese Handlung ausführen würde.[1]
Dem entspricht das Gefühl einer aktiven Teilhabe.
Wenn
die Mutter ihren Säugling füttert, dann löst die Wahrnehmung dieser
Aktivität im Säugling eine Resonanz aus, in der er spürt, wie sich die
Mutter bei der Ausführung der Bewegung fühlt. Auf gleiche Weise wird auch
die Erfahrung von Zurückweisung oder Misshandlung vom Säugling in
unmittelbarer Teilhabe erlebt (Dornes, S. 319). Wer misshandelt wird,
weiß dann aufgrund dieser unausweichlichen Teilhabe auch, wie man sich fühlt,
wenn man misshandelt“.
Dies
geht auch aus Schilderungen von Opfern hervor. Opfer und Täter fühlen sich
innerlich sehr verwandt. (Anm. d. Verf.).
„Das
disponiert dazu, die Misshandlung zu wiederholen (nach Dornes, S. 320).!
Dies
heißt aber nicht,
dass ein Erwachsener zu dieser alten Art von Mutterbeziehung zurückkehrt,
wenn er sich später in seinen Misshandler einfühlt. Er hat dazu die
Ausstattung erworben. (Verf.). Wenn ein Erwachsener spazieren geht,
heißt das ebenfalls nicht, dass er in einen Zustand zurückkehrt, in
dem er an der Hand seiner Mutter ging (Verf.).
„In
der Begegnung mit dem realen Anderen bildet sich auf diese Weise auch jenes
“implizite Beziehungswissen” heraus (The Boston Chance Study
Group 2002, S. 936), das als „Wissen über das Zusammensein mit einem
Anderen” (ebd.) später unbewusst unsere Interaktionen prägt.
Aber
dieses Wissen ist im Erwachsenenleben nicht
mehr auf das Wissen des Kindes beschränkt, Anm. d. Verf.)
„Eine
psychoanalytische Interpretation, die auf eine dauerhafte Veränderung
dieses Wissens (nein, nicht dieses
Wissens, sondern des Erwachsenenwissens, Anm. d. Verf.) abzielt, muss
deshalb den impliziten Bereich des menschlichen Gedächtnisses (ja, aber des Gedächtnisses aus der Jetztzeit des Erwachsenen, Anm. d.
Verf.) erreichen, der grundsätzlich unbewusst ist. Deutungen spielen
sich in der Regel auf einer bewussten oder vorbewussten Ebene ab. Es muss
also in der Interaktion zwischen Analytiker und Analysand noch etwas anderes
geben, das diese Änderung bewirkt. Für Stern und seine Mitarbeiter ist es
das “Etwas-Mehr-als-Deutung”, das zu einer Veränderung des impliziten
Beziehungswissens (das aber nicht
identisch ist mit dem Beziehungswissen des Kindes, sich keinesfalls auf
dieses beschränkt, Anm. d. Verf.) führt. Das Kind hat dieses implizite
Beziehungswissen, aber der Erwachsene
hat es erst recht.
Die
Deutung geht dabei mit
mikroprozessualen Veränderungen auf der impliziten Ebene einher,
vergleichbar (vergleichbar ja, denn
alles kann man miteinander vergleichen, aber es ist deshalb keinesfalls
gleich, Anm. d. Verf.) dem affect attunement zwischen Mutter und
Kind (nein , auch mit Anderen, Späteren, Anm. d. Verf.), in dem es um
die Herstellung eines Gefühls von Stimmigkeit geht (Stern et al.
1998, S. 981), wie dies Braten auch für das Treffen eines innerlich bereits
repräsentierten Andern voraussetzt (zit. nach Altmeyer 2005, S. 660). Stern
beschreibt diesen Prozess auf der lokalen Ebene als eine Aneinanderreihung
von Momenten, die er Gegenwartsmomente nennt, weil sie sich von
Sekunde zu Sekunde im Hier und Jetzt der therapeutischen Beziehung
abspielen. Dabei kann es auch zu Momenten kommen, in der die gemeinsame
implizite Beziehung gefährdet erscheint (Stern 1998, S. 991). Patient und
Analytiker merken dies unter anderem daran, dass ihnen diese Momente
unvertraut, beunruhigend, unheimlich erscheinen (ebd.).
Sie
sind mit einer unbekannten Zukunft angefüllt (hier endlich der Gedanke an Progression, an Antizipation, fort von der
traditionellen Rückschau in der Psychoanalyse, Anm. d. Verf.), die man
als Sackgasse, aber auch als Chance empfinden kann (ebd.).
Die
Gegenwart verdichtet sich subjektiv, ähnlich dem ‚Augenblick der
Wahrheit’” (ebd.). Um daraus einen Moment der Begegnung zu
machen, muss der Therapeut aus seiner analytischen Neutralität heraustreten
und etwas einbringen, das über den gewohnten therapeutischen Rahmen hinaus
geht (das über den bisherigen
Rahmen, nicht nur über den in der Kindheit erfahrenen Rahmen, hinausgeht,
Anm. d. Verf.) und seinen ganz persönlichen Stempel trägt. Mir fiel, während
ich dies schrieb, eine Fallschilderung von Beland ein. Beland berichtet
dort, wie er nach einer langen Phase scheinbar unauflösbarer negativer Übertragung
von der Patientin hasserfüllt angeschrieen wurde, er sei ein eiskalter
Stein, und er in diesem Moment seine psychoanalytische Neutralität über
Bord warf und spontan zurück schrie: “Ich
bin kein Stein!” (nach Buchholz, S. 640 f.). Mit dieser Reaktion hatte er
seine Position als Übertragungsobjekt verlassen und war als ein Anderer in
Erscheinung getreten. Für Stern et al. (1998) sind solche Momente der
Begegnung “das Schlüsselereignis in diesem Prozess, der Drehpunkt, an
dem sich der intersubjektive Kontext (aber
der Therapeut war nicht der Erste darin, und der intersubjektive Kontext hat
sich seit der Mutter-Kindbeziehung laufend fortentwickelt, Anm. d. Verf.)
verändert und dadurch auch das implizite Beziehungswissen über die
Patient-Therapeut-Beziehung” (S. 993), (zit. n. Rhode-Dachser 1993).
„Schlussbetrachtungen
“Das
Unbewusste ist Präsenz der Interaktion”, so definierte Buchholz (2005)
das Unbewusste in der relationalen Psychoanalyse. In dem therapeutischen
Ansatz der Boston Study Group um Daniel Stern bedeutet “Präsenz” die
Konzentration auf das Fortschreiten des therapeutischen Prozesses von Moment
zu Moment, bis es zu einem now moment kommt, der subjektiv und
affektiv als “einschlagend” erlebt wird und die Beteiligten verstärkt
in die Gegenwart hineinzieht (Stern et al. 1998, S. 989). Eine stärkere
Betonung der Bedeutung der Gegenwart im therapeutischen Prozess kann es kaum
geben. Der “now moment” ist dabei gleichzeitig ein “Augenblick der
Wahrheit” (ebd., S. 990). Ganz ähnlich sprach Bion von der “emotionalen
Wahrheit einer Sitzung”, die für ihn eine Realisierung von O bedeutete
(nach Eigen 1981, S. 422).
Wenn
wir an dieser Stelle erneut unter Bezugnahme auf Freud nach den
Manifestationen jenes “unassimilierbaren Restes” fragen, dem “ganz
Anderen”, dem “Ding an sich”, das sich dem menschlichen
Wahrnehmungsvermögen entzieht, aber in den Konzepten des Unbewussten Spuren
hinterlassen hat, dann finden wir diese Spur sowohl bei der Bostoner
Studiengruppe um Stern als auch bei Bion in der Begegnung von Analytiker und
Analysand in einer Situation absoluter Gegenwart, die nicht durch Erinnerung
(sic! Auch nicht an die
Mutter-Kind-Situation, s. auch Bollas s.u., Anm.d. Verf.) und Wunsch
getrübt ist und als unmittelbar stimmig, passend, “wahr” erlebt wird.
Nur Melanie Klein und in ihrer Nachfolge Betty Joseph haben meines Wissens
in ähnlicher Weise die Übertragung als “Gesamtsituation” betont
(Joseph 1985).
Es
gibt aber noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen beiden Theorien, die sie
auch mit den Konzepten des Unbewussten bei Freud und Melanie Klein
verbindet. Ich habe sie bereits erwähnt. Sie betrifft die von Bollas (1987)
beschriebene frühe Erfahrung der Mutter als eines Objekts der
Verwandlung. Das Erleben entstammt einer Zeit, in der der Säugling die
Mutter noch nicht als Andere erkennt, sondern sie als Prozess erfährt, der
das Selbst verwandelt. Gerade hat der Säugling noch verzweifelt geschrieen;
das Erscheinen der Mutter führt dazu, dass Selbst und Umwelt sich
verwandeln. Er wird an der Brust der Mutter ruhig und saugt zufrieden. Weil
diese Erfahrung aber dem existenziellen Wissen angehört, das nicht bewusst
repräsentiert ist, kann es nicht erinnert werden. Das Erfahren des
Objekts geht dem Wissen um das Objekt voraus (Bollas 1987, S. 51).
Bollas bezeichnet es deshalb auch als das “ungedachte Bekannte” (S. 16).
Später begegnet uns diese Erfahrung wieder in dem Streben nach einem
Objekt, von dem wir hoffen, dass es das Selbst verwandelt (S. 26). Wenn die
Suche von Erfolg gekrönt ist, spüren wir für Momente eine Beziehung zu
diesem Objekt […], die einer Verschmelzung gleichkommt, in der wir uns des
Verwandlungssubjekts entsinnen. Sie versetzen uns in eine ehrfurchtsvolle
Haltung; oft werden diese Objekte sogar für heilig erklärt (ebd., S. 29).
Übertragen
wir diese Erfahrung auf die in dieser Arbeit untersuchten psychoanalytischen
Theorien über das Unbewusste, dann wäre in der Theorie des virtuellen
Anderen die Mutter als Verwandlungsobjekt der erste (dies mag sein, heißt aber nicht, dass in der Folge nicht andere
Objekte mit ähnlichen Erfahrungen folgen, die das Leben des Erwachsenen und
seine Welt verwandeln) reale Andere, der in das Leben des Kindes tritt
und seine Welt verwandelt, im Idealfall so, wie es seinen präformierten
Erwartungen (diese entstammen aber
auch späteren Zeiten, Anm. d. Verf.) entspricht.
Braten
spricht vermutlich nicht umsonst von Erwartung und Erfüllung, wenn
er die Begegnung des inneren virtuellen Anderen mit dem realen Anderen
beschreibt (nach Dornes 2002, S. 313). Bei Bion bewirkt in ähnlicher Weise
das Zusammentreffen der von ihm als Präkonzeption bezeichneten Erwartung
einer Brust mit einer realen Brust die Verwandlung des vorher hungrigen Säuglings
in einen zufriedenen satten. In den Momenten der Begegnung in der
therapeutischen Beziehung, wie sie von Stern et al. beschrieben werden, ist
es der plötzlich als Anderer sichtbar werdende Analytiker, der eine
solche Verwandlung bewirkt. Erwartung und Erfüllung sind also auch hier eng
miteinander verbunden (aber ein Rückgriff
auf die erste Erfahrung mit der Mutterbrust ist damit keineswegs dargelegt
oder wahrscheinlich gemacht. Auch hier steht lediglich das
Regressionskonzept Pate, Anm. d. Verf..).
Melanie
Klein spricht von der Unverzichtbarkeit einer guten Brust als
lebensspendendem Objekt, das in der Lage ist, den Auswirkungen des
Todestriebs in Form von Hunger, Neid und Aggression entgegenzutreten und vor
ihnen Zuflucht zu gewähren. Auch diese “gute Brust” ist danach ein
Objekt der Verwandlung.)
Damit
komme ich zurück zu Freud, nach dessen Vorstellung der Mensch ein Leben
lang vergeblich nach der Wiederholung einer ersten Befriedigungserfahrung
sucht, die mit Sicherheit auch als Erfahrung einer Verwandlung beschrieben
werden könnte. Jedes spätere Objekt, das eine Wiederholung dieser
Verwandlung verspricht, wird von daher idealisiert, man könnte auch sagen:
in den Himmel gehoben (Freud 1914c, S. 161). Und auch wenn Freud die
Religion in den Bereich der Illusion verweist (1927c) und das Verliebtsein
als maßlose Überschätzung des Liebesobjekts entwertet (1914c, S. 161):
Die Sehnsucht nach einer Transformation des Selbst durch ein Objekt der
Verwandlung lässt sich auf diesem Wege nicht zum Verschwinden bringen. Sie
ist so unzerstörbar wie die Schatten der odysseeischen Unterwelt, die
jederzeit bereit sind, zu neuem Leben zu erwachen. Das jedenfalls ist der
Vergleich, den Freud für die Unzerstörbarkeit der infantilen Triebwünsche
wählte (1900a, S. 58, Anmerkung). In der hier vorgeschlagenen Lesart
beziehen sich diese Triebwünsche auf ein Objekt, das wie
in der ursprünglichen Begegnung mit einer noch als Prozess erlebten Mutter
eine Transformation des Selbst verspricht („wie“
in... mag richtig sein, dies heißt aber nicht, dass es eines Rückgriffs
auf diese bedarf, - es handelt sich nur um einen losen Vergleich, Anm, d.
Verf.). Diese Objekte (auch spätere
!, Anm. d. Verf.) sind ehrfurchtgebietend, heilig. Damit werden sie
gleichzeitig zu einer Transformation von O.
Jeder
Text, und das heißt, auch jeder theoretische Text, hat einen unbewussten
Subtext. Wenn wir mit diesem Wissen einen letzten Blick auf die vier
Konzepte des Unbewussten werfen, die wir hier einer Untersuchung unterzogen
haben: Wäre es zu gewagt, zu behaupten, dass jede dieser Theorien als
Subtext einen Mythos enthält, in dem die stärksten menschlichen Sehnsüchte
und die tiefsten menschlichen Ängste ihren Niederschlag finden: In Freuds
Theorie die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, in Melanie Kleins
Theorie die Angst vor der Macht der Hölle im eigenen Innern, in Bions
Theorie der Hinweis auf ein göttliches O, das unter anderem als Wahrheit in
der psychoanalytischen Situation erfahrbar werden kann, und im Unbewussten
der relationalen Psychoanalyse die Vorstellung der Präsenz des Anderen in
einer zeitlosen Gegenwart, in der es weder Trennung noch Tod gibt? Auf diese
Frage gibt es keine abschließende Antwort. Ich wollte sie zum Schluss aber
wenigstens stellen.“ (Zitate: Rohde-Dachser, C. (1993).
Geschlechtsmetaphern im Diskurs der Psychoanalyse. In M. B. Buchholz (Hg.)..
Metaphernanalyse. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 208-228.
Man
hat vor lauter Eifer und Begeisterung über die Entdeckungen bzw.
Vermutungen über die frühe Kindheit
übersehen, dass die Entwicklung weitergeht und unsere Patienten nicht für
alle Ewigkeit frühesten Mustern folgen müssen, ja, gar nicht folgen können,
- schon weil sich die Aufgaben geändert haben.
Der
Regressionsgedanke hat dazu geführt, dass Vorgänge in der Gegenwart, so in
der Analyse, gleichgesetzt werden mit dem frühesten Mutter- Kind-Erlebnis.
Analogien
sind immer da beliebt, wo Argumente fehlen. Sie zeigen
Argumentationslosigkeit an.
Erbarmungslose
Ideologische Härte
ist auch daran zu ersehen, dass auch ältere und alte Analysanden genötigt
werden sollen, in die früheste Kindheit zu regredieren, und man ihnen
hierin nicht einmal einen Runzelrabatt gewähren möchte. Dies ist nicht nur unmöglich, sondern wäre auch nutzlos.
Soll
Psychoanalyse eine nie revidierte Kindheitsideologie bleiben? Oder kann man
den Blick mehr auf Progression lenken, und dies nicht immer nur unter
Hinweis, dass zuerst die Kindheit aufgearbeitet werden müsse ? Es wird aber
schwer werden, der etablierten Ideologie, die überall bis in die kleinsten
Seminare mit großer Eloquenz verteidigt wird, in die Parade zu fahren.
Die
Neigung, leibliche Äußerungen auf die Mutter- Kindbeziehung zurückzuführen,
zieht auch eine einseitige mütterliche
oder „mütterliche“ Haltung nach sich (Übertragung
des Analytikers auf den Patienten aus Voreingenommenheit, weniger eine
Gegenübertragung auf den Patienten, da dieser von sich aus nicht das
Bestreben nach Regression und Befassen mit der Kindheit, erst recht nicht
der frühesten Kindheit, haben kann.
Auch
die von Analytikern verwendete
Sprache gegenüber dem Patienten und in den Seminaren mit Kollegen, auch
mit Ausbildungskandidaten, kann davon nicht unberührt bleiben: Übervorsichtig abwägend (man will eine gute Mutter sein und
keinesfalls etwas falsch machen, sondern zumindest schön brav
„spiegeln“, weil dies angeblich die - immer
uneinfühlsame - Mutter versäumt hat, man muss lieb und ermunternd sein,
und tiefes, tiefes Verständnis für die frühe Kindheit zeigen und schonend
vorgehen, weil der Patient doch in seiner frühen Kindheit unendlich
traumatisiert ist und unendliche Empathie benötigt, über die nur ein
unendlich gut ausgebildeter Analytiker verfügen kann, vorsichtshalber fleißig
den Konjunktiv verwendend („Könnte es sein...?“) und allgemein alles
Aggressive ausklammernd, in Kollusion mit dem Patienten.
Dazu eignet sich anscheinend auch eine betont unaggressive behutsame,
aber ausdauernd vor sich hinklappernde Sprache („Analyseklappern“,
Analyserattern“, „Das analytische Mühlenklappern“, Verf. hier)
(„achtsam, furchtsam, klagsam, duldsam, Spiegel, Gefühle.. und immer
wieder tiefe, tiefe Trauer und „nachhaltige Trauerarbeit“).
„Achtsamkeit“
hat eine bedeutende Literatur erzeugt, viele Therapeuten schwören auf die
Wirksamkeit der Achtsamkeitstherapie. Dies ändert aber nichts daran, dass
deren Verbreitung von der Ausklammerung des Aggressiven im Wort
„Achtsamkeit“ profitiert, auch wenn inhaltlich dies nicht so ist. Dies
ist aber kein Thema im Buch, und deshalb können diese Ausführungen auch
nicht für oder gegen das Buch gerichtet sein.
Es
dürfte aber kaum ein Zufall sein, dass kein Wort über Zähneknirschen (Bruxismus)
fällt, obwohl es sich um ein außerordentlich häufiges Symptom handelt,
das ganz offensichtlich eine leibliche Dimension zur Abwehr gegen Aggression
hat, aber auch diese Aggression selbst ausdrückt (unvollkommene Abwehr,
Durchbrechen des aggressiven Impulses, nur schwach abgewehrt durch Wendung
gegen die eigene Person, sprich gegen die eigenen Zähne..
Bruxismus
hat das Pech,
dass es analytischer Klimmzüge („früher oraler Sadismus“) bedarf, hier
einen Zusammenhang mit der frühkindlichen Mutterbeziehung zu konstruieren,
(Lied Brecht-Weigel: „Und der Säugling.. der hat Zähne“, - hat er?)
und deshalb im Buch nicht behandelt
wird (wenn der Rezensent es nicht überlesen hat, was bei diesem umfänglichen
Werk durchaus geschehen kann, - aber jedenfalls ist dieses wichtige Thema
nicht erkennbar hervorgehoben), und das Glück, somit einer Behandlung zu
entkommen.
Auch
ist die Verschiedenheit des Körpergefühls,
wie es jeder bei sich beobachten kann, nicht erkannt und daher auch nicht
berücksichtigt, auch nicht verstanden worden. Das
„Schweregefühl“ dürfte ganz anders als in der Kindheit empfunden
werden, weil tatsächlich die Körpermasse, insbesondere auch die bei jeder
Bewegung gefühlte Muskelmasse, mit dem Erwachsenwerden zunimmt, ebenso wie
die eigene Erfahrung mit dem Körper. Der kindliche
Körper fühlt sich „kinderleicht“ (sic!), eher wie Luft, an, jedenfalls
fast gewichtslos.
Für
Analytiker, die sich in Langzeitanalysen auskennen, ein Gewinn. Sehr zu
empfehlen, wenn auch die Verknüpfung
der Leiblichkeit mit dem Begriff der „Regression“ ein folgenreicher
Missgriff ist, welcher das Thema unnötig einengt und so künftige
analytische Arbeit mit dem Phänomen der Leiblichkeit erschwert.
Zu
wenig beachtet ist in der heutigen Psychoanalyse, dass es nicht nur darauf
ankommt, welcher Gesichtspunkt „richtig“ oder in der Therapie / in der
analytischen Theorie weiterführend ist, sondern, wozu er benutzt
(missbraucht) wird. Zu oft soll auch mit an sich richtigen Gesichtspunkten
nur von der analytischen Aufgabe, der Bearbeitung innerer Konflikte,
abgelenkt werden.
Hier
noch einmal die wichtigsten Stichwörter:
Leiblicher
Austausch, auch unter Analytikern in der Gruppe, „Zwischenleiblichkeit“,
„Leiblichkeit“ auch im Umgang der Analytiker miteinander in Seminaren,
Regression vs. Erwachsenenstatus und Progression, Antizipation,
Kindheitsthese, Infantilimorphismus (genetic fallacy) mit der üblichen
Detailverliebtheit, Abwehranalyse, Intellektualisierungen, Schneiderwitz,
scholastische Denkweise, Isolierungen, suggestive Manipulation, verdeckte
Fehlschlüsse, der „Dritte“, Durchbezahlen, Auftrag, „Psychose“,
Ignoranz, Desinteresse, Neglect, Couch, Imitation, Compliance, Soziologie,
Philosophie, „Räume“, Performance, Fairbairn, Melanie Klein, Bion,
Werner, Shapiro, Gray, Kernberg, Fonagy, Krill, Bollas, Rhode-Dachser,
Stern, Altmeyer, Dornes, Braten, The Boston Change Study Group,
Fallbeispiele, Phobie der Analytiker vor der Erwachsenen-Sexualität und -
Aggressivität, verkappter Antifeminismus, Dramatisierung, topographisches
Modell vs. Strukturmodell, Überforderung durch zu große Komplexität, unanalysierter
„Beifang“, Achtsamkeit, Behutsamkeit, Bruxismus, Gefühl der Schwere
des Erwachsenenkörpers vs. dem „kinderleichten“ (sic!) Körpergefühl.
Hohes
Niveau. Nicht nur eine Leseerfahrung. Auch literarisch hochstehend, liest
sich streckenweise wie eine gute Novelle. Gründlich geschüttelt, dann
neugierig beschnüffelt und sanft gerüffelt. Einmal ganz performativ
gesagt: Das Buch schlägt zu Buche, und es schlägt solange und so kraftvoll
auf die Leiblichkeit ein, bis diese antwortet und wimmernd ihr Geheimnis
preisgibt. Zoff und Tacheles gibt es auch, sie können nur dem erspart
bleiben, der das Buch nicht liest. Dazu soll aber nicht geraten sein.
Literatur
im besprochenen Buch
Hintergrundliteratur:
Bardè B
(2015): www.dr-benjamin-barde.de,
unter: „Behandlungsangebote und Behandlungsmethode“).
Berman E. (2004): Impossible training: A relational view of
psychoanalytic education. Hillsdale NJ (Analytic Press).
Gomez et al s. unter Bardè
Jimenez Juan Pablo (2005): The search for integration or how to work as a
pluralist psychoanalyst. Psa Inq, 25, 5, 602–634.
Kai von
Klitzing (2016) Leipzig, in DPV-Informationen Nr 60, 24-25, Januar 2016)
Krill M
(2001): Kompromisstheoretische Deutung der Posttraumatischen Belastungsstörung.
In: DPV-Informationen, Nr. 31, S. 21–23.
Krill
M.(2003a): Borderline- Störungen – Sammelbecken für unklare Fälle? In:
Neurotransmitter , 61–64.
Krill M
(2003b): Erfahrungen mit dem Gutachterverfahren. Neurotransmitter 11,
33–37.
Krill M
(2005): Erotische Übertragung – Cybersex mit dem Therapeuten. In:
Neurotransmitter, 2005, 11, 46–48.
Krill M
(2008): Das Gutachterverfahren für tiefenpsychologisch fundierte und
analytische Psychotherapie, ein Handbuch, 376 Seiten, Psychosozialverlag Gießen
ISBN 978-3-89806-773-7
Krill M (
2010):Zur Buchvorstellung „Briefwechsel Sigmund Freund- Nikolai
Jewgrafowitsch Ossipow 1921-1929“ im FPI Frankfurt , in DPV- Informationen
Nr. 49, S. 96-98
Krill M
(2011): Das Ende des Ödipus, Sophokles: „Ödipus in Kolonos“ (Oidipous
epi Kolonō),- psychoanalytisch neu gelesen, Verlag Peter Lang,
Internationaler Verlag der Wissenschaften, Bern, Berlin, Frankfurt, Oxford,
Wien, Brüssel, New York
Krill M
(2011): Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TfP) und analytische
Identität, in DPV-Informationen, Berlin, Nr. 51, 47 ff.
Krill M
(2012) Drehbuch zum Drama Sophokles` „Ödipus in Kolonos“, ISBN
978-3-9815177-0-5, Dr. Manfred
Krill Verlag für Psychoanalyse (ISBN des Verlages 978-3-981 5177)
Krill
M (2012) Klassische Psychoanalytische Kompromisstheorie: Symptombildung
als Kompromiss
ISBN 978-3-981 5177-1-2 , Dr. Manfred Krill Verlag für
Psychoanalyse (ISBN
des Verlages 978-3-981 5177)
Krill M
(2013) Anorexia nervosa und Aggression,
ISBN 978-3-981 5177-3-6, Dr. Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse
(ISBN des Verlages 978-3-981 5177)
Krill M (2013) Psychoanalytic Compromise Theory and Effects and
Non-Effects on Psychoanalysts, Patients and Society, Verlag Dr.Manfred Krill
Verlag für Psychoanalyse 978-3-981 5177 8-1
Krill M (2013)
Психоаналитическая
теория
компромисса
и её
воздействия
и не-
воздействия
на
психоаналитиков,
пациентов и
общество.
Krill M
(2014) Kritische Psychoanalytische Mitteilungen, in Vorbereitung Dr. Manfred
Krill Verlag für Psychoanalyse (ISBN des Verlages 978-3-981 5177)
Krill M
(2014) Gruppenanalyse, neu entworfen nach der Abwehrtheorie, ISBN 978-3-981
5177-6-7
Verlag für Psychoanalyse (ISBN des Verlages 978-3-981 5177)
Krill
M (2014) Rezension über
„ Die leibliche Dimension in
der Psychoanalyse“ von
Dr. phil. Jörg Scharff, Brandes &
Apsel, 1Auflage, 2010, 205 Seiten:, 978-3-
Renik O. (1998): Getting real in analysis. Psa
Q, 67, 566–593.
Renik O.
(1999a): Mündliche Mitteilung am 19.1.1999 in Frankfurt a.M.
Renik O (1999b): Playing one’s card face up in analysis: An approach to
the problem of self-disclosure. Psa Q, LXVIII, 4, 521–540.
Renik O (2001): The patient’s experience of therapeutic benefit. Psa Q, LXX, 1, 231–242.
Renik O (2002): Defining the goals of a clinical psychoanalysis. Psa Q, LXXI, 1, 117–124.
Sampson H Weiss J. (a 1977): Research on the psychoanalytic process.
Bulletin 5
Sampson H Weiss J. Gassner S (b 1977): Research on the psychoanalytic
process. Bulletin 3.
Sampson H (1982): Psychotherapy Research, Bulletin 5.
Shapiro T (1981): On the quest for the origins of conflict. Psa Q, 50,
1–21.
Weiss J (1952): Crying at the happy ending Psa Rev, 39, 338.
Weiss J, Sampson H The Mount Zion Psychotherapy Research Group (1986):
The psychoanalytical process. Theory, clinical observation and empirical
research. New York (Guilford).
Weiss J (1995): Bernfeld’s »The facts of observation in psychoanalysis«:
A response from psychoanalytic research. Psa Q, LXIV, 699–716.
Weiss J (1998): Bondage fantasies and beating fantasies. Psa Q, LXVII, 4, 626–644.
Weiss J (2003): Development of a research program. In: Psa Inq, 23, 2, 350–366.
Yalom I D
(1995,2007, verschiedene Auflagen, hier 2007): Theorie und Praxis der
Gruppenpsychotherapie, Klett-Cotta Stuttgart
Dr.
Manfred Krill, Psychoanalytiker, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie,
Psychotherapie, Psychoanalyse (DPV, IPV, FPI, IPAA), Gruppenanalytiker
(GRAS), Balintgruppenleiter (LÄK Frankfurt), Supervisor, Lektor.
Rezension des Buches von Wolfgang Mertens: „Psychoanalytische Behandlungstechnik", Kohlhammer, 2015, 1. Auflage
von Dr. Manfred Krill, Psychoanalyse (DPV, IPV, FPI, IPAA)
Verlag Dr. Manfred Krill für Psychoanalyse
ISBN des Verlages 978-3-9815177
61462 Königstein im Taunus
Impressum
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http:/ dnb.ddb.de> abrufbar.
Originalausgabe
Buch, ungebunden
(C) 2017 Dr. Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse, Hainerbergweg 53, D-61462 Königstein
Satz und Druck: Dr. Manfred Krill (Autor), Königstein
Schrift: Arial
Das Urheberrecht: liegt ausschließlich bei Dr. Manfred Krill. Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, übersetzt oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Autor und Verlag übernehmen keine Verantwortung und keine Haftung, die auf irgendeine Weise aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entstehen könnten. Geschützte Warennamen oder Warenzeichen werden nicht besonders gekennzeichnet. Hieraus kann nicht geschlossen werden, dass es sich um freie Warennamen handelt. Ähnlichkeiten mit Personen sind rein zufällig. Keine der Krankengeschichten hat reale Personen zum Inhalt. Bei der Bewertung von Zitaten von Autoren und sonstigen Personen sind nicht diese Autoren oder Personen persönlich gemeint, sondern nur deren vermutliche Meinungen, Thesen, Behauptungen und sonstige Aussagen.
Printed in Germany, 1. Auflage
ISBN 978-3-98 18213-4-5
Verlag ISBN 978-3-9815177
Preis 44,- Euro
Der Autor beweist hier wieder einmal seine profunde Kenntnis der verschiedenen psychotherapeutischen Verfahren und der Fachliteratur bis heute. Die Zusammenstellungen und Gegenüberstellungen sind meisterhaft, mir sind keine besseren bekannt, und die Sprache könnte präziser und verständlicher zugleich nicht sein. Wohltuend ist auch, dass der Autor auf übliche, hochgestochene, intellektualisierende Redeweisen, wie man sie in der psychoanalytischen Literatur ständig erdulden muss, verzichtet.
Indes liegt der Teufel bekanntlich im Detail, und hier erscheint das Buch nicht immer so, wie wohl vom Leser erhofft.
An theoretischen Beschreibungen, Zusammenstellungen und Gegenüberstellungen fehlt es ja heute nicht
, zu oft aber an Fallbeschreibungen.Das Buch weist selbst auf „die Angst des Analytikers vor der psychoanalytischen Methode" hin, widmet ihr sogar ein ganzes Kapitel („Die Angst des Psychoanalytikers vor der psychoanalytischen Methode", S. 50 ff).
Im Fallbeispiel 1. Teil, S 91 ff, geht es wohl um einen Fetischisten
. Der Patient fühlt sich –auch sexuell - zu Frauen hingezogen, denen ein Bein fehlt oder die ihm zumindest dies vorspielen können. Als mögliche Erklärung bietet der Patient an: Er zeige somit Respekt für behinderte Frauen, oder seine Vorliebe sei „genetisch vorbestimmt". Dies kann man z.B. als Rationalisierung (Wohltat, Respekt) oder Verschiebung („Genetik") deuten.Weniger zu sehen ist ein systematisches Absuchen nach Motiven wie Wünschen, darunter auch aggressive Regungen, etwa gegen Frauen bzw. die Mutter, Ängsten, darunter auch die, seine Wünsche nicht erfüllen zu können, sowie Vergeltungsängsten oder die Angst, die Frau könne ihm weglaufen, oder die Angst vor Überlegenheit der Frau, in welcher Form auch immer, Schuldgefühlen, so, in seinen Phantasien oder Handlungen aggressiv gewesen zu sein oder noch zu sein, Schuldgefühlen, solche Wünsche gehabt zu haben oder noch zu hegen, Schamgefühle, seine Ziele nicht erreicht zu haben und nicht erreichen zu können oder innerlich so aggressiv gewesen zu sein, und die Art der gewählten Abwehrformen, etwa Wendung gegen die eigene Person in Form der Selbstschädigung (so Selbstbestrafung) durch sozialen Rückzug, Einschränkung seiner Möglichkeiten einer Partnerschaft, so auch , eine gesunde Partnerin zu suchen und vorzuzeigen, evtl. auch Wendung vom Passiv ins Aktiv (Loevinger) und wechselseitigen Übertragungen und Gegenübertragungen vom Patienten und vom Analytiker sowie von der sozialen Umgebung des Patienten und des Patienten auf seine Umgebung sowie Nachweisen für ein Psychotrauma oder eine Mentalisierungsstörung. Einige dieser Gesichtspunkte werden zwar angeschnitten, aber nicht systematisch und nicht näher ausgeführt. Andere kommen gar nicht erst ins Blickfeld.
Können wir so zu einem profunden Verständnis des Einzelfalls kommen?
Und was bedeutsamer ist als ein noch so vertieftes Verstehen des Einzellfalls, wäre eine klare psychoanalytische Handlungsanweisung, so in Form von Deutungen, die dem Patienten gegeben werden könnten („Behandlungstechnik").
So ist zu sehen, dass gerade dieser versprochene Teil („Technik") nicht konkret genug dargestellt ist. Mit allgemeinen Ausführungen, und seien diese noch so gut durchdacht wie zweifellos hier, ist nicht gedient. Wie geht denn nun ein Analytiker in solchen Fällen im Dialog konkret vor? Dies hätte man gern, vor allem genauer, gewusst. Der Autor gibt hierzu ja selbst einen Fingerzeig, ist sich also den Problems bewusst („Die Angst des Analytikers vor der Psychoanalyse", S. 50), wenn auch erneut in allgemeiner Form. Dies ist allerdings ein allgemeines Phänomen in der psychoanalytischen Literatur, und das Buch bildet hier nur keine Ausnahme. Wenn es ans „Eingemachte" geht, d.h. an die – eigentlich mit Geduld unschwer zu entdeckenden - Einzelkomponenten des inneren Konflikts (diese auch nach Traumen), tritt zu oft Funkstille ein. Dabei handelt es sich hier um die eigentliche analytische Arbeit, denn allgemeinere, nicht spezifisch analytische Ausführungen können auch Andere erbringen. Dabei kann man die Analytiker nicht einmal als bequem bezeichnen, aber ganz verstehen kann man andererseits auch nicht, warum sie zu oft diese speziell analytische Arbeit einfach nicht leisten, wenigstens in der Literatur. Man möchte vielen Analytikern zurufen: „Liefern Sie, Sie können es doch"!
Der Autor führt aber gegen solche Forderungen nach Gewissheit, Vollständigkeit, Perfektion, wenn ich ihn recht verstehe, Bions Konzept der „negative capability" an (S. 98). Ungewissheit ermögliche erst die Entwicklung zu weiteren, besseren Konzepten. Dies ist sicher richtig, aber die Frage ist, ob dieser Gesichtspunkt uns von der Suche nach Vollständigkeit aufgrund des bereits vorhandenen Konzeptes, so der Abwehrtheorie, entheben kann. Ich meine, dass dies zu weit geht und einer nur oberflächlichen oder unnötig oberflächlichen Betrachtung Vorschub leistet und tatsächlich mehr zu leisten wäre, wenn man dies denn wollte. Konzepte, so man denn welche hat, müssen auch konsequent angewandt werden, und man darf nicht einfach stehenbleiben, wenn man gerade daran keine Lust mehr hat.
In seinen ergiebigen Ausführungen über die Unterscheidung von tiefenpsychologisch fundierter und analytischer Psychotherapie geht er auch auf die begrifflichen und therapeutischen Schwierigkeiten ein, die sich mit diesem Versuch einstellen. Es ist aber offensichtlich, dass diese Unterscheidungen letzten Endes künstlich sind.
Der Autor hält sich an die Psychotherapierrichtlinien der Leistungsträger, weil dies für praktische Zwecke notwendig ist, aber obwohl diese ja ziemlich willkürlich erstellt sind und somit nicht die Essenz des Themas sein können. Der Autor räumt auch insbesondere ein (S.104), dass die Unterscheidung von „neurotischen" und „strukturellen" Störungen „schwierig, nicht unumstritten" ist. Es ist die Frage, ob diese Unterscheidung nicht sogar unsinnig ist. Denn alles Psychische hinterlässt im Gehirn eine Spur und ist insofern „Struktur" wie bereits jeder Regen in einem auch harten Gebirge. Deren Dauer können wir gar nicht beurteilen und brauchen wir auch nicht zu beurteilen. Wir können nicht beurteilen, wie verfestigt diese Struktur ist und in wieweit sie sich therapeutisch beseitigen, ersetzen, in der Betonung mindern, überfahren oder überformen lassen wird oder in welchen Ausmaß sie sich von selbst auflösen wird (was offenbar oft der Fall ist, denn sonst hätten wir sehr viel mehr erwachsene Traumatisierte) oder „integriert" wird (ein äußerst vager, aber angenehmer Begriff) oder in welchem Ausmaß sie wie ein Stachel so bleiben wird wie sie ist. Wir können es nur versuchen.
Die therapeutische Seite kommt zu kurz, wie auch in der Psychoanalyse überhaupt die Diagnostik und die Indikationsstellung nebst klugen, gut begründeten Weichenstellungen, Metaphorik von „Oberfläche und Tiefe" und fleißigen Reflektionen über die verschiedenen Konzepte und gewiss scharfsinnigen, oft aber auch nur pauschalen, klischeehaften biographischen Herleitungen und damit altes Heilsversprechen, unverhältnismäßig aufgebläht erscheinen, - mit immer mehr Verfeinerungen, denen aber das therapeutische Korrelat fehlt.
Hier erhebt sich, unabhängig von diesem Buch die Frage, ob die Psychoanalyse nicht von Anfang an den Mund zu voll genommen hat. Viel versprochen und wenig gehalten. Dass die anfängliche Euphorie, der Analytiker brauche nur unbewusste Prozesse bewusst zu machen, die – vermeintlichen oder tatsächlichen - Übertragungen fleißig zu deuten und mit seinen Gegenübertragungen in sich zu gehen (Der Autor zitiert etwas willkürlich hierzu Gill, S, 130), und die Symptome dem Patienten „zu erklären", zu nichts geführt hat, und es sich namentlich bei der euphorischen Rezeption der Übertragungsdeutungskonzepte um eine Luftnummer handelte, ist ja inzwischen Allgemeingut. Was soll auch ein Patient davon haben, dass ihm erklärt wird und er auch nach langem Hin und Her auch z.T erlebt, wie sich kindliches oder früheres Verhalten, Gefühle und Beziehungen jetzt in seiner Analyse an seinem Analytiker wiederholen? Dann wiederholt es sie eben, und dann kann sich der Patient auf die Suche nach besseren Lösungen machen und findet sie vielleicht auch, und das war es dann aber auch. Wer glaubt denn heute noch daran, dass ein paar Wiederholungen und bessere Lösungen wirklich die ersehnte Symptomerleichterung bringen? In der Literatur ist man durchwegs damit glücklich, wenn der Patient ehemalige Konflikte neu durchlebt. Ob es dem Patienten auch besser geht, gilt als eine überflüssige Frage. Auch auf Kongressen hört man nie die Frage: „Ach, wie geht es übrigens dem Patienten?" - 1940 erzeugte auf einem US-Kongress diese Frage tosendes Gelächter, weil man eine solche Frage als „unanalytisch" bewertete, Lit. beim Verf...
Allerdings kann es so klingen, dass im Buch (S.117) anscheinend diesen simplen Behandlungstheorien noch angehangen wird, wenn etwa darauf abgehoben wird, der Analytiker habe in solchen Fällen die Ursachen oder seine Gegenübertragung nur noch nicht richtig erkannt, namentlich die Eigenart des Patienten noch nicht richtig erkannt, den „unbewussten Sinnzusammenhang" (S. 119) (einschließlich der Übertragungen und Gegenübertragungen, Verf.) im Patienten nicht erkannt (S.118), habe sozusagen (Verf.) noch nicht gründlich genug analysiert. Das ist ein verhängnisvoller Irrtum nach der Devise: „Analysiere mehr, Genosse, analysiere fleißiger und länger!" oder „Mehr hilft mehr", die schon spätestens Watzlawik widerlegt hat. Dieser Irrtum hat einfach zuviel Unglück angerichtet, als dass man ihn übergehen dürfte, besonders in Langzeitanalysen (1000 Stunden, 3000 Stunden).
Von Sinnzusammenhängen haben wir alle inzwischen genug.
Auch die direkte Ansteuerung des Selbstwertgefühls („Selbstwertbalance") als Zielpunkt, vielfach propagiert (aber nicht von Gray, wie der Autor meint, aber offenbar vor diesem) hat nicht das gehalten, was sie versprochen hat, (S. 131 und zuvor). Denn auch hier zeigte sich der Teufel im Detail, nämlich in fehlender technischer Anweisung, wie denn eine solche zu erreichen sei. Solche Empfehlungen gleichen platten Wunschvorstellungen, die gewiss gern überall Gehör finden. Ohne Angaben, wie dies zu erreichen sei, sind sie realitätsfremd und therapeutisch wertlos, vielleicht sogar als zynisch bewertbar. Soll man etwas einem Anorektiker sagen, er müsse als erstes seine Stimmung verbessern, sein Selbstwertgefühl heben und einfach mehr essen, dann werde es schon? Verbesserung des Selbstwertgefühls ist eine Folge guter Therapie mit Symptomerleichterung, weil jeder innere Konflikt oder jede innere Unstimmigkeit mit den unvermeidlichen sozialen Folgen am Selbstgefühl nagen muss, aber nicht direkt beeinflussbar ist, etwa nach der Devise: „Fühle dich wertvoller, Genosse!", „finde deine Selbstwertbalance (Autor), Genosse!". Darauf kann ein Patient nur antworten: „Jawoll!".
Das Konzept von Gray
funktioniert in der Theorie geradezu wundervoll: Der Patient findet und bearbeitet mit seiner Selbstbeobachtungsfunktion selbst seine Abwehr, gibt sie schrittweise auf und lernt, die unangenehmen Affekte, welche die Abwehr ausgelöst haben, wie Angst, Schuldgefühle, Schamgefühle zu ertragen und kann dann erst recht seine Abwehren fallen zu lassen. Wie schön. Es fehlt aber an Hartnäckigkeit bei den Analytikern, auch konsequent bei diesem Vorgehen zu bleiben, denn dazu müsste er sich fortlaufend voll darauf konzentrieren, und dieses ist mühevoll. Da ist es doch bequemer, sich die Assoziationen der Patienten anzuhören, und seine kindliche Vorgeschichte dazu. Auch sind nur wenige Patienten (aber es gibt sie!) bereit, diese Mitarbeit zu leisten, denn sie sind gewöhnt (um nicht zu sagen, verwöhnt), dass der Therapeut die ganze Arbeit leistet (Anspruchshaltung der Versicherten, bei fehlender finanzieller Selbstbeteiligung, und sei diese noch so gering) und dass sie jede Art von Diagnostik und Therapie lediglich an sich erdulden müssen. Von diesen Schwierigkeiten, die diesmal auch erheblich auf der Seite der Analytiker liegen, erwähnt der Autor nichts.Dass Vorwürfe von Solipsismus, Selbstfixiertheit, Überheblichkeit an die Psychoanalyse nach wie vor nicht ganz unberechtigt sind, zeigt sich auf S 122: „.. dass.. der Analytiker sich nicht nur mit seinen Interpretationsentwürfen... beschäftigt, sondern sich auch (! Verf.) in seinen Patienten hineinversetzt.." Hier wird dem Patienten und seinem Innenleben ein nur sekundär zu beachtender Status zugebilligt. Soll der Analytiker mehr mit sich selbst als mit dem Patienten befasst sein? Es scheint so, und viele Buchtitel weisen darauf hin. Feiert hier die bekannte Therapiefeindlichkeit vieler Analytiker fröhliche Urständ? Das offiziell Geleugnete kommt doch immer wieder hervor, - unversehens Wiederkehr des Verdrängten, wenn nicht ständig achtgegeben wird.
Auch in diesem Buch hätte man gern etwas mehr erfahren, wie denn nun eine analytische Psychotherapie, konkret an einem Fall dargestellt, vor sich geht und welche Erfolge damit erzielt werden. Noch so gut durchdachte Betrachtungen über „Oberfläche und Tiefe" können hierfür keinen Ersatz bieten, sie scheinen manchmal sogar die Funktion zu haben, von der konkreten therapeutischen Aufgabe abzulenken, sodass deren Nichterfüllung nicht weiter auffällt (Ausflüchte, evasions, otgoworkii).
Aber dieser Pferdefuß der Psychoanalyse ist nicht dem Autor anzulasten, sondern bereits Freud (s. Pohlen, M.2006: Die Sitzungsprotokolle Ernst Blums 1922).
Immerhin bietet der Autor hier doch eine Reihe von konkreten Interventionen – verschiedener Richtungen an (S.133-138). Was aber fehlt, ist ein jeweils folgender Dialog. Deutungen zu geben ist ja nicht schwer. Schwieriger und erst therapeutisch gewinnbringend ist es aber erst, die Antworten des Patienten, nonverbale und verbale, wahrzunehmen und dann weiter zu analysieren, und ab hier kann man erst von analytischer Bearbeitung sprechen. Im Gegenteil lässt sich das bloße Aufzählen von Deutungen auch als Selbstherrlichkeit verstehen, nach dem Motto: „Der Analytiker hat gesprochen, Amen". Wenn der Patient die Deutung nicht nutzbringend verwerten kann, ist er „selbst schuld", so nur zu oft der Tenor in der analytischen Literatur, -hat er doch die einmalige Gelegenheit, einen inneren Konflikt zu lösen, verpasst. Wiederholt ist ja den Patienten bei ausbleibendem Erfolg vorgehalten worden, sie hätten eben „vom Analytiker Gebrauch machen sollen".
Das Ausleben von Selbstherrlichkeit droht auch bei „abduktiven Deutungen" (nicht nur bei Bion), die zufällig sehr nützlich und bewegend sein können, mit dem Hauch genialer Einfälle, und nicht nur der Autor warnt vor einer „Mystifizierung" (S. 140). Unter den abduktiven Deutungen sind auch naturgemäß viele unbrauchbare, aber es kann auch immer sein, dass ein Patient zufällig davon großen Nutzen hat, wenn sie einen unvorhersehbaren Bezug zu ihm hat. Der Patient verfährt hier nach „random firing".
Fallschilderungen von Wert finden sich bei der Besprechung der Abwehranalyse (S.145ff). In den Fallbeispielen von Bulimie und Zwangsstörung (147-148) wird jedoch das narzisstisch-aggressive Element, das gegen die Umgebung gerichtet ist, nicht gesehen oder unterbewertet. Gerade Essgestörte und Zwangsstörungen (wie auch Angststörungen und Phobien) tyrannisieren extrem ihre Familienangehörigen, das Pflegepersonal und die Psychotherapeuten, vor allem auch im stationären Bereich.
Vor allem wird nicht gesehen, dass viele dieser Patienten Genuss daran finden, sich selbst extrem in den Vordergrund zu stellen und Andere zu demütigen (insbesondere das Pflegepersonal, aber auch die Eltern). Es ist der Genuss des Narzissten, der anscheinend nicht gesehen wird.
Auch dieses Werk hinterlässt stellenweise den fatalen Eindruck, dass es sich entschieden zu wenig mit den aggressiven Regungen und deren Abwehr im Innenleben befasst, - zugunsten eines eher gütigen, wohlmeinenden Tonfalls, der vorzugsweise den passiv Erleidenden beschreibt und so manches Mal einseitig den „armen Patienten" mit viel angeblicher und tatsächlicher Empathie bedenkt, die das Leiden in den Vordergrund rückt. Vor dem Aggressiven aber macht die Empathie zu oft Halt, wie es heute überall zu sehen ist.
Das Aggressive wird dann gern mit allgemeinen Ausführungen über „Probleme"(so S. 149) zugedeckt, die manchmal etwas Pastorales an sich haben oder diesen Eindruck erwecken. Damit erweist sich das Werk in Teilen als compliancehaft mit der augenblicklichen öffentliches Tendenz zur ständigen Betonung von Gewaltlosigkeit, obwohl das Gegenteil davon ständig präsent ist und uns täglich vorgeführt wird, - im öffentlichen Raum wie im Privatleben. Somit macht das Werk die allgemeine Abwehr (Verleugnung, Verdrängung, Reaktionsbildung, Verschiebung) der aggressiven Regungen im Einzelpatienten, in Gruppen, in der „political correctness" mit und verfehlt somit die Aufklärung i. S. einer tieferen und möglichst vollständigen Wahrheitsfindung des Innenlebens (S,. 150: „..das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten einer bestimmten Kompromissbildung..") Aber dazu gehören seit dem späteren Freud auch die aggressiven Wünsche). Dies ist schade, verfehlt das Buch doch so, ein Gegengewicht zum common sense zu bilden, obwohl Psychoanalyse dazu prädestiniert ist wie kein anderes Fach. Das heutige Tabu besteht nicht in der Unterdrückung der Sexualität, sondern in der Tabuisierung der Bedeutung der Gewalt im menschlichen Seelenleben.
Auch in seiner Aufzählung der Quellen der Widerstände (S. 152) sind aggressive Regungen nicht explizit aufgeführt, obwohl sie die größte Rolle spielen. Dieses Thema wird immer wieder umgangen, so mit allgemeinen und zwar richtigen, aber in diesem Punkt nichtssagenden, umgangssprachenahen Floskeln, so auf S.152 „Schwierigkeiten mit... seinem Ehepartner", - kein Wort von den schweren aggressiven Auseinandersetzungen in Ehen (und Beziehungen überhaupt, auch am Arbeitsplatz) und deren Abwehr. Wenn es sich nur um „Schwierigkeiten" handelte, würden nicht soviele Familien katastrophal zerstört werden. Die verharmlosende, verdeckende Art des Umgangs wird auch hier deutlich, - die Auslassung ist nicht zu übersehen. Immerhin kommt der Autor auf der Folgeseite auf „Tötungsphantasien" zu sprechen, aber warum immer zuletzt? Er liegt damit im Zeittrend.
Diese aggressiven Regungen können Patienten fast ungehindert ausleben, weil die Gegenseite durch fürsorgliche und Schuldgefühle gehemmt ist, einzuschreiten oder sich zurückzuziehen. Das Selbstquälerische in der Symptomatik wird einseitig betont. Tatsächlich handeln Patienten oft „hart gegen sich selbst und grausam gegen Andere"(Verf.).
Aber auch für alle Regungen der Patienten, nicht nur seiner aggressiven, ist die gewaltige Handlungsmacht der Patienten nicht gesehen. Er wird einseitig als Opfer seiner Eltern, aber bereits zu wenig das seiner Geschwister und noch weniger das seiner folgenden Beziehungen gesehen. Alle Patienten sind auch handlungsmächtige Manipulationskünstler, sie beanspruchen nicht nur Gleichrangigkeit, sondern auch Überlegenheit (diese von ihnen gern als „Augenhöhe" bezeichnet), und dies nicht nur den Therapeuten, sondern auch ihrem ganzen Umfeld gegenüber, gerade auch am Arbeitsplatz, wo man ihnen keineswegs immer folgen mag.
Hier hat sich die Psychoanalyse überhaupt erst neu zu orientieren und sich von den traditionellen, oft auch linkspolitisch gefärbten einseitigen Sichtweise, sie seien nur hilfsbedürftige, „empathiebedürftige" Opfer und ihrer Gesundheit Beraubte, zu lösen.
Auf das Tausendfüßlerproblem in Diagnostik und Therapie bei Beachtung maximal vieler Gesichtspunkte und die dann nicht mehr erreichbare Integration von Gesichtspunkten wird kaum eingegangen. Es herrscht der Glaube an eine beliebige Integrationsfähigkeit im Patienten wie im Analytiker vor, also Selbstüberschätzung und Idealisierung des Patienten, der Therapeuten und der Behandlungsmethode selbst. Die Folgen solcher Versuche dürfte eher Verwirrung und trügerische Selbstzufriedenheit sein, im Analytiker wie im Patienten. Und von dieser aus ist es noch ein weiter Schritt, wenn nicht ein rätselhafter Hiatus, zur Minderung der Symptomatik, wegen der der Patient gekommen ist und die nur zu oft in Vergessenheit gerät vor lauter Intellektualisieren. Auf den Seiten 124-125 kommt der Autor diesem Auftrag näher, wenn auch das konkrete dialogische Geschehen nicht mitgeteilt wird.
Über „Interpretationsentwürfe"(S.122) und „Deutungshypothesen" (S.125-126) geht es nicht hinaus. Von diesen aber haben wir genug, - in jedem Sinne. Im Intellektualisieren („Glasperlenspiele") mittels unentwegt feiner ausgefeilter Begriffe sind wir Analytiker ja seit Freud große Meister.
Der Autor hängt dem Regressionsmodell an (S. 136), setzt sich aber nicht damit auseinander, dass Regression von Patienten oft nur gespielt ist, weil sie - mit Recht – glauben, dass der Analytiker solches gern hört, sogar begierig darauf wartet („Compliance", ein Übertragungsphänomen.des Patienten wie des Analytikers). Der Patient kennt seinen Analytiker nicht weniger als dieser ihn. Einer meiner Patienten sprach immer von „Lokolade". Schon vor Beginn einer Psychotherapie, sogar vor dem Erstgespräch, wissen die Patienten, was gern gehört werden wird. Hier wird die gewaltige Übertragung der Patienten, die diese von vorneherein mitbringen, übersehen, wie auch wohl die nicht weniger gewaltige Übertragung von Seiten des Analytikers auf den Patienten. Der Analytiker ist von vorneherein auf solche „Regressionsphänomene" eingestimmt und sieht sich darin nur zu gern bestätigt. Regression wird aber auch als Romantizismus (Renik 1998, 1999), als Sehnsucht und Anspruch nach der allerfrühesten Kindheit durch den Analytiker selbst erkannt, - auch hierauf geht der Autor nicht ein, -offenbar in Anpassung an die erwähnten Richtlinien der Versicherungen.
Muss es der Wunsch nach „Regression" (S. 156) sein, wenn ein männlicher Patient absagt, nachdem er die Puppen erblickt hat, welche die Therapeutin demonstrativ aufgereiht hat? Warum soll seine Absage durch „Angst vor ihrer Attraktivität" motiviert sein? Hier wird der erwachsene Patient nur klein gemacht, wie es in der heutigen Psychoanalyse weithin üblich ist. Dass der Patient hier nur aggressiv reagiert, weil er einen aggressiven, aufdringlichen Feminismus wittert und die Therapeutin so behandelt, wie er sich wohl von ihr behandelt fühlen wird, und kein Masochist sein möchte, kommt nicht in den Sinn. Es muss nicht so sein, aber es kommt gar nicht erst in den Sinn, - dies will ich sagen. Das normale Aggressive und Erwachsen- Männliche wird ausgeblendet, bis auf eine angeblich beängstigende erotische Vorstellung. Warum soll die Attraktivität einer Therapeutin einen erwachsenen Mann derart abschrecken? Weil er in der Analyse ein Kind sein soll? Weil er wie Freud eine Phobie vor Frauen haben soll? Dies ist schon deshalb nicht wahrscheinlich, weil er sich eine Frau für seine Analyse ausgesucht hat, - so groß also kann seine Angst vor Frauen nicht sein.
Auch im folgenden Fall (S.157), in dem ein Patient vor der Tür stehengelassen wurde, weil er zwei Minuten zu früh geklingelt hatte, vermeidet es der Autor, auf dessen Motiv zu sehen, nicht mehr weitere Therapie in Anspruch zu nehmen. Es ist das Motiv, einen Therapeuten abzulehnen, der ihn offenbar erniedrigen, erziehen möchte. Der Patient handelt hier aus einem durchaus erwachsen-reifen Motiv. Stattdessen bemüht der Autor eine Erinnerung des Patienten an seinen „autoritären Vater" (S.157) sowie eine Einordnung des Verhaltens als „Widerstand". Hier wird nur der analytisch gängigen Version der Bestimmtheit durch die Kindheit gefolgt. Der Patient wird hier wiederum als Kind mit einem neurotischen „Widerstand" gesehen, obwohl er sich doch als Erwachsener nur normal-gesund verhält. Wie routiniert, beflissen und voreilig und vorgestanzt solche eingefahrenen Gedankengänge sind, wird auch daraus ersichtlich, dass der Patient ja nur ein Erstgespräch hatte, und der Autor dennoch bereits – bienenfleißig – auf einen autoritären Vater schließt. An diesen beiden Fällen allein wird bereits die Voreingenommenheit des Analytikers unübersehbar. Nicht diese beiden Patienten stehen hier im Vordergrund, sondern die theoretische Voreingenommenheit des Analytikers („Kindheit", Regression", „Widerstand"). Hierzu schreibt der Autor selbst treffend (S.159): „Patienten... haben das Gefühl, dass ihr Therapeut von einer vorgefertigten Theorie ausgeht, aber sich nicht wirklich auf sie bezieht und auf das hört, was sie zu sagen haben". Wie wahr! Aber wie anerkennenswert auch, dass der Autor selbst dies bekennt, wenn er es auch nicht auf diese beiden Fälle anwendet. Routine ist der schlimmste Feind der Psychoanalyse (Verf.), - weil sie sich so vernünftig gibt und weil sie sich allgemeiner Zustimmung sicher sein kann.
Im Fall einer 38j. Patientin (S.167ff) nimmt der Autor deren biographische Schilderung anscheinend doch für bare Münze, als ob noch nie vom üblichen „parent blaming" und vom Abwehrcharakter biographischer Schilderungen gehört hätte. Aber er hat davon nicht nur davon gehört, sondern warnt sogar selbst (S.165) vor „biografischen Rekonstruktionen und „false memory". Diese Erkenntnis allein schützt also nicht, und überall kann man sehen, dass ihr nicht Folge geleistet wird. Das Gift der Konzepte von „Kindheit und Regression" wirkt noch immer.
Dass die Patientin es genießt, selbstherrlich auf ihre Eltern herabzublicken, ihrer Mutter vorzuwerfen, dass sie sich nicht scheiden ließ, und die Eltern mit Magersucht unter Druck zu setzen, kommt nichts ins Blickfeld, - dabei ist diese Art von narzisstischer Störung (Überheblichkeit und noch Stolz auf diese Überheblichkeit, Verdrängung jeglicher Schuldgefühle) gang und gäbe.
Immerhin fällt dem Autor auf, dass sie „unbezogen" ist und ihren „eigenen Anteil „ an den gescheiterten Männerbeziehungen nicht reflektiert, aber es fällt kein Wort über den aggressiven Narzissmus, obwohl er diesen zweifellos gefühlt hat.
Es entspricht zu sehr der heutigen Psychoanalyse, Schmutz und Aggressivität nicht anzufassen. Es dient auch nicht dem näheren Verständnis, den Fall mit Freuds Fall „Dora" zu beschweren, - deren Analyse ohnehin gescheitert war. Muss man einen Patienten zu verstehen suchen, indem man solches tut? Wie informativ soll die Mitteilung sein, sie sei eine „äußerlich anziehende junge Frau" gewesen. Will der Autor damit sagen, dass die Attraktivität ihren Narzissmus gefördert habe und er das Aggressive in ihr gespürt hat? Dass seine Gegenübertragung ihn gewarnt hat? Darf dies der Autor offenbar nur gut fühlen, aber nicht darüber Näheres schreiben?
Man kann in der heutigen Psychoanalyse nur zu oft den Eindruck gewinnen, dass gewaltige Selbstzensuren i.S. einer pseudoanalytischen „correctness" kräftig am Werk sind. Über wirklich unangenehme Themen spricht man nicht. - Hätte der Autor übrigens eine andere Psychodynamik vermutet, wenn sie weniger attraktiv gewesen wäre? Nicht nur Analytiker werden gewöhnlich idealisiert, sondern auch die Patienten, diese wohl noch mehr.
Was ich damit sagen will: Aggressivität und aggressiver Narzissmus in Patienten werden von Analytikern wie von fast allen Personen, - denn Empathie haben keineswegs die Analytiker nicht für sich gepachtet, Nachbarn haben sie ebenfalls - unterschwellig sehr wohl wahrgenommen, spätestens an ihrer Gegenübertragung erkannt, aber dennoch tabuisiert. Es liegt nicht an der Wahrnehmung, sondern an der Selbstzensur. Pflichtgemäß befasst sich hingegen der Analytiker (S.170) ausgiebig mit der erotischen Gegenübertragung und mit seiner eigenen Biographie. Diese sind heute nicht tabuisiert, - wahrscheinlich waren sie es nie, und es ist kein Kunststück, vor allem nichts Neues, über sie zu schreiben. Vor allem aber wird immer wieder übersehen, dass die Patienten nicht wegen ihrer erotischen Übertragung und auch keineswegs wegen der Besonderheiten und liebenswerten Eigenschaften des Analytikers gekommen sind, sondern allein wegen ihrer Symptomatik (Beschwerden), die sie loswerden möchten. Andere Motive wie bloße Selbsterkenntnis, „Befriedigung von Neugier über sich selbst" oder erweiterte Weltkenntnis werden ihnen von interessierter Seite unterstellt, um Psychoanalyse als Vehikel zu benutzen. Es ist auch sehr die Frage, ob hier zur Behandlung (S.187-188) wirklich der Rekurs auf die eigene Mutterbeziehung des Analytikers notwendig, zweckmäßig (so im Sinne der vom Autor so hervorgehobenen Richtlinienpsychotherapie) oder wenigstens von Nutzen war, statt die inneren Konflikte in der Patientin direkt anzugehen (etwa durch Abwehranalyse). oder der Patientin die Lösung selbst zu überlassen (nach Sampson und Weiss ab 1982, s.u.). Sind solche Rekurse nicht doch etwas zu umständlich? Ist nicht der aggressive Narzissmus dieser Patientin auch ohnehin ersichtlich? (S 187:: „..diese nur um sich selbst kreisende, keine Rücksicht auf Andere nehmende, übermäßig ansprüchliche Person... beklagte sich.."). Hilft es dieser Patientin, wenn ihr Analytiker „seine Mutterbeziehung ganz ähnlich erlebt" hatte (S 188)? Der Diagnostik hat dieser Umweg nicht geholfen, aber vielleicht der Therapie? Die Anhänger der „inneren Verarbeitung im Analytiker" schwören auf sie als die via regia: „Intermediärer Raum", „Reverie", „Das analytisch Dritte", die Dritte Position", „Inneres Mitschwingen auf mehreren (! Verf.) Sinneskanälen sowie ein inneres Verstehen und Integrieren der unbewusst wahrgenommenen kommunikativen Signale"... „als ob ein Patient spüren kann, wie sein Analytiker mit den angetragenen widersprüchlichen Rollen, den traumatischen Gefühlen, der verzweifelten Abwehr gegen eine gefürchtete Retraumatisierung, dem inneren Zerrissensein selbst umzugehen und zu Rande zu kommen versucht" ... „vor allem auch anhand vieler nonverbaler Beziehungsphänomene (S.194). Der Patient erfahre so neue Möglichkeiten, mit dem auswegslos Escheinenden, den ..Wiederholungszwängen, dem Sich-Verrennen, der Sprachlosigkeit, dem Nicht- Fühlen –können zurecht zu kommen und diese in kleinen Identifikationsschritten mit den mentalen Verarbeitungsprozessen seines Analytikers zu übernehmen"... „vorrangige Aufgabe eines Analytikers sei, die Beziehung zu seinem Analysanden zu überleben"(S. 195, zit nach Zwiebel 2003), „die viel stärkere Berücksichtigung des Beziehungsgeschehens, der Persönlichkeit des Therapeuten und der Auswirkungen seiner Subjektivität auf den Patienten".
So neu wie dargestellt sind solche Gedankengänge nicht. Das Konzept von Aufnahme (containing) durch den Analytiker und Rückgabe an den Patienten nach „Detoxifying" (S.198: „...um auch toxische Emotionen in sich aufzunehmen und verarbeiten zu können") gehört längst zum analytischen, eingängigem Inventar (Kleinianismus, Bion). Dies gilt auch überhaupt für die Konzentration auf das „unbewusste Beziehungsgeschehen (in) analytischen und therapeutischen Prozessen" und auf den „unbewussten ..- mikroprozessualen, kontinuierlichen -Handlungsdialog, das Enactment,(S 198), mit „Bewusstwerdung im Analytiker" und die „symbolisierenden Verarbeitungsprozesse.im Analytiker selbst..." und der Notwendigkeit für den Patienten, „sich mit den inneren Arbeitsvorgängen seines Analytikers zu identifizieren". Dies ist mittlerweile ein alter Hut. So notwendig diese Gesichtspunkte auch sind, - die erhofften und implizit versprochenen sensationellen therapeutischen Vorteile haben sie bislang nicht gebracht. Dazu äußert sich der Autor nicht, wenn er auch auf die Schwierigkeiten hinweist. Fortschritte in der Theorie haben offenbar Vorrang vor Verbesserung der Therapie. Wozu noch in der Therapie Verbesserungen, wenn man diese in der Theorie schon schwarz auf weiß hat?
Im Ton schwingt eine gewisse postulierte Heldenhaftigkeit im Analytiker unangenehm mit. Was ist dies für ein Bild von einem Analytiker? Ist dies wieder einmal eine Erhöhung, eine Idealisierung, eine Mystifizierung? Deshalb muss aber Analysieren nicht gleich ein „unmöglicher Beruf" sein (Freud 1937 c, Schneider 2006, zit.n.Autor).
Auch eine „Verunsicherung auszuhalten", was der Autor (n. Zwiebel 2007) zitiert und empfiehlt, kann allein nicht ausreichen. Hier besteht die Gefahr, zu ertragende Erschwernisse, wie es auch noch viele andere gibt, mit besonderen therapeutischen Erfolgen zu verwechseln. Sind diese vermeldet? Der Autor stellt neue analytische Ideen des Verständnisses oder solche, die neu erscheinen, vor, aber vor einer therapeutischen Bewertung hütet er sich. Hatte der Titel: „ ... –technik" nicht etwas mehr versprochen?
Der Autor nimmt nicht dazu Stellung, ob sich Analytiker mit diesen Aufgaben nicht übernehmen (Tausendfüßlerproblem). Hoffentlich werden hier nicht wieder Versprechungen suggeriert, die nicht gehalten werden können, oder nur von Ausnahmetalenten, - es wäre nicht das erste Mal. Es ist ja nicht nur so, dass der Analytiker diese gewaltigen Aufgaben in sich stemmen muss, sondern dass der Patient daran auch teilzuhaben hat, will er für seine Störung Gewinn daraus haben.
Man kann bei näherer Lektüre den Eindruck haben, dass beides miteinander gleichgesetzt wird. Der Autor nimmt hierzu ebenfalls nicht Stellung. Wunschdenken reicht nicht, ein Gefühl, „stolz darauf zu sein" (S.195), auch nicht. Der Patient ist nicht gekommen, damit sein Analytiker sich stolz fühlt. Andernfalls sollte der Analytiker seinen Patienten bezahlen, denn er hätte etwas vom Patienten bekommen.
Auch „Verständnis" allein reicht nicht, Analytiker müssen auch liefern. Analytische Arbeit muss sich von Spontanverläufen unterscheiden. „Veränderungen im Patienten und im Therapeuten" (S.199) reichen dazu nicht, Forderungen danach, für die Zukunft erhofft, ebenfalls nicht. Analytiker haben nach der Gesetzeslage, an der Richtlinienpsychotherapie, die der Autor allem voranstellt, einen Heilauftrag zu erfüllen.
Die Patienten bemerken es sehr wohl, wenn sich der Therapeut intensiv mit sich selbst beschäftigt, denn sie beobachten ihren Therapeuten nicht weniger intensiv als dieser sie, und sie fühlen sich wohl kaum noch als Person voll wahrgenommen, wenn ihr Analytiker sich derartig mit sich selbst beschäftigt. Dazu sind sie erst mal nicht gekommen. Ist dies bedacht? Für das Vertrauen (Arbeitsklima) dürfte dies zunächst und auch auf Dauer ungünstig sein. Die Patienten wollen einen Unterschied sehen zwischen Befassung mit ihnen und der des Therapeuten mit sich selbst. Auf keinen Fall wollen sie z.B. etwas hören aus der Biographie oder den persönlichen Konflikten des Analytikers oder seinen Träumen.
Patienten können sich auch auf diese Weise benutzt fühlen
, zur Lösung innerer Konflikte ihres Analytikers beitragen (ausgenutzt zu werden) zu müssen, ohne hierzu gefragt zu werden, und sie wehren sich auch augenblicklich entschieden gegen solche Vereinnahmungen, es sei denn, sie sind ungewöhnlich „gehorsam" i.S. von Unterwerfung („Compliance"). Hier würde es sich um eine andere, freilich schwer erkennbare und keineswegs justiziable (schon wegen fehlendem Dolus) Form von Missbrauch handeln, über die nirgendwo gesprochen wird. Sind im Buch die Rechte und Erwartungen der Patienten hinreichend betont?Verdienstvoll ist, dass der Autor die Auffassungen von Sampson & Weiss (Mount- Zion -Gruppe, ab 1982, (S.174 ff)) erwähnt, die in Deutschland nur kurz rezipiert worden sind und so gut wie keine Schüler gefunden haben: Der Patient sucht Sicherheit beim Therapeuten, damit er – auch ohne Deutung, namentlich auch ohne Deutung der Abwehr – selbst (!) seine symptomverursachenden Konflikte lösen kann. Der Patient hat schon vor Beginn der Analyse einen Plan, wie er seine inneren Konflikte meistern kann, und sucht dazu Sicherheit als Voraussetzung. Um Sicherheit zu gewinnen, stellt er seinen Therapeuten auf die Probe, auch auf sehr harte, führt ihn z.B. „in Versuchung", die Therapie vorzeitig zu beenden, indem er diesem dies in den Mund legt. Besteht der Therapeut die Probe nicht, ergreift der Patient die Flucht. Besteht er sie nur schlecht, geht der Patient in Stagnation, d.h. er geht auch kein Risiko mehr ein, sich selbst zu beobachten und seinen Konflikt selbst zu heilen. Erkennt der Therapeut diesen eigenen Plan des Patienten, kann er „Pro-Plan Interventionen" erfinden. Neuartig war auch die Betonung darauf, dass der Patienten seinen Therapeuten hierzu genau beobachtet. Diese Autoren konnten, m. W. als einzige Therapeuten, gültige Voraussagen machen. Diese Autoren sind damit auch als Erste deutlich von Freuds Thesen abgerückt, der Patient wolle mit Hilfe des Therapeuten nur seine kindlichen Wünsche erfüllen. Sie nehmen auch Wesentliches von Gray vorweg, indem sie die Selbstbeobachtung und die Mitwirkung des Patienten in den Vordergrund stellen. Ähnlich wie Gray es später ausgeführt hat, verlegen sie darauf den Akzent, - von Übertragung und Gegenübertragung weg, nicht erst mit Bollas (2006), wie der Autor erwähnt, der die heute ständig geforderten „Hier- und Jetzt-Übertragungsdeutungen" als Verkürzungen verstanden hat. Die Therapie soll dem Patienten die Sicherheit geben, die er braucht, seinen Plan nach Selbstmeisterung zu verfolgen. Auch die Biographie verliert wie bei Gray deshalb an Bedeutung.
Dass mit dem strapazierten Begriff der „Regression" das Pferd von hinten aufgezäumt wird, indem diese Richtlinien notorisch mit einem Beweis von Regression verwechselt werden, wird nicht erkannt, weder für den Einzelfall noch theoretisch. Dabei ist der Begriff der Regression längst in der Diskussion.
Im Buch ist viel (und richtig) von Gegenübertragung des Analytikers auf den Patienten die Rede, aber die nicht weniger gewichtigen Übertragungen des Analytikers auf den Patienten sind mehr oder weniger unbeachtet geblieben, wie überhaupt in der analytischen Lehrtradition und in offensichtlicher Anpassung an diese (Compliance auf Seiten der Analytiker). Warum soll der Analytiker denn keine Übertragung auf den Patienten haben? Warum soll sie geringer ausfallen als die des Patienten und die Psychotherapie jeder Art nicht ebenso beeinflussen? Er ist doch ein Mensch, er kann doch gar nicht anders, ob neurotisch oder nicht.
Der Autor verzichtet wohltuend auf den letztlich wohl misogynen Standard- Vorwurf an die Mütter, sie hätten besser „spiegeln" sollen (Fonagy u.a.).
Ein hilfreiches Buch, wenn auch nicht ohne schwere Mängel.
Theorie steht im Buch zu sehr vor Therapie.
61462 Königstein, 2017
Dr. Manfred Krill, Psychoanalyse (DPV, IPV, FPI, IPAA)
Bücher
|
Das Gutachterverfahren für tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie Verlag: Psychosozialverlag, Gießen ISBN: 978-3- 89806-773-7
|
|
Ödipus' Ende, Sophokles (497/96-406 v. Chr.) Verlag: Peter Lang, Frankfurt ISBN: 978-3-631-61407-5
|
|
Klassische Psychoanalytische Kompromisstheorie Verlag: Dr. Krill Verlag, Königstein ISBN: 978-3-9815177-1-2
|
|
Sophokles Ödipus in Kolonos Drehbuch von Manfred Krill Verlag: Dr. Manfred Krill Verlag, Königstein ISBN: 978-3-9815177-0-5
|
|
Anorexia nervosa und Aggression Neue Psychodynamik nach der Klassischen Kompromisstheorie Verlag: Dr. Manfred Krill Verlag, Königstein ISBN: 978-3-9815177-0-5
|
|
Klassische
Psychoanalytische Kompromisstheorie und ihre Auswirkungen und
Nichtauswirkungen auf Psychoanalytiker, Patienten und Gesellschaft
Symptombildung als Kompromiss ISBN 978-3-9815177-5-0
Gruppenanalyse Neu, 158 Seiten, Preis 56 Euro gegen Vorauskasse Verlag: Dr. Manfred Krill Verlag, Königstein ISBN
978-3-9815177-6-7
Neue
Traumatheorie Das Schicksal der spontanen Traumafolgen: Einkapselung, Patinabildung,
Innere Auszehrung (Tafonisierung), aktive Zertrümmerung, Erosion,
einfacher Zerfall, spontane oder aktive Auflösung, Assimilation,
Ausscheidung? Das Schicksal der Traumaanalyse. von Manfred Krill
The
rehabilitation of movement-disturbed patients What
can modern psychoanalysis contribute to it? von
Manfred Krill ISBN 978-3-9815177-7-4
Dr. Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse (ISBN
978-3-9815177), D-61462 Königstein
Как
работает
психоанализ
в
групповом
анализе? von Manfred Krill ISBN
978-3-9815177-8-1 Dr.
Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse (ISBN 978-3-9815177) D-61462 Königstein im Taunus
Analyse durch Freud Die Sitzungsprotokolle Ernst Blums 1922 - psychoanalytisch neu gelesen Lehranalyse, Ausbildungsanalyse, Selbsterfahrung: Wirklich unentbehrlich? Wirklich keine rechtlichen Bedenken? von Manfred Krill ISBN 978-3-9818213-2-1 Dr.
Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse (ISBN 978-3-9815177) D-61462 Königstein im Taunus
Krill, Manfred / Tuin, Inka: (2018)Gestörter Schlaf und Schlaflosigkeit , in Krovoza, Alfred / Walde, Christine: (2018) Traum und Schlaf, ein interdisziplinäres Handbuch , 316- 329, J.B. Metzler Stuttgart, imprint Springer Verlag, Springer Nature ISBN 978-3-476-02486-2
Friedrich Hölderlin (1770-1843) Eine Pathographie ISBN 978-3-9818213-2-1
Karl May (1842-1912) ISBN 978-3-9818213-5-2
Letter to Japan Psychoanalytic Society
|