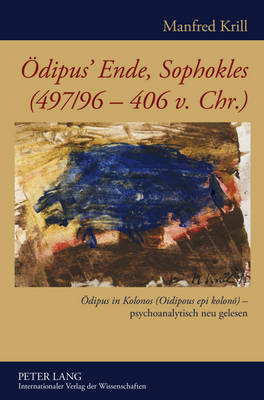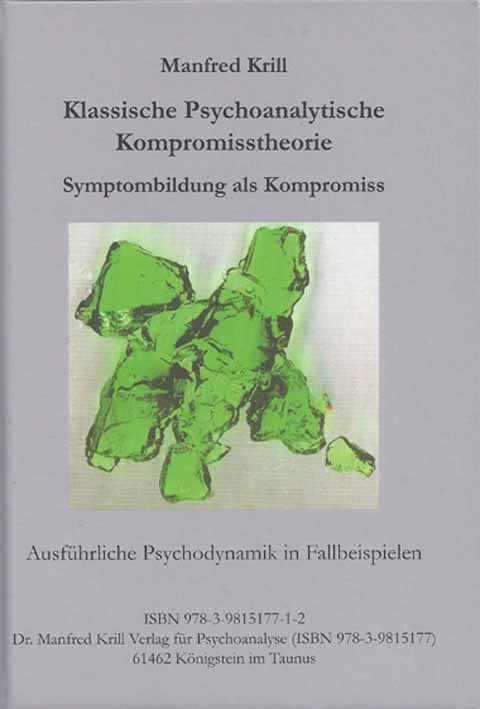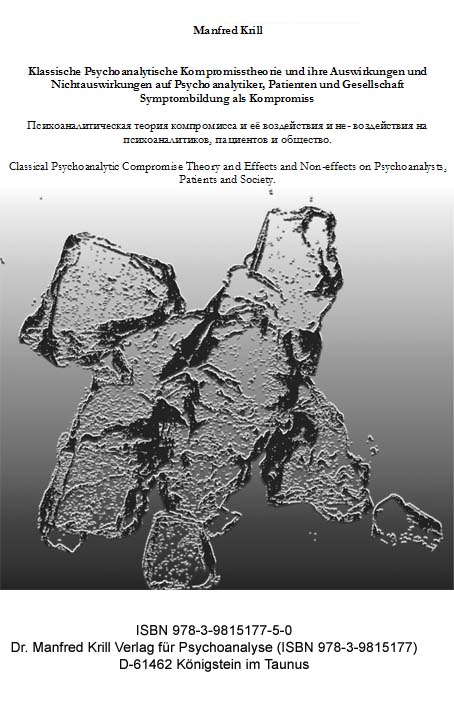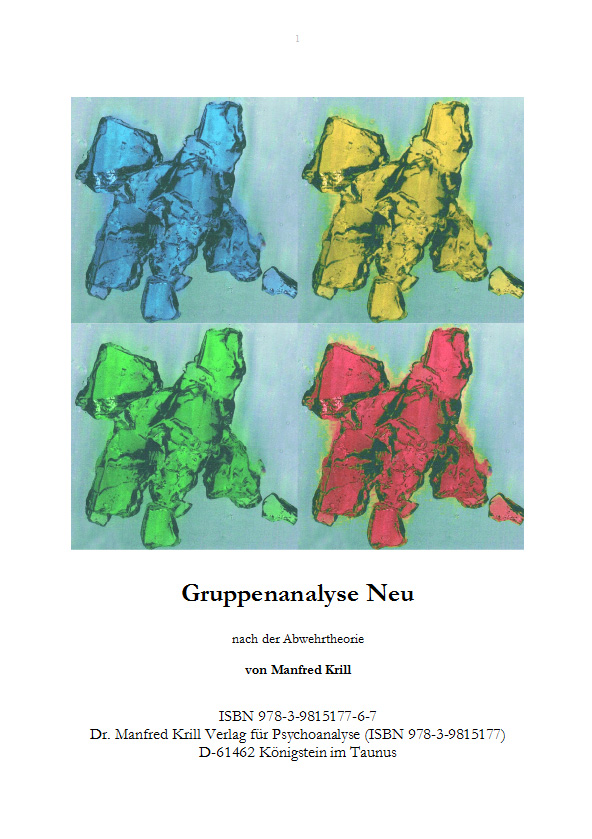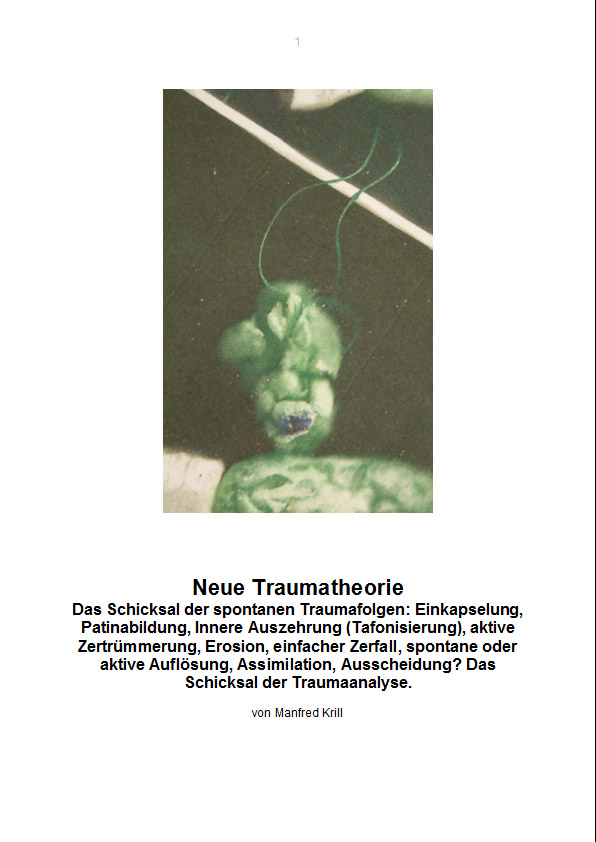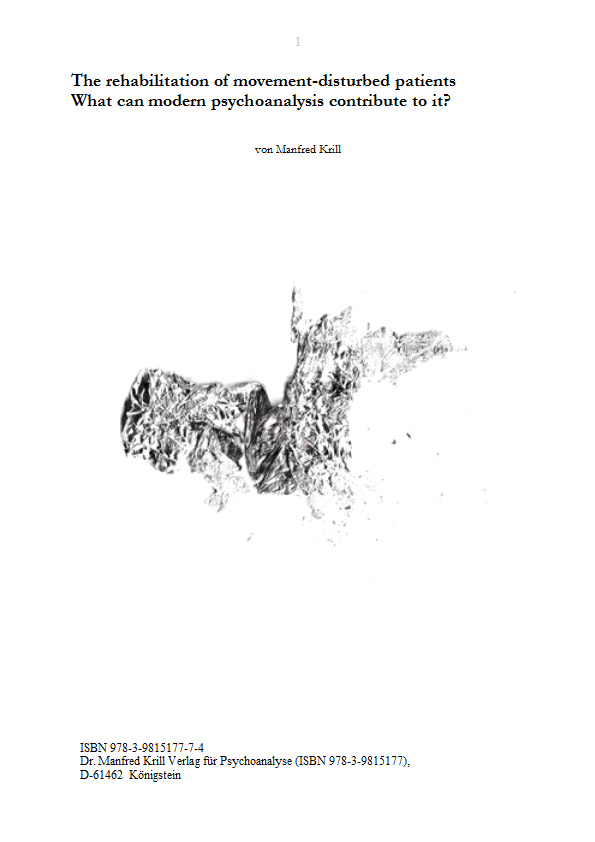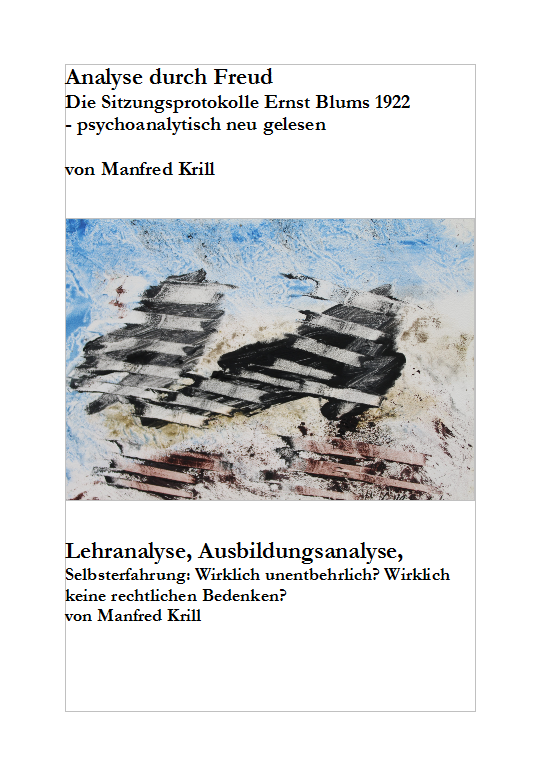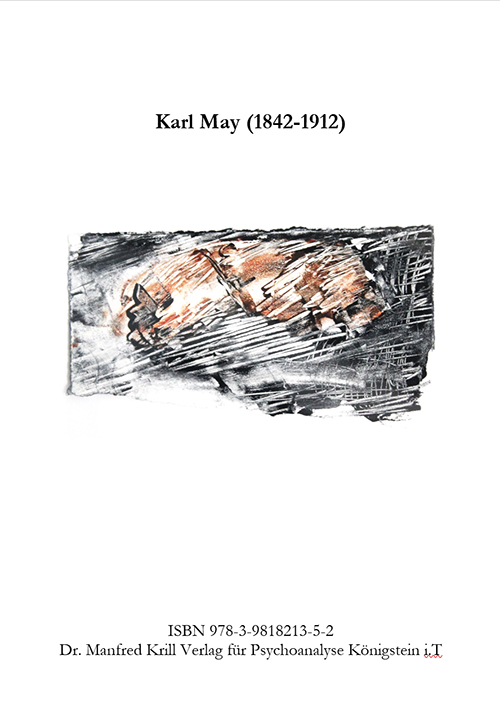Neuere psychoanalytische Gesichtspunkte
von Manfred Krill
ISBN 978-3-9818213-0-7
Dr. Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse (ISBN 978-3-9815177)
61462 Königstein im Taunus
Impressum
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http:/ dnb.ddb.de> abrufbar.
Originalausgabe
Buch, ungebunden
(C) 2014 Dr. Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse, Hainerbergweg 53, D-61462 Königstein
Satz und Druck: Dr. Manfred Krill (Autor), Königstein
Schrift: Arial, Garamond
Das Urheberrecht: liegt ausschließlich bei Dr. Manfred Krill. Alle Rechte sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, übersetzt oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Autor und Verlag übernehmen keine Verantwortung und keine Haftung, die auf irgendeine Weise aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entstehen könnten. Geschützte Warennamen oder Warenzeichen werden nicht besonders gekennzeichnet. Hieraus kann nicht geschlossen werden, dass es sich um freie Warennamen handelt. Ähnlichkeiten mit Personen sind rein zufällig. Keine der Krankengeschichten hat reale Personen zum Inhalt. Bei der Bewertung von Zitaten von Autoren und sonstigen Personen sind nicht diese Autoren oder Personen persönlich gemeint, sondern nur deren vermutliche Meinungen, Thesen, Behauptungen und sonstige Aussagen.
Printed in Germany, 1. Auflage
ISBN 978-3-9818213-0-7
Verlag ISBN 978-3-9815177
Umschlaggestaltung (Deckblatt) von Manfred Krill
Neuere psychoanalytische Gesichtspunkte
von Manfred Krill
Mit Arzt, Psychotherapeut, Analytiker, Patient und Analoga ist nicht das Geschlecht gemeint, sondern die Funktion. Wer bei jeder Funktion zwangshaft an das Geschlecht denkt, dem sei anheimgestellt, sich nach seinen Motiven dafür und deren Abwehr zu fragen.
Die Leistungsfähigkeit der Mainstream-Analyse, der Klassischen Kompromisstheorie, steht außer Frage. Abwehranalyse weist uns, und vor allem unseren Patienten selbst, einen klaren und attraktive Weg, die inneren Konflikte zu verstehen und zu lösen. Nur weil sich andere Trends oder Stile entwickeln, muss sie nicht zurücktreten. Sie darf auch nicht mit diesen verwässert werden. Sie muss vielmehr mit Konsequenz betrieben werden. Andernfalls geht das spezifisch Abwehranalytische in dem üblichen Ratespiel nach dem topographischen Muster unter. Das stark kontrastierende Prinzip der Abwehranalyse muss erhalten bleiben. Es hat auch den Vorteil, dass es für den Analytiker und vor allem für den Patienten selbst emotional einsichtig wird, um was der innere Konflikt geht, ohne dem Patienten in seinem emotionalen Erkenntnisprozess vorzugreifen oder ihn gar zu bevormunden, wie dies leider in vielen Analysen der Fall ist und wie es dadurch jede Therapie ins Leere laufen lässt. Das Abgewehrte bleibt solange offen, bis der Patient es selbst entdeckt, d.h. seine höchst persönlichen Nuancen erkennt.
Auch auf die immer schwer zu verstehende Gruppenanalyse kann sie mit Erfolg angewandt werden, und sie kann selbst so einen neuen Schub erfahren und so ihrem momentanen Aufmerksamkeitstief entkommen, das bereits das Ausmaß eines informellen Banns angenommen hat. Eine darauf beruhende Gruppenanalyse kann mit Recht als neu bezeichnet werden, denn hier wird erstmals die Abwehrlehre, ungeachtet ihres ehrwürdigen Alters (Strukturtheorie Freuds), konsequent und durchgehend erstmals auf die Gruppenanalyse angewandt.
Zugleich handelt es sich bei der Abwehrtheorie um eine gleichsam fundamentalistische Wendung zurück zu der ursprünglichen psychoanalytischen Idee des späteren Freud und seiner Tochter Anna Freud (1936: „ Das Ich und die Abwehrmechanismen"). und noch weiter zurück. Denn von Anfang an war Psychoanalyse eine Konfliktpsychologie, und dies ist sie jetzt wieder, etwa im Ggs. zum Kohutismus, zur Mentalisierungstheorie und den vielfältigen Versuchen der Politisierung. Abwehrtheorie, Kompromisstheorie ist eine Wiederentdeckung. Zwei Faktoren sind und bleiben darin einander entgegengesetzt.
Auf den ersten Blick wirkt Abwehrtheorie antiindividualistisch, da nur eine begrenzte Zahl von Abwehrmechanismen zu beachten ist, von denen zudem nur die Vermeidung und die Intellektualisierung besonders häufig sind, während andere doch sehr zurücktreten. Aber was abgewehrt wird, - dafür lässt die Kompromisstheorie mehr offen als alle andere analytische Behandlungstheorien Das gesamte Spektrum von präödipalen, ödipalen und postödipalen Wünschen, darunter vor allem auch aggressive, Ängsten und Scham -und Schuldgefühlen bleibt offen.
In gewisser Hinsicht erscheint Abwehrtheorie auch entwicklungsfremd, sie mag sogar versteinert aussehen. Sie ist aber bei allem Traditionalismus in der Bearbeitung von inneren Konflikten pragmatisch ausgerichtet und äußerst beweglich, sie kann gute und zugleich rasche Erfolge vorweisen und kann im Ggs. zur herkömmlichen Bearbeitung, die rückwärtsgerichtet ist auf die angebliche Bearbeitung der Kindheit und auf eine angebliche Regression (die nach Ansicht des Verf. gar nicht möglich ist, - die erwachsenen Patienten bleiben erwachsen, sie geben sich aus Abwehrgründen nur kindlich, sie können nicht mehr so fühlen und nicht mehr so erleben wie als Kinder). Sie kann dadurch mit der VT nicht nur mithalten, sondern die VT durch ein umfassendes Verständnis der zugrundeliegenden inneren Konflikte auch im Ergebnis schlagen (Krill 2008: „Klassische Psychoanalytische Kompromisstheorie).
Abwehrorientierte Psychoanalysen sind wegen ihrer Konzentration auf den inneren unbewussten Konflikt außerordentlich erfolgreich. Der Verf. ist nicht der letzte Überlebende der Abwehrtheorie.
Es ist verwunderlich, dass sich niemand beschwert, dass die Abwehrlehre des späten Freud und seiner Tochter Anna Freud z. Z. teilweise ungenutzt für Theorie und Praxis der Psychoanalyse brachliegt.
Die Aufmerksamkeit im Tagesgeschäft ist auf Anderes gerichtet: „Mentalisierung", „Trauma", „Embodiment", „Eröffnen eines Übergangraumes (Winnicott 1953), auf „intermediären Raum", „analytischen Raum zwischen Patient und Psychoanalytiker" (ein äußerst vager, dubioser Ort, i. Ggs. zu Gefühlen, wie etwa Herzsensation, Magen- Darm Empfindungen, Kopfschmerzen, Benommenheit im Kopf, Schwindel im Kopf, Mattigkeit und Erschöpfungsgefühl im Kopf (hierzu die Redewendung: „Ich habe heute einen falschen Kopf", mündlich von Rolf Klüwer 1977), - denn es geht nicht um „Räume zwischen Personen", sondern um das psychische Innenleben, also die inneren Räume mit deren Psychodynamik, und in irgendwelchen Räumen zwischen Personen hat die Psyche nicht zu suchen und nichts verloren.), ähnlich diffus „Intersubjektivität", „Das Unbewusste", „Unbewusste Phantasie". „Präsenz, implizite Beziehungen, Performativität", („Emotionales Material taucht auf eine besondere Weise auf, sehr präsent, ohne Sprache, flüchtig wie Musik...eine spontane Performance. (nach der Sprechakttheorie eine ausgeführte oder konkretisierte Sprachhandlung mit deren Auswirkungen, - wobei aber gern übersehen wird, dass Psychoanalyse keineswegs nur aus Sprechen besteht und Sprechen überdies bereits der Abwehr, also dem inneren Konflikt, unterliegt, das Gesprochene also bereits einen Kompromiss darstellt. Dies übersieht man geflissentlich vor lauter Begeisterung für diesen Begriff. Man will einfach das Konzepts des inneren Konflikts und seiner Komponenten, insbesondere nicht mehr die Abwehr, im Spiel haben.),.unbewusste, handlungs- und körpernahe Erfahrungen, „die in der Analyse Raum bekommen wollen", „sonst entstehen unaufgelöste enactments, Handlungsdialoge, Inszenierungen, verwickelte Beziehungsverflechtungen, Transformationsblockaden", - als ob diese einer solchen Bedingung bedürften, sonst also nicht aufträten!
Nur zu gern wird übersehen, dass solche unausweichlich sind, wenn der innere Konflikt umgangen wird. Selbstverständlich schließt der innere Konflikt die erwarteten, erhofften, gefürchteten und auch tatsächlichen Reaktionen der Umgebung mit ein, so namentlich in Form der Vergeltungsangst und der Schuld- und Schamgefühle der Umgebung gegenüber.
Speziell beim „Mobbing" unter Schülern ist zu beachten, dass die Mitschüler ein natürliches Anrecht (natürliche Wünsche nach intensivem „Reibungs"- Kontakt mit Gleichaltrigen) auf eine normale Reaktion des „Opfers" haben. Sie wünschen vom Opfer keine Unterwerfung, keine Furcht, sondern kämpferisches Standhalten und kraftvolle Gegenwehr, - sie wollen einen Kameraden haben.
Dem entspricht die Erfahrung, dass ein „gemobbter" Schüler sofort an Achtung und Sympathie gewinnt, sobald er sich einmal kräftig zur Wehr setzt. Dementsprechend kontraproduktiv ist die pädagogische Weisung an Lehrer und Schüler, keine Raufereien auf dem Schulhof zu dulden („Der angegriffene Schüler darf sich nicht wehren", Grundschule Königstein i.T. noch 2008). Es ist aus analytischer, klinischer Sicht ein Irrtum, zu glauben, hier ginge es nur um Machtsausübung. Normale aggressive Wünsche nach Sich-Messen, nach Kampf, Auseinandersetzung, Triumph. werden in der Psychoanalyse und vor allem in der Soziologie einseitig verunglimpft. Nur im Sportwettkampf haben sie eine erlaubte Nische gefunden, in der sich auch die gewaltige aggressive Lust, zugleich im ersehnten Massenkontakt, äußern darf
Es handelt sich bei den o.a. Begrifflichkeiten weniger um wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse als um soziale, personenbetonte Vernetzungen innerhalb der Psychoanalyse und gesuchte Anleihen aus anderen Fachgebieten als Ausweichmanöver vor den schwierigen therapeutischen Aufgaben. Sie machen Psychoanalyse manipulationsanfällig. Das argumentative, kliniknahe, fallbezogene Handwerk ist dabei verlorengegangen, zugunsten von begrifflichen Verstiegenheiten, mitsamt der Neigung zu Substantivierungen mit absichtlich unbestimmter Bedeutung (Intransparenz, allgemeine, anonyme, mechanistisch anmutende Prozesse anstelle spezifischer innerseelischer Abläufe, so regulation (Fonagy et al), Regulierung von Affekten), die ersichtlich, geradezu phobisch, von einzelnen inneren Vorgängen und von allem Persönlichem absehen möchten. Das Wort regulation wird so verwandt, als ob damit bereits alles in Ordnung, weil „reguliert", wäre. Über den Weg, der eingeschlagen werden müsste, um diese „regulation" zu erreichen, wird kein Wort verloren. Es handelt sich hier um Wunschdenken, um ein Programm, das aber nicht als solches erkannt wird, eine Tendenz, die von Anfang an in der Psychoanalyse vorgeherrscht hat.
Erinnert werden soll hier nur an die notorische Verwechslung von Erklärungen über die- vermuteten - Ursachen wie Traumen, Fehleinstellungen der Eltern mit Therapien oder gar Heilungen. Einen „Analysenplatz" zu haben, wurde bis in die späten neunziger Jahre mit Heilung verwechselt, der Patient schien ausgesorgt zu haben.
Dies ist einstweilen roh gedacht und bedarf noch der weiteren Ausführung, um zu verstehen, wie es in einer Wissenschaft überhaupt geschehen kann, Wunschprogramme mit Realität zu verwechseln. Wahrscheinlich liegen dem übersteigerte, quasireligiöse Größenwünsche, Retter und Heiler zu sein, zugrunde.
Ferner wird oft nur aus Gründen der Bekräftigung angekündigt, was alles passieren wird, wenn man diese – angeblichen oder tatsächlichen - Phänomene nicht in der Psychoanalyse berücksichtigt, - „ wehe, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe" (W. Busch in Max und Moritz). Drohungen weisen immer auf eine Argumentationsschwäche hin.
Speziell zu „inneren Räumen": Ein Hauptaugenmerk der heutigen analytischen
Tätigkeit scheint auf der Aufgabe zu liegen, die inneren Räume des Patienten zu öffnen und durch den Patienten betreten zu lassen. Die Übertragung muss, so die Meinung, „in eine andere Person eingehen", um sich entwickeln zu können (Bürgin, mündliche Mitteilung, Klinisches Forum im FPI, Frankfurt, 25.4.15), und daraufhin muss sich etwas entwickeln, was im Einzelnen schwer voraussehbar ist. Jedenfalls kommt es zu einem lebhaften Hin und Her, zu einem intensiven Austausch von Gefühlen, Gedanken, Bildern und gewiss noch Sonstigem in beiden Teilnehmern, dies sowohl verbal wie nonverbal.
Dass wir aber die Aufgabe haben, innere Konflikte zu lösen, und jeder Einzelfall auf das Vorliegen eines inneren, unbewussten Konflikts sorgfältig geprüft werden muss, aber die Worte Konflikt und Abwehr in Diskussionen nicht mehr vorkommen, geht unter.
Zur Therapie genüge Einfühlung und Verbalisierung des Eingefühlten. .
Es handelt sich um einen phobischen Neglect, der nicht mehr auffällt.
Hier ist Abwehr gegen die Beschäftigung mit dem inneren Konflikt des Patienten durch Selbstidealisierung, Verleugnung und Negation am Werke. Was wird zugleich abgewehrt? Die Angst, die Geborgenheit in einer gewachsenen Gemeinschaft einzubüßen. Psychoanalyse heute ist auf dem Wege zu einem bedeutenden, gemeinsamen Wahrnehmungsdefizit. Es ist nicht die tatsächliche Bedeutung der Abwehranalyse, sondern eine zeitgenössische Gesinnung, welche diese zu marginalisieren versucht. Die Bedeutung der Abwehranalyse wird hier ex negativo belegt.
Dem Patienten, ob Kind oder Erwachsenem, steht ein riesiger innerer Raum, das psychische Innenleben, zur Verfügung, mit unzähligen Repräsentanzen von anderen realen oder phantasierten Personen, die mindestens ebenso vielfältig antworten und in Beziehung mit dem Ich, aber auch untereinander stehen. Dieser „innere Chatraum" (Verf. hier) ist Tag und Nacht geöffnet, und zwar, wie man auch von neurophysiologischer Seite heute weiß, in höchster Aktivität, mit keineswegs weniger Emotionen, während der Analytiker nur einige Stunden pro Woche, wenn auch wahrscheinlich oder gewiss intensiver, zur Verfügung steht.
Hier werden erneut die ungeheure Vielfalt und Potenz der Innenwelt des Patienten unterschätzt bzw. gar nicht ernstgenommen.
Es mag sein, dass es Patienten gibt, die unfähig sind, sich selbst solche inneren Räume zu erschließen. Dann heißt es gerne: „Das kann das Kind nicht allein, das kann der Erwachsene nicht allein, - da müssen wir helfen, da müssen wir die Patienten erst hinführen, ihm die inneren Räume erschließen oder erst in ihm entstehen lassen".
In Kliniken ist dies wohl eher zu erreichen. Hier ergeben sich von selbst langdauernde Kontakte zu anderen Patienten und zu dem behandelnden Personal, und kann eine Mentalisierung allmählich nachgeholt werden.
Die analytische Praxis sieht in Verfolgung des Ziels, innere Räume zu „erschließen", aber so aus, dass eine Unmenge flink hin – und hergehender Wünsche, Ängste, Schuld-und Schamgefühle und deren Abwehren, sich teils unmittelbar auf die Behandlungssituation, teils auf die tatsächliche oder vermeintliche Vergangenheit beziehend, und immer unter Nutzung von Empathie, die Stunden und die Berichte über diese Stunden füllt.
Fragen nach Bewertung des flinken Hin und Her, insbesondere nach psychopathologischer Bewertung im Vergleich zu – anderen -Normalvorgängen, werden nicht mehr gestellt. Man ist mit den eigenen Einfällen voll beschäftigt, als ob damit bereits irgendein Therapieziel erreicht wäre. Man kann hier den Eindruck einer institutionell getragenen Selbstverliebtheit in den eigenen Einfallsreichtum und den von nahe stehenden Kollegen und den um diesen kreisenden Wetteifer haben. Die Fertigkeiten der Analytiker, eigene Einfälle zu formulieren und miteinander sowie mit Anderem und mit den Einfällen Anderer, die in Hülle und Fülle aufkommen, zu verknüpfen und mit solchen zu konkurrieren, sind infolge jahrelangen Trainings enorm, täuschen aber darüber hinweg, dass sie den Charakter von Selbstzweck angenommen haben und der Gesamt-Zusammenhang, namentlich die klinische Bedeutung der beiderseitigen und allseitigen Einfälle und Antworten, außer Sicht gerät und, was bedenklicher ist, auch nicht Versuch erkennbar ist, dieser Bedeutung nachzugehen. Elegant gekonntes Zwitschern (man kann sich wie im Zoo fühlen) wird mit Therapie verwechselt. Das Diskutieren hat sich verselbständigt und sich an die Stelle einer Behandlung gesetzt. Der Therapieauftrag ist vor lauter Begeisterung für den Einfallsreichtum vergessen. Eine Analyse ist kein Konzert. Wir sind nur für Behandlung zuständig, für Anderes haben wir keinen Auftrag. So sind wir auch – entgegen gewissen tradierten Größenwünschen – nicht dafür zuständig, „den ganzen Menschen oder dessen „Innerstes" zu verstehen". Dies sind Ansprüche, die auf Überheblichkeit zurückgehen. Dies können vielleicht Pfarrer, Philosophen, Nachbarn besser erfüllen. Psychotherapie / Psychoanalyse ist nicht für alles Menschliche zuständig, sondern ausschließlich für die Psychopathologie eines Menschen. Wir sind keine „Psychiker", sondern Therapeuten, also Krankenbehandler. Eine analytische Therapie kann schon gar nicht darin bestehen, dass sich die Therapeuten nur noch mit ihrem Einfallsreichtum beschäftigen.
In neuerer Tradition wird darauf vertraut, dass es der Austausch schon genügend richten wird.
Da muss die Frage aufkommen, ob dies, also ohne Eingehen auf Abwehr oder überhaupt einen inneren unbewussten Konflikt, schon ausreicht, eine Besserung des klinischen Zustandes, die über spontane Besserung, z.B. im intensiven täglichen Spiel mit anderen Kindern oder intensiven Kontakt unter Erwachsenen / Jugendlichen, hinausgeht, zu erreichen. Psychoanalyse steht auch hier im Wettbewerb mit der alltäglichen Spontanbesserung.
Die o.a. und andere Begriffe entwickeln sich immer weiter, heiraten untereinander und zeugen Kinder, aber eine praktische Anwendung ist nicht erkennbar oder doch erheblich zurückgeblieben, bleibt jedenfalls kleinlaut. Es handelt sich um einen Anspruch mit langen Armen, aber lahmen Fingern. Demgemäß verdankt sich der augenblickliche Siegeszug dieser Begriffe nicht sachlichen Erwägungen, sondern der mitreißenden Aura des Neuen und Sensationellen.
Die Arbeit an den Begriffen ist heftig und weit ausgreifend, die am Patienten ist nicht mehr gefragt und jedenfalls nicht mehr erkennbar, letztlich auch nicht mehr beabsichtigt.
Grundbass dieser Anleihen mit ihren Selbstetikettierungen dürfte die Angst sein, in der Gesellschaft den Anschluss zu verlieren, - ohne dass immer schon geklärt wäre, was es mit diesen Begriffen auf sich hat und was sie mit der Psychoanalyse verbinden soll. Mit ihnen nur noch zu jonglieren ist die Lust der Intellektualisierenden.
Es muss die Frage entstehen, ob Fächer wie Philosophie, akademische Psychologie. Linguistik, Soziologie (es gibt zudem noch keine Soziologie der Psychoanalyse, i. Ggs. etwa zu Religionssoziologie, Militärsoziologie) wirklich ein gleiches Recht auf Repräsentation in der Psychoanalyse haben wie die Psychoanalyse selbst, also Psychoanalyse keine autarke Fachdisziplin wäre, oder ob sie auf dem Gebiet der Psychoanalyse einfach nur viel von sich her machen, gleichsam intellektueller Zierrat sind, sich aber nicht beim Wort nehmen lassen, da sie keine Patienten kennen, geschweige denn, einen behandelt haben, daher ihre Realitätstauglichkeit erst einmal nachweisen müssen.. Hier fehlt es oft an argumentativer Sorgfalt. Die große Anzahl der Begriffe auf den o.a. Gebieten lässt nicht erkennen, welche Funktionen sie in einer konkreten Behandlung erfüllen, also in welcher Weise sie zur Gesundung beitragen könnten, oder aber -außerhalb von Behandlungsgesichtspunkten - nur eine Präzision vortäuschen, die nicht besteht. Ein wichtiges Argument kann, wie erwähnt, sein, dass deren Vertreter nie einen Patienten von außen, erst recht nicht von innen, geschweige denn einen inneren Konflikt gesehen haben und somit nicht zuständig sein können. Es besteht ein legitimes Interesse an einer gewissen Homogenität und an einer persönlichen Qualifikation.
In der Praxis führt dies dazu, dass zwar jeder mitreden kann, aber nicht die gleiche Chance hat, sich durchzusetzen, sondern nur der, welcher Erfahrungen mit Patienten hat und eine eigene Lehranalyse sowie die Teilnahme an psychoanalytischen Curricula vorweisen kann.
Die Nichtzugehörigen werden also durch den Prozess der Ausbildung ferngehalten, sodass man wenigstens einigermaßen unter sich bleibt, zumal der Gegner einen Gegenpol bildet und so den Zusammenhalt der Gruppe der Psychoanalytiker dadurch noch fördert.
Längerfristig gesehen ist aber bereits eine Unterminierung dieser Gruppe im Gange, die man als „biologische Unterwanderung" (Verf. 2014, hier) bezeichnen könnte. Es gibt immer weniger Ärzte, besonders auch weniger Psychiater unter den Psychoanalytikern, aber umso mehr Psychologen, auch vereinzelt bereits Theologen, Historiker, Soziologen, Philosophen, die u. a. fleißig über Psychosen schreiben, aber nie eine im floriden Stadium gesehen haben, und die aus Berufen stammen, die nicht primär Diagnostik und Behandlung von psychischen Erkrankungen zum Ausbildungsziel haben.
Hierdurch sind fremde Fächer in das System eingedrungen und höhlen es von innen aus. Aus dem Außenfeind ist ein Innenfeind geworden und macht sich dort zunehmend breit, nimmt eine Führungsrolle in Anspruch.
Immerhin kann man auch die Meinung vertreten, dass die Psychoanalyse gerade wegen ihrer Abgeschlossenheit und ihrer Neigung zur Abgeschlossenheit interdisziplinären Austausch benötigt. Aber für die therapeutische Arbeit ist kein Nutzen denkbar. Es bleibt bei Intellektualisierungen zur Abwehr der Angst vor der psychoanalytischen Aufgabe.
Die inneranalytischen Verschiedenheiten und Streitigkeiten (so Kleinianismus, Kohutismus, Kernbergerismus, „Traumatheorien" vs. Abwehrtheorie) sind aber weit bedeutender als diejenigen mit anderen Disziplinen. Insofern relativiert sich die Bedeutung des interdisziplinären Dialogs noch einmal. Allerdings kann durchaus der Eindruck entstehen, dass analytische Richtungen, die sich innerhalb der Psychoanalyse nicht so recht durchsetzen können, nur zu gerne Halt und Unterstützung bei anderen Disziplinen suchen, sozusagen fremdgehen oder einheiraten, um sich aufzuwerten.
Hierzu ein Hinweis auf eine Entwicklung außerhalb der Psychoanalyse. Unter den Polizeiärzten findet sich kein einziger Psychiater mehr, in der Aus- und Fortbildung von Piloten sind an keiner Stelle Psychiater eingebunden, sondern ausschließlich Psychologen. Der Psychiater ist aber der einzige, der von seiner Ausbildung her einen psychopathologischen Befund erheben und eine psychiatrische Diagnose, etwa über das Vorliegen einer depressiven, einer schizophrenen oder einer hirnorganischen Psychose, oder einer Persönlichkeitsstörung, erstellen kann. Psychologen hingegen sind von ihrer Ausbildung her geeignet, die Leistungsfähigkeit zu messen, - ungeachtet, dass sie auch mit einer Zusatzausbildung zum Psychotherapeuten/ Psychoanalytiker ebenso gute Therapeuten sein können und sind. Psychologen waren einst nur schwache Konkurrenten der Psychiater und der ärztlichen Psychotherapeuten, aber nun es gibt in diesen (und anderen) Gebieten keine Psychiater mehr und immer weniger Ärzte mit deren größeren Erfahrung und Vertrautheit mit dem Körper. Es fand ein kompletter Austausch statt.
Dann haben wir auch das Phänomen der Feminisierung der Psychoanalyse, auch diese einhergehend mit einer Psychologisierung des Fachs. Es wäre naiv, anzunehmen, dass dies keine Folgen hätte. Einseitige Entwicklungen der Psychoanalyse wie Installierung einer Bemutterungstendenz, eines „race back" (Shapiro1981) zu immer früheren Entwicklungsstadien, eine einseitige Betonung des Wertes der Empathie und der Ausarbeitungen von Gefühlen und Gedanken durch den Analytiker (statt durch den Patienten selbst) und einer allzu harmonischen Konsensgesellschaft innerhalb der Psychoanalyse („Soft-Analytiker", Verf. 2014 hier) sowie eine zunehmende Körperferne (die dann wieder mühsam eingeholt werden soll mit Konzepten wie „Embodiment") mögen Folgen davon sein, wenn sie auch gewiss nicht die einzige Ursache dafür ist.
Zu „Intersubjektivität: „Zwei Subjekte, zwei Personen begegnen sich existentiell und authentisch und erschaffen (das Wort „schaffen" würde es hier auch tun statt des religiös angehauchten, in Richtung Großartigkeit gehenden Wortes „erschaffen") im Hier und jetzt einen Erlebnisraum (ein sehr fragwürdiger Platz) mit Inszenierungen, Szenen, Handlungsdialogen, Verwicklungen, Konflikten sowie Konfliktlösungen. .." (Markert 2012, 172).
Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass sich diese Erlebnisräume selbstverständlich nur in den beteiligten Personen selbst befinden, nicht in der Luft dazwischen. Die Grenze zur unzulässigen Reifizierung des Begriffs „Raum" ist nicht immer deutlich genug gezogen. Es gibt auch keinen „gemeinsamen Erlebnisraum". Jeder hat seinen inneren Raum in sich. Die Vorstellungen haben gewiss oft die gleichen Inhalte und sind insofern beiden gemeinsam, aber diese liegen nicht in einem Raum beieinander, sondern in zwei Räumen. Wenn der eine stirbt, ist nur noch ein (!) innerer Raum da. Dass die Teilnehmer oft das Gefühl haben, sich in einem Raum miteinander zu bewegen und in diesem die gleichen oder ähnlichen Gefühle, Erinnerungen, Vorstellungen und Abwehren zu haben, bleibt davon unberührt.
Reifizierung ist aber eine Gefahr, weil der Eindruck entstehen kann, als handele es sich um ein eigenes Wesen „Raum", das selbständig, in diesem Fall unabhängig von den beiden Personen oder den Gruppenteilnehmern, zu handeln, zu fühlen" vermöchte. Solche Verdinglichungen würden vom Patienten wegführen und tun dies auch bereits in vielen Diskussionen, und darin liegt der Schaden zuungunsten des Patienten. Hier kommt wieder die unsägliche Intellektualisierungstendenz der Psychoanalyse als Berufskrankheit zu ihrem Unrecht. Denn mit einem solchen Konzept ist weder der Analytiker noch sein Patient aktiv, sondern nur der „intermediäre Raum". So werden auch Schuld- und Schamgefühle einfach unter den Teppich gekehrt statt näher auf ihren Ursprung und auf deren Abwehr analysiert.
Eine solche Reifizierung bringt die Gefahr mit sich, sich vorsorglich, schon vom Konzept her, aus der Verantwortung zu stehlen.
Sprachanalytisch handelt es sich um eine oft gedankenlose Neigung zu inhaltslosen Substantivierungen, die einfach „drauflosverwendet" (Ernst Tugendhat) werden, und die sich dann mit anderen Begriffen verzahnen lassen und nicht mehr zu beseitigen sind. Mit den so entstandenen Begriffen wird herumgespielt, als ob es sich hierbei um eigene Wesen handelte. Die Begriffe haben sich, wie gesagt, verselbständigt.
Auch Soziologie kann für Psychoanalyse nicht zuständig sein. Schon grundsätzlich bleibt dem Soziologen die Privatsphäre (erst recht die inneren Konflikte), um die es der Psychoanalyse geht, verborgen. Dies allein führt bereits zu grotesken Einseitigkeiten, so z.B. zu einfältigen Begriffen von „Unterprivilegierung", unter der man nur äußere Faktoren wie finanzielle Ausstattung, berufliche Benachteiligung, Benachteiligung der Arbeit von Frauen usf. verstehen will. Für die inneren Konflikte und Nöte hat die Soziologie kein Ohr, z.B. nicht für die folgenreiche Benachteiligung der Kinder reicher, arrivierter oder gar berühmter Eltern i.S. einer schweren emotionalen Benachteiligung, die lebenslang nachwirkt und nicht mehr aufholbar ist. Nur zu oft werden Frauen nur als Opfer ihrer sozialen Situation gesehen und nicht auch als Täter, die am Antifeminismus kräftig mitwirken, so als Schwiegermütter und Mütter, die ihre Töchter einsperren, oder als Ehefrauen, die, sich auf Emanzipation berufend, bedenkenlos ihre Familie zerstören oder abtreiben, wenn ihnen danach zumute ist.
Auch ist nicht einzusehen, weshalb sich ein Analytiker bei seinen Behandlungen z.B. um die „doppelte Kontingenz", um Handlungsanalyse und Anweisungen, wie sich der Patient nun besser in die Gesellschaft einbringen kann, kümmern sollte. Nur seine inneren Hindernisse sollten beseitigt werden (Freud).
Mit der Behandlung der inneren Konflikte ist genug getan. Dann soll der Patient sehen, wie er zurechtkommt. Wir sind nicht seine Mutter, die ihn an die Hand nehmen soll, und wir sind nicht Gesellschaftsveränderer. Umgekehrt haben politische Bewegungen immer wieder versucht, die Psychoanalyse für sich einzuspannen (s. Freud- Ossipow, Krill 2010).
Das Verlockende außeranalytischer Disziplinen liegt darin, Psychoanalyse aus der Distanz zu betrachten, indem man sich aus der Kommunikation mit dem Patienten ausklinkt, oder noch besser, sich gar nicht auf einen solchen Kontakt einlässt. Die klugen Herrschaften haben zum Teil noch nie einen Patienten gesehen. Sie wollen und können nicht psychoanalytisch arbeiten, sondern über Psychoanalyse schreiben und sprechen. Sie fühlen sich nur zu oft als die wahrhaft Überlegenen. Es sind die Feudalherren von heute, welche die konkreten Aufgaben vermeiden, die vom Fußvolk in mühsamer Fronarbeit gelöst werden müssen. Sie vermeiden auch den direkten Kontakt mit Patienten.
Und was sie von Psychoanalyse aufgenommen haben, reicht in aller Regel nicht über das frühe topographische Modell Freuds mit seiner Sehnsucht nach dem „Unbewussten" und dessen romantischer Verklärung hinaus. Auf empirische Triftigkeit legen sie keinen Wert, deren Leser ebenfalls nicht, sie vermeiden diese.
Sie verbürgen sich mit ihrer Berühmtheit für die Richtigkeit ihrer Aussagen über Psychoanalyse, sind aber nicht einmal in der Lage, ihre Thesen anhand einer Einzelfalldarstellung zu legen oder wenigstens zu demonstrieren.
Viele Analytiker haben einfach kein Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Patienten, und sie wollen auch kein Vertrauen haben, denn sie wollen sie klein halten, als Patienten und sich entsprechend großartig, als ewige Eltern darstellen und sich in dieser Rolle vergnügen, die Patienten als angeblich regressiv- neurotisch, was sie nicht sind, sehen und darin festhalten. Der Analytiker kann größtes Vertrauen in die Fähigkeiten der Patienten haben, in sich selbst hineinzusehen, dann sich selbst zurechtzufinden, wenn der innere Konflikt gelöst oder gemildert ist. Der Analytiker hat keine Elternfunktion, er ist nur ein Handwerker (GRAY, craftsman). Er will auch nicht so furchtbar verständnisvoll und lieb sein, sondern will ihn nur darauf hinweisen, dass er selbst in sich hineinsehen kann. Nur was der Patient (wie auch in gewisser Hinsicht der Analytiker) selbst entdeckt und selbst fühlt, ist von Wert. Was Du ererbst, erwirb es neu, heißt es nicht umsonst.
Zum Vergleich: Kommentare zu einem Film, etwa über fremde Länder, hindern den Betrachter, die Einzelheiten im Film selbst zu beobachten und sich selbst seine Gedanken zu machen. Dann fühlt er sich fast so, als ob er selbst auf der Reise sei, -auf der er ja auch ohne Kommentar auskommen müsste. Der Kommentator verhindert nur das Eigenerleben.
Wenn ich ihm etwas von seinen Wünschen, Ängsten usw. deute, - denn dann nickt er das womöglich gehorsam ab (Compliance), aber dies ist ohne jeden Wert, weil er es nicht selbst erworben hat. Damit unterscheidet sich Verf. vom heutigen Umgang der Analytiker mit Patienten.
Viele Analytiker wollen dem Patienten ständig vorkauen, was er früher oder jetzt erlebt, empfunden, gedacht hat. Darauf sollte er nach dem Konzept der Abwehranalyse selbst kommen. Stattdessen will man den Patienten klein halten, zu einem angeblichen Kind machen, zu dem er regrediert (veraltetes Regressionskonzept, s. Renik1999a, Schlierf 1998, Krill 2008) sein soll, um dann umständlich über seine „Übertragungsneurose" und unter Beachtung der Gegenübertragung (wenn man diese denn wüsste), also eine künstliche Erkrankung, seine angeblichen oder tatsächlichen frühkindlichen und kindlichen inneren Konflikte wie einen alten Pullover „aufarbeiten" zu können.
Bereits von juvenilen, geschweige denn erwachsenen Konflikten ist weit weniger die Rede, obwohl die akuten Neurosen („Störungen") gerade um diese kreisen und von diesen ausgelöst werden.
Man wünscht einen hilflosen, infantilen Patienten, damit man sich als Therapeut, als Klinik, in der Position des überlegenen, erwachsenen Helfers mit einer gewaltigen Ausbildung im Rücken sehen kann. Einen erwachsenen Patienten kann man dazu nicht gebrauchen.
Und wenn der Patient glaubt, und er glaubt es so gut wie immer, dass es ihm vermehrte Zuwendung einbringt, macht er dieses üble Spiel kollusiv nur zu gerne mit. Er nimmt hier die Vorteile der taktischen, vorgespielten und geforderten Unreife wahr. Draußen aber soll er sich gleichzeitig als Erwachsener verhalten.
Hingegen ist der Patient wieder deutlicher im Spiel im Konzept des „Implicit relational knowing and moments of meeting" (Boston Change Process Study Group 2010). Die dazugehörigen Fallbeschreibungen sind aber äußerst dürftig, so in Bodansky 2014, 191- 203), der sich auf diese Art von Therapie beruft, und zeigen nur unspezifische Aspekte, wie sie in jeder längeren therapeutischen Zuwendung (hier mit Unterbrechungen 16 Jahre) zu erwarten sind. So werden als „Erfolge" dieser überlangen Therapie erwähnt: Die Patientin konnte länger und zusammenhängender sprechen, sie beteiligte sich an Angelegenheiten einer Walldorfschule, hielt dort einmal einen kleinen Vortrag (S.200), sie fand Arbeit als Kellnerin in einem Café, sie und ihr Therapeut hatten sich gut kennengelernt, der Ehemann ging in Psychotherapie, das Ehepaar konnte besser miteinander umgehen, sie zogen aus dem Haus ihres Schwiegervaters aus und zogen in die Nähe der Waldorfschule ( S.202). (Hier wird, wie so oft, fälschlich die Trennung von Verwandten als Erfolg gefeiert, und sei es nur eine räumliche).
Ebenfalls ist dort, wie auch woanders häufig, das Konzept der Verbalisierung überzogen, der Wert der Verbalisierung übertrieben. Der Therapeut hat hier nur das, was die Patientin äußerte, mit leicht veränderten Worten wiederholt und so ein besonderes Verständnis suggeriert.
All diese Konzeptionen ermöglichen aber und führen auch in der Praxis zwangsläufig dazu, aggressive Wünsche und Ängste in der Übertragung und Gegenübertragung nicht zu analysieren, sondern deren Analyse zu vermeiden, und zwar auf beiden Seiten, in stillschweigendem beiderseitigen Einverständnis. Die Kollusion, die Einigkeit zwischen Patient und Analytiker, Aggressives nicht aufzugreifen, ist dann unvermeidbar, und dies ist immer ein schwerer Schaden.
Denn im heutigen Erwachsenenleben haben Aggressionskonflikte die sog. oder tatsächlichen sexuellen Konflikte längst abgelöst, - wenn es denn jemals anders war. Nicht zufällig hat auch Freud lange Zeit gebraucht, den aggressiven Regungen einen gleichen und unabhängigen Wert zuzuerkennen. Dass Aggression und Sexualität vom analytischen Verständnis her nicht voneinander zu trennen seien, ist nichts als eine intellektualisierende Ausrede (Abwehr durch Intellektualisierung) im Dienste der beiderseitigen Bequemlichkeit. Freud hatte diese Bequemlichkeit überwunden, heutige Analytiker sind darin ihm gegenüber oft zurückgefallen.
Aggressionskonflikte sind zudem noch weit hartnäckiger als sexuelle oder „libidinöse". Ein Grund dafür ist die schwierigere Durchschaubarkeit, sowohl für den Analytiker als auch für den Patienten selbst, - weil die eigene Stellung dazu nicht einfach zu erkennen ist und weil diese Stellung auch wenig aussagt über tatsächliche Motive und über das Ausmaß der Aggressivität. Es kann nämlich sein, wie in einem Fall von mir beobachtet, dass der Patient nur ungern aggressiv ist, etwa, weil er sich dazu verpflichtet fühlt, um seinem Vater zu zeigen, dass er ein „Mann ist". Hier entwickelt er keine Abwehr, weil er sich in den Dienst seines Vaters gestellt hat, ihm somit nur gehorchen will, allerdings auch das Lob von ihm sucht, also noch ein kleines eigennütziges Motiv hat. Die Aggression selbst will er aber „eigentlich" nicht, und weil er ungern aggressiv ist, er erkennt diese auch nicht als böse oder boshaft („gern getan" vs. „ungern getan", zit. n. Hannah Arendt über Eichmann, 1964, Interview, - der „ungern", nur weil er „funktionieren und so in einer Gemeinschaft sein wollte", seine Verbrechen vollzogen und sich deshalb für schuldlos gehalten habe).
Der Patient würde – wie Eichmann- seine Handlungen nur dann als boshaft fühlen und erkennen, wenn er sie gern vollziehen würde. Dann würden – jedenfalls im Patienten - auch seine Ängste, Schuld- und Schamgefühle stärker sein und er würde Abwehren gegen diese entwickeln.
Ein schwaches Analogon bei der Sexualität gibt es allerdings auch, etwa in langdauernden Ehen („eheliche Pflichten"), er fühlt und erkennt hier aber immerhin einen Rest von Lustvollem, wenn es zum Vollzug kommt.
Gegenüber der – komplizierten - Aggressivität ist das „Sexuelle" einfach gestrickt. Die Menschen wünschen es, und damit basta, die Motive sind also eindeutig, ungeachtet der Tatsache, dass sich auch Sexualität instrumentalisieren lässt, um andere Ziele zu erreichen, und dann gibt es höchstens, wenn überhaupt, noch Ängste, Schuld- und Schamgefühle und die verschiedenen Objekte, die in Frage kommen, sowie die Abwehren gegen diese misslichen Gefühle. Aber der Wunsch danach ist immer gegeben. Abneigung gegen Sexualität, die ebenfalls vorkommt, wird als Abwehr (Vermeidung, Verneinung, Wendung gegen die eigene Person) gegen den doch vorhandenen sexuellen Wunsch verstanden.
„.....eine tiefere traumähnliche Ebene von Zeitlosigkeit, eine innere Realität". „Zeitlosigkeit"? Eine typisch analytische Floskel in üblem Sinne, eine erneute Intellektualisierung. „Zeitlosigkeit", auch wenn sie anders, nämlich philosophisch, gemeint ist, und dort vielleicht richtig verwendet, ist das Letzte, was wir uns leisten können. Die – angeblich- „unendliche Analyse" lässt grüßen.
Anschaulicher ist aber ein seltsamer, wohl verzweifelter, wütender Ausspruch eines Patienten, der mehr als 1000 Stunden (nicht mein Patient) ohne fassbare klinische Besserung absolviert hatte: „In der Zeit wäre ich besser ein Alien geworden Ich hätte in der Zeit glatt ein Alien werden können, mit Zertifikat, qualifiziert, zertifiziert, randomisiert und mumifiziert bis dorthinaus." „Was kümmert mich mein Lebenslauf, ich höre ohnehin nie auf", sagte ein anderer Patient (ebenfalls nicht meiner) resigniert. Aber was ein rechter Theoretiker ist, muss er sich als erhaben über Raum und Zeit sehen, gottgleich. „Zeitlosigkeit" als philosophisches Wort mag hingehen, aber als Programm auf dem Rücken der Patienten? Nichts in ihm ist zeitlos, oder sollen etwa die innerseelischen Abläufe nicht aufeinander folgen dürfen? Was läuft oder verläuft, braucht Zeit. Philosophie und viel Gehirnschmalz, Intellektualisierung zu nennen, zur Abwehr der konkreten Mühe, Konflikte zu lösen, werden hier als Ausflucht (elusion, evasion, otgoworka) vor unseren Aufgaben gebraucht und missbraucht. Glasperlenspiele.
Die o.g. Konzepte werden hier womöglich ernster genommen und mehr gewürdigt als von manchen nur nachbetenden Vertretern und Durchlauferhitzern ohne Selbstkritik.
Die Forderung nach Beendigung einer Analyse kommt oft von außen, vom Leistungsträger, der weitere Stunden nicht mehr bezahlen will. Somit entspringt sie nicht inneranalytischen Gründen. Es gibt auch Patienten, die eine Analyse überhaupt nicht beenden möchten und sie dann selbst bezahlen. Dies wird von manchen Analytikern heftig kritisiert.
Das „Argument" ist gewöhnlich, eine Analyse, die kein Ende vorsehe, sei „keine Analyse" oder „keine strukturierte Analyse", da die auch äußere Trennung ein immanenter Teil der Analyse sei, - eine völlig willkürliche Behauptung.
Der Satz: „Das ist keine Analyse" ist schon in anderen Zusammenhängen oft gefallen, und man hat ihn schließlich wieder zurücknehmen müssen. Richtig hätte er von Anfang lauten müssen: „Das ist nicht meine Analyse", - dies hätte die Diskussion vereinfacht. Es war ein rein emotionaler Satz, man wollte eine solche Analyse einfach nicht, man musste sie disqualifizieren, um sich nicht mit dieser anderen Art auseinandersetzen zu müssen.
Im Übrigen wird auch hier übersehen, dass so ebenfalls von außen die Zeitgrenze für die Analyse gesetzt wird, nämlich vom Analytiker, der sein Konzept von Beendigung verfolgt und durchsetzt, und nicht, wie es sein sollte, aus inneranalytischen Gründen, die im Patienten und im analytischen Prozess selbst liegen („prozessorientiert").
Letztlich dürfte der Patient darüber entscheiden dürfen, ob und wann er die Analyse beenden möchte. Der Patient war es, der zu uns gekommen ist. Wir sind weder sein Vormund noch können wir wirklich immer beurteilen, warum er uns noch benötigt. Es ist anmaßend, sich bedenklich der sprichwörtlichen Arroganz der Psychoanalyse annähernd, dies beurteilen zu können oder auch nur zu sollen.
Selbst wenn er uns nur noch als Halt benötigt, wäre dies ebenfalls kein Einwand, die Analyse weiterzuführen, d.h. evtl. auch bis zur beeinträchtigenden Krankheit des Analytikers, solange dies dem Patienten sichtlich nutzt und es dabei keinen Schaden an Lebensqualität, an der Erfüllung seiner Aufgaben, insbesondere denen seiner Familie, oder an seinen Finanzen anrichtet.
Mit Beendigungen ist der Patient ohnehin im Alltagsleben genügend konfrontiert, so bei der Beendigung von Bekanntschaften, Freundschaften, intimen Beziehungen, Ehen, Auszug der Kinder, Entfremdung der Kinder, bei Entfremdung von Geschwistern im Laufe des Lebens, spätestens bei der Erbteilung, bei Heimatverlust, Verlust von kollegialen Beziehungen, Entlassungen, und nicht zu vergessen, nicht zu unterschätzen bei Verlust geliebter Haustiere.
Dass der Patient Trennung nur in der Analyse erlernen und aushalten könne, ist eine berufsimmanente (Berufsrisiko) Selbst- Überschätzung (Selbstidealisierung der Psychoanalyse). Ohne Psychoanalyse soll wohl nichts im Leben gehen.
Dies zeigt eher einen mangelnden Respekt vor den Alltagsanforderungen des Lebens selbst und vor der gewaltigen Leistungsfähigkeit unserer Patienten, sich weiterzuentwickeln, namentlich, selbst, wenn auch unter analytischer Voraussetzung, in ihr Innenleben mit deren Konflikten hineinzusehen, sobald ihre Abwehr angegangen worden ist.
Solche Sätze müssen natürlich allen Psychoanalytikern bitter aufstoßen, die sich mit Konzepten wie Regression, „Empathie" und etwa auch deren angeblichen erweiterten Auffassung und Neuformulierung, oft nur in der üblichen Anpassung, um nicht zu sagen, stillen Unterwerfung, an und unter ihr Institut, eingerichtet haben, -
insbesondere mit deren oft kollektiven Einstellung, die „richtige Analyse", namentlich die richtige „Empathie", für sich gepachtet zu haben, und es dabei bewenden lassen zu können.
Man glaubt dort oft, sogleich das Abgewehrte deuten und somit auf das frühe topographische Modell Freuds zurückfallen zu dürfen oder gar zu sollen, und sich nun aufgescheucht fühlen müssen, wenn nach der Abwehrlehre gearbeitet wird.
Dass andere Kollegen, die nicht so unter dem Einfluss ihres oder eines Institutes standen oder stehen, sich in anderer Weise und nicht weniger intensiv weiterentwickelt haben, kommt ihnen nicht in den Sinn, vielmehr wird erwartet, diese müssten „das Versäumte nachholen" (Den Betreffenden, wie früher üblich, wieder zurück in eine erneute Lehranalyse zu schicken und ihn so stellungsmäßig, im Ansehen, finanziell und zeitlich zu schädigen, zu bestrafen, hat man aufgegeben, - das war denn doch zuviel.).
Man hat sich eingerichtet in der „harmonischen Zusammenarbeit über viele Jahre hinweg". Dieser Seelenfrieden will nicht gestört werden.
Dies geht auch tief in die Rezeption von Literatur hinein. Die grundlegenden Arbeiten von Sampson & Weiss und Weiss, sowie des sehr bedeutenden US-amerikanischen Analytikers Paul Gray, der von ihm beklagte Rückfall auf das topographische Modell und die von ihm in langen Jahren konsequent geförderte Psychoanalyse nach der Abwehrtheorie scheinen weithin unbekannt geblieben oder in Vergessenheit geraten zu sein.
Das „Institut", oder die „Identität des Instituts" sieht sich gern als ein Art Gymnasium, das man evtl. nachzuholen hätte, da nirgendwo als dort der Fortschritt stattfinde.
Bequemlichkeit, aber vor allem der Neid auf das Können des Anderen hindert daran, sich mit anderen Auffassungen auseinanderzusetzen. Es ist leichter, diese zu disqualifizieren, etwa als zu „programmatisch", d.h. lediglich ein Programm verfolgend, das z.B. auf rasche Heilung abziele, - hier nebenbei wieder die heimliche, aber chronische antitherapeutische Neigung mancher überkommener analytischer Richtungen für sich nutzend.
Gern wird auch geurteilt, Abwehranalyse sei „hermetisch", d.h. sich gegen alle Einwände in unguter Weise immun gebend.
Gern wird auch Mangel an Empathie unterstellt, ein besonders bekanntes und viel benutztes Totschlagargument.
„Empathie" glaubt manches Institut für sich und seine Mitglieder gepachtet zu haben, und dies ist bis heute von nicht wenigen Psychoanalytikern unreflektiert als analytische Besonderheit oder gar Errungenschaft und recht oft als angeblicher Teil der „analytischen Identität" in Beschlag genommen worden, während es sich in Wirklichkeit um eine nahezu ubiquitäre Fähigkeit des Menschen handelt.
Niemand hat die Ausbildung zum Analytiker unternommen, um „Empathie" zu erlernen, noch ist er durch die Ausbildung Meister darin geworden.
Gern wird auch mit der Gegenübertragung von Teilnehmern und einer naiven Auffassung von „Spiegelphänomenen in der Gruppe" (oder „Truppe"?) argumentiert, ohne deren komplexes Zustandekommen zu würdigen:
Wünsche, in einer Gemeinschaft aufgehoben zu sein, Ängste, aus der Gemeinschaft heraus zu fallen und in Einsamkeit zu landen, Abwehren dieser Wünsche und Ängste durch Vermeidung selbständigen Handelns, Wendung gegen die eigene Person und Identifikation mit dem Aggressor (der Mehrheitsmeinung), Imitation, Anpassung, Unterwerfung, Scheinaufbegehren in Nebenpunkten, um die bloße Anpassung zu verdecken. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, alias Herdentrieb, ist überwältigend.
Beide Seiten haben gewiss auch respektable Gründe für ihre Haltungen, aber sie sollten diese nicht damit begründen, dass es den Kontrahenten an „Empathie" fehle oder diese überhaupt so etwas seien wie „Unteranalytiker", die den Anschluss verpasst hätten.
In Gutsherrenart soll es die Gegenübertragung richten. Dabei ist keine Bemühung erkennbar, diese von der eigenen Übertragung, etwa Neid und Angst vor Unterlegenheit sowie Wunsch nach Überlegenheit, zu unterscheiden. Wenn es gilt, den gewohnten Seelenfrieden zu erhalten, ist man um kein Argument verlegen. Notfalls greift man zu dem „Argument", der Andere sei uneinsichtig, und, im Umkehrschluss und im Zirkelschluss, deshalb könne auch seine Analyse nichts taugen (gerne kopfschüttelnd: „Da sieht man es ja wieder, - das war nach allem zu erwarten, - es hat keinen Zweck".). Stilles Kopfschütteln ist nach Nichtbeachtung das Schlimmste, da verbal unwiderlegbar. Man darf dann aber fragen: „Was, bitte sehr, bedeutet Ihr Kopfschütteln? (Und etwas therapeutisch):"Warum fällt es Ihnen schwer, sich in Worte zu fassen?"
Auf die Idee eigener Blindheit und Voreingenommenheit kommt man nicht. Der Andere stört. Nebenbei: Auch hier ist schwer zu erkennen, was die jahrelange Lehranalyse gebracht haben soll (s. auch unter Lehranalyse in diesem Buch, sowie in Krill 2008). Was ist aus den viel beschworenen „blinden Flecken" geworden? Sie behaupten sich. Es sind die gleichen wie vor der Lehranalyse, und sie sind so zäh als wie zuvor. Dies ist leicht und anschaulich beweisbar:
Der Neid unter Kollegen ist mit Händen zu greifen. Man gönnt sich nicht die Butter auf dem Brot. Wer liest oder kauft gar ein Buch eines Kollegen im gleichen Institut oder in der gleichen Klinik? Und Neid und seine Abwehr im horizontalen Modus der Konkurrenz sind noch nicht einmal tief verdrängt, sondern in der Regel nur notdürftig kaschiert und bewusstseinsnah, und trotzdem in der Lehranalyse nicht aufgelöst, wie ein Jeder selbst bei sich und seinen Kollegen beobachten kann.
Wesentliche Komponenten von derartigen Gruppenkonflikten bei Fallvorstellungen sind immer Wünsche (und deren Abwehr) nach Gehörtwerden, nach Rat und Hilfe, aber auch nach Geben, also nach einem lebendigen, für alle förderlichen Austausch. Ferner: Angst, nicht gehört oder mit seinem Votum abgelehnt zu werden.
Neid (Konkurrenzneid, Geschwisterneid) ist ubiquitär und auch hier unvermeidbar, sogar regelmäßig recht heftig, kann aber doch ertragen und schließlich nutzbar gemacht werden. Der Neid und dessen Abwehr sind ständige Begleiter schon durch das Alltagsleben, mit dem wir ja auch sonst fertig werden müssen.
In Instituten behalten Äußerungen vom Lehrkörper oder solcher, die dazu ausersehen sind, oft absolute Vorrangstellung, auch wenn sie erkennbar dürftigen Inhalts sind und z.B. nur die Enge und Unproduktivität des Instituts erkennen lassen. Bei der Schlussbesprechung werden nur diese erwähnt, nicht Voten von Anderen. Ziel ist Entmutigung Anderer und Förderung / Ermutigung der zukünftigen „Elite". Es ist unglaublich, mit welcher Dreistigkeit hier vorgegangen wird. Dass gewisse anders lautende Voten ergangen sind, wird sogar ausdrücklich bestritten. Antworten auf Fragen werden einfach nicht gegeben. Fragen werden vielmehr oft ignoriert, es erfolgt nicht einmal der normale Blickkontakt. Persönliche Kontakte außerhalb der Seminare und intensiver Blickaustausch („Fledermaus-Kontakte") sind nicht zu überhören bzw. zu übersehen, sie sind Verabredungen und Bündnisse, - während andere Blickkontakte, auch zur Begrüßung und zum Abschied, und auch einfache Antworten einfach unterbleiben (versteinerte, über viele Jahre ausgeübte, daher nicht mehr reflektierbare „Degradierungs-Zeremonien", Garfinkel) zum Niederhalten des sog. Mittelbaus, also um sehr erfahrene Analytiker. Dadurch fehlt der Anschluss in Form begabter Analytiker mit der Folge von Verarmung, Bürokratisierung und schließlichen Erlöschens.
Es handelt sich um schwere neurotische Charakterstörungen, heute Persönlichkeitsstörungen genannt, mit schwersten Kontaktbehinderungen in Form des Verlustes der Selbstverständlichkeit des alltäglichen Umgangs. Hier wird der normale, alltägliche Kontakt vermieden. Solches Fehlverhalten ist das Gegenteil von Abstinenz. nämlich ein massiver Eingriff in das Normalleben.
Abwehranalytisch ist zu fragen, wodurch die Abwehr durch Vermeidung ausgelöst wird. Es müssen Affekte von Angst sein, den Fragen (deshalb werden diese schon rein zeitlich nicht zugelassen) und Argumenten Anderer zu unterliegen, aber auch Angst, in einer Diskussion selbst aggressiv zu werden und sich selbst damit bloßzustellen.
Vor allem kommt ein nicht weiter zügelbarer, aggressiver Wunsch nach stiller Beherrschung und Erniedrigung des Anderen durch Verweigerung des normalen Kontakts in Frage. Hier werden „Neutralität und Abstinenz", die einst in der Ausbildung „erlernt" wurden, zur Karikatur hochgetrieben und zum Narzissmus mit Verstiegenheiten und als Waffe im Machtspiel gegen Andere missbraucht (Agieren, vorprädikative Kommunikation, leiblich -gestisch).
Die leiblichen Begleiterscheinungen dürften im Zukneifen des Mundes und Abwendung des Blickes bestehen (Krill, 2.Rezension des Buches „Die Leibliche Dimension", Scharff, J. 2010). Es ist bedauerlich, solche Fehlentwicklungen mit ansehen zu müssen. Schuld- und Schamgefühle sind hier nicht zu erkennen.
Charakterliche Schädigungen der Nachfolgegeneration durch Identifikation mit dem Aggressor zur Abwehr von Angst vor diesem, von dem die Kandidaten ja abhängig sind, sind möglich. Solche Schüler benötigen viel Zeit und Erfahrung, um schließlich doch noch gute Therapeuten zu werden.
An Abwehr herrschen Rationalisierung und – besonders unter Analytikern - Intellektualisierung vor. Weder der Neid noch dessen Abwehr sind anscheinend durch die Lehranalyse beseitigt worden..
Missglückter Umgang ist leicht zu erkennen, wenn der Schlagabtausch nicht mehr um die Sache erfolgt, sondern um Personen.
So gut wie immer sind auch Untergruppen („Klübchen", „kungeln") erkennbar, und zwar bereits bei der Begrüßung und wieder bei der Verabschiedung. Manche sind – ganz natürlich - durch auch privaten Umgang miteinander verbunden, aber manche versuchen darüberhinaus, Andere betont zu ignorieren, bis zur Vermeidung des Blickkontakts („keines Blickes würdigen"), - mindestens Geschwisterneid, aber es kann auch Angst sein vor dem Kontakt mit einem gefürchteten Konkurrenten, den man so schlicht zu verleugnen („auszublenden") versucht.
Dies darf nicht dazu führen, dass man sich vom Patienten und speziell der Stunde entfernt, um die es geht. Es geht letztlich immer nur um den Patienten und das, was sich zwischen ihm und dem Therapeuten abspielt, nicht um uns und unsere kleinlichen Animositäten und Eitelkeiten.
Es ist auch nur zu natürlich, dass z. T. intensiv und nachträglich miteinander telefoniert wird, um Zuneigungen und Abneigungen auszutauschen und den Zusammenhalt der Untergruppen zu sichern und zu verstärken, - ohne dass dies in der Gruppe zur Sprache kommen soll oder kann. Auch hier herrscht einfach der Alltag. Warum sollte es anders sein. Es ist nur gut für die Orientierung, dies zu wissen und zu fühlen. So sind eben Menschen, und unter Analytikern ist es nicht anders, nicht besser, als in anderen Vereinen.
Auch kommt es vor, dass plötzlich die Regeln geändert werden. Dies kann durchaus sachlich begründet sein, es kann aber auch anscheinend der Wunsch zugrundeliegen, unerwünschte Teilnehmer zu entmutigen, sie gleichsam abzuschütteln, in der Hoffnung, dass sie sich nicht umstellen können oder wollen. Nicht immer fällt die Unterscheidung leicht, oder es liegt – wohl meistens - beides vor, also persönliche Animosität und Abwehr, und zwar neben der allgegenwärtigen Abwehr durch Vermeidung (eines normalen Kontakts) besonders die psychoanalytikertypischen Abwehren durch Rationalisierung und Intellektualisierung zur Verdeckung der weniger guten Absicht.
Ist die Gruppe genügend groß, finden sich auch zuweilen Fürsprecher, wenn allzu ablehnend vorgegangen wurde.
In jeder psychoanalytischen Gruppe finden sich Teilnehmer, die über ein besonderes Fachwissen für gewisse Lebensumstände verfügen, so z.B. über alles, was mit künstlicher Befruchtung, Kinderlosigkeit, Migration, Adoption zu tun hat (über das Adoptivkind, die Adoptiveltern und deren inneren Motive, die Geschwister und Verwandten). Dies ist eine Bereicherung an bloßen Kenntnissen über Punkte des Gesellschaftslebens. Die Gefahr besteht aber darin, dass sich ein Fachseminar über ein solches Thema entwickelt, dass vom Patienten wegführt und das überdies immer ideologieanfällig ist, und sich dann umso mehr vom Innenleben des Patienten entfernt.
Auch hierfür ist der Grund anzunehmen, dass viele Analytiker nichts so fürchten, wie sich im Hier und Jetzt mit dem individuellen, jetzigen Innenleben, den inneren Konflikten und dem jetzigen Umgang von Patient und Analytiker zu befassen, und sich davon nur zu gern ablenken lassen, und dass es immer wieder neuer Anstrengungen bedarf, bei dieser Aufgabe zu bleiben und sich durch noch so Interessantes nicht davon abbringen zu lassen. Die analytische Aufgabe muss immer wieder von neuem angegangen werden, wir kriegen nichts geschenkt und „haben niemals Ruhe" (Krill 2008).
Das Mitgehen mit der Stunde kann gar nicht eng genug sein. Insbesondere ist auf Kollusion in der Abwehr zu achten, z.B. besonders häufig beiderseitige Vermeidung von aggressiven Regungen, etwa in Form fleißigen, empathischen (tatsächlichem oder vermeintlichem) Kommentierens und Bejahung dieser Kommentare durch den Patienten, Hier handelt es sich um den spezifisch psychoanalytischen Gesichtspunkt. Nur hierdurch unterscheidet sich Psychoanalyse von anderen psychotherapeutischen Verfahren. Bei diesen sind Übertragungs- und Gegenübertragungsvorgänge ebenfalls ganz unvermeidbar, sie stehen aber nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und der Bearbeitung. Abwehr des Patienten allein reicht nicht, sie steht vielmehr auch bei der VT sehr oft im Mittelpunkt, diese hat wohl hierbei gute Erfolge.
Andererseits darf man sich vom erwähnten spezifisch analytischen Gesichtspunkt auch nicht alles erhoffen. Von diesem allein ist noch kein Patient gesund geworden, entgegen häufigen idealisierenden, großspurigen Erwartungen und Behauptungen.
Erfahrene Psychoanalytiker wissen, dass es keine alleinselig machenden Gesichtspunkte geben kann und dass der o.a. streng analytische Gesichtpunkt zwar zum Wesen der Psychoanalyse gehört, aber sein Alleinstellungsmerkmal vor allem didaktisch in der Ausbildung, innehat. Wenn und solange ein Ausbildungskandidat nicht an diesen Punkt kommt, wird er zu Recht nicht aufgenommen (DPV), ungeachtet, dass er auf andere Weise erfolgreich psychotherapeutisch arbeiten mag.
Andere Faktoren, die sich kaum abschätzen lassen, wie Suggestion, Identifikation mit dem Analytiker, empfundene Unterstützung im Alltagsleben allein schon dadurch, dass der Patient einen zuverlässigen Anlaufpartner hat, wirken immer mit oder wirken mehr.
Auch sind viele Patienten gar nicht in der Lage, derart eng mit dem Analytiker zusammenzuarbeiten. Auch darf über lauter Übertragung und Gegenübertragung nicht vergessen werden, was das Ziel einer jeden Therapie zu sein hat: Das Innenleben des Patienten mit seinen Konflikten und Abwehren muss unter die Lupe kommen und bearbeitet werden, und seine symptombildenden inneren Konflikte müssen gelöst werden. Es muss also im Inneren des Patienten zu einer Änderung kommen. Dann erst kann eine Auflösung der Symptomatik, der Beschwerden, erfolgen.
Die Beachtung der Prozesse zwischen Patient und Analytiker ist, abgesehen von der ständigen Schwierigkeit, diese zuverlässig zu erfassen, nur ein Mittel dazu, kein Selbstzweck. Übertragung und Gegenübertragung zu erkennen und zu verhandeln, muss in der Ausbildung zwar geübt werden, reicht aber nicht, reicht nur zur Prüfung.
Insgesamt zeigt sich vorwiegend ein compliancehaftes, freiwillig gleichgeschaltetes Gruppenverhalten mit viel Imitation und gegenseitiger Suggestion und entsprechend viel Kopfnicken, wenn auch jetzt unter deutlich weniger Berufung auf angebliche „Spiegelphänomene", um die es neuerdings wieder recht still geworden ist, weil man doch auf die Komplexität von Gruppenphänomenen gekommen ist (s. Krill 2008, 277 ff, „Gruppendiskussionen", „schlammige Situation").
Das Ausmaß der Gleichschaltung und die mangelnde Reflektion darüber liegen jenseits aller vernünftigen Erwartung. Das muss nicht schlecht sein, aber es ist auch nicht gut. Das „Wir sind uns doch einig" entfaltet eine große Macht, und ohne die Zustimmung der großen Mehrheit wären die Voten ohne jeden Einfluss. Man kann es immer wieder beobachten: Ein Einzelvotum geht immer unter, man kommt auch nicht mehr auf dieses zurück, gleichgültig, wie gut, wie treffend, wie tiefsinnig es war. Es ist interessant und ernüchternd zugleich, zu sehen, dass es in diesem Punkt unter den heutigen tatsächlich demokratischen Regeln „freiwillig", ohne äußeren Druck, so zugeht. Der Grund: So sind eben Menschen, mit oder ohne äußeren Druck. Die Gemeinschaft und das Gefühl von Gemeinschaft beherrschen alles. „Etwas Gutes zu tun" ist oft gleichbedeutend mit „Etwas mit Anderen zugleich tun".
Gruppen- Falldiskussionen von Psychoanalytikern unterliegen den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie andere Gruppensitzungen auch, und wer anderes erwartet hat, kann sich fragen, warum er solches für möglich hielt, statt seinen eigenen Beobachtungen und Überlegungen in analogen Situationen zu trauen.
Um den Umgang von Patient und Analytiker geht es (oder sollte es gehen!) auch in den Zwischenprüfungen und im Abschlusskolloqium der Ausbildungs- Kandidaten.
Hier lauern nicht weniger als in sonstigen Fall-Gruppendiskussionen (s.o.) die Gefahren der gemeinsamen Abwehr.
Als chronisches Phänomen ist kollusive Ablenkung von der Stunde, um die es geht, durch unverhältnismäßige Verbeugung unter die Biographie oder das, was man dafür hält, unter den Konsens des Vereins (z. B. handelt es sich in 2015 fast nur noch um „frühe Störungen"), sodass für den Vortrag der Stunde und der Diskussion darüber nur wenig Zeit bleibt, unter die Verehrung von bekannten Analytikern, deren Stimme ein besonderes Gewicht erhält, unter den sich rasch ausbildenden Gruppenkonsens, gegen den kaum noch zu argumentieren Gelegenheit ist. Man hat sich schon längst, bevor der Ausbildungskandidat auch nur den Mund aufgemacht hat, auf„frühe Störung" geeinigt.
Der Gruppenkonsens besteht nämlich fast immer in dieser, und der Standardvorwurf, falls jemand anderer Meinung ist, liegt schon bereit: Da habe er nicht gründlich genug gearbeitet, sei nicht in die „Tiefe „gegangen, - s. hierzu das unbedachte, von Ehrgeiz getriebene „race back", das Shapiro bereits 1981 gründlich kritisiert hatte, das sich aber bis heute in fast allen Seminaren, Kongressen, Vorträgen als falsches Muster gehalten hat.
Da es sich um „Tiefen"- Psychologie handelt, ist der Kandidat gegen dieses übliche Argument wehrlos. Er kann nie beweisen oder glaubhaft machen, dass eine wesentliche präödipale Beeinträchtigung nicht eingetreten sei. Man kann mit diesem Totschlagargument immer behaupten, der Vortragende habe die „tiefe" Störung nicht gesehen.
Mit der „frühen Störung" kann man sich immer auf der „richtigen" Seite wähnen, und man kann immer wieder in Gruppendiskussionen sehen, dass sich alle zugleich in gemeinsamen Einseitigkeiten wohlfühlen.
Einzig auffällige Aussparungsstellen (Verf. hier), die auf einen ödipalen Konflikt hinweisen, können einen Anhaltspunkt bieten, hier in den Diskurs einzugreifen. Aber auch hier sind sofort Argumente zur Hand, diese als Abwehr oder als bloße Fassade abzuwerten. Es sei daran erinnert, dass überall, wo totale Verneinung ausgeübt wird, sich das Totgesagte erst recht noch meldet.
Niemandem wird vorgehalten, er habe den ödipalen Konflikt übersehen. Er kann sofort argumentieren, dafür sei noch Zeit, oder, was so aussehe wie ödipal, sei nur der Schein, und dahinter oder darunter „verborgen" liege die „eigentliche, die präödipale „Störung".
Das Umgekehrte, nämlich die Argumentation, das Ödipale sei hinter präödipalem Getöse (gerne „Trauma") verborgen. ich in den Veranstaltungen noch nie vernommen. Die Stunde selbst zeigt oft etwas anderes, aber dieses wird dann gern untergebügelt.
Die Grundfehler liegen in dem Beharrungsvermögen einer Konsensgesellschaft und in der Verwechslung von „Tiefe" mit „Frühe" (Krill 2008). Auch das „Späte" in der Entwicklung kann abgewehrt sein, denken wir nur an die notorisch vernachlässigten Konflikte der Pubertät und der juvenilen Zeit.
Die Beliebtheit der „frühen" Störung resultiert nicht nur aus diesem Umstand, sondern auch aus einer unprofessionellen Übertragungshaltung vieler Analytiker: Sie fühlen sich zum Helfen motiviert, aber dazu brauchen sie einen infantilen Patienten, einen erwachsenen können sie dazu nicht gebrauchen oder glauben dies zumindest. So kommt es dann- fast chronisch – dazu, dass Erwachsenen-Sexualität und Erwachsenen –Aggressivität (besonders diese nicht) nicht bearbeitet werden. Dies wird dann aber nicht selten dem Vortragenden doch vorgehalten.
Der Prüfungskandidat ist nicht zu beneiden. Er ist dem Druck ausgesetzt, eine „frühe" Störung zu diagnostizieren, zu behandeln und die Behandlung in diesem Konzept zu beschreiben. – weil sein Institut – wie auch oft sein Supervisor mit der „frühen Störung" en vogue ist.
Immerhin lässt sich überprüfen, ob er nach seinem eigenen Konzept gearbeitet hat. Man kann ihn formal sozusagen an seinen eigenen Maßstäben messen. Die Sache ist in Wirklichkeit komplizierter. Denn sind es seine eigenen Maßstäbe?
Er steckt dazu noch in anderen Zwickmühlen:
Sein Supervisor wünscht ein bestimmtes Konzept, dem der Prüfling schon während der gesamten Behandlung nachzukommen hatte. Glück hatte der Prüfling, wenn er von sich aus ebenfalls dieses Konzept vertrat oder vertreten hätte, aber dies weiß er in den seltensten Fällen.
Er steht unter erheblichem Angstdruck, hängt doch viel von der Prüfung ab, oft auch sein berufliches, finanzielles und familiäres Fortkommen.
Dem Konsens der Zuhörer wird er nicht widersprechen wollen, und sein Auftreten ist überwiegend defensiv und vorsichtig.
Im Abschlussexamen wird kein Wissen abgefragt, sondern nach einer Grundhaltung gesehen. Die relative Unerfahrenheit mit Behandlungen und dem Prüfungsprocedere sowie die Angstsituation mit der durch diese gegebene relative Unbeweglichkeit selbst werden dabei berücksichtigt.
Im Übrigen kommen auch derart viele, vom o.a. substanziell analytischen Gesichtpunkt grob wegführende Kommentare zur Biographie, zu einzelnen Worten bis zu Wortklaubereien, dass der Kandidat nur anfangs diese innerlich aufzunehmen vermag, - zumal er ja auch etwas zu diesen sagen muss. Daher ist ihm nach kurzer Zeit nur noch beflissenes Schein- „Aufnehmen" der Kommentare möglich. Über weiteren inneren Raum in der Prüfungsituation verfügt er nicht.
Nicht auszurotten sind die ewigen Fragen zur Biographie und das Spekulieren darüber, was diese bzw. das übliche parent blaming (am beliebtesten: Mutter uneinfühlsam, Vater glich diesen Mangel nicht aus) bedeutet, und es wird unaufhörlich nach angeblichen Regressionen gesucht, und diese werden mit Triumph empor gehalten, wie wenn man nun „des Pudels Kern" gefunden hätte. Die Kindheit! Die Kindheit! Und erst recht die frühe Kindheit!
Man will erklären, intellektualisieren, aber bloß nicht auf die Stunde hinsehen, obwohl das einzig Wesentliche den Zuhörern dort auf dem Tablett angeboten wird. Nur keine Ablenkung davon vermeiden, ist immer noch das Motto.
Dies erinnert sehr an die Betrachtung von Kunstwerken. Was wird nicht alles an Biographie bemüht, um das Kunstwerk „zu erklären". Bloß in Ruhe und unvoreingenommen es betrachten und es auf sich wirken lassen wollen die wenigsten.
Als entscheidend wird bei der Prüfung gesehen, ob der Kandidat einigermaßen das reflektiert hat oder wenigstens voraussichtlich reflektieren wird, was zwischen Ihm und dem Patienten abläuft, insbesondere welche Abwehrformen in der Stunde auf beiden Seiten wirksam sind, vor allem, ob er wenigstens für diesen Gesichtspunkt aufgeschlossen ist.
„Trennung":
Gern wird argumentiert, dass Trennung zu einer normalen Entwicklung gehört und ein wichtiges Lebensziel sei.
Gerade dies wird nun auch seit Jahren schon von analytischer Seite mit guten Argumenten (Lit. beim. Verf.) bestritten, auch unter Hinweis auf die bloße Tradition seit M. Mahler mit deren Loslösungs- und Annäherungsthesen, die sie zudem – zur suggestiven Glaubhaftmachung - noch glaubte, in feinste Einzelschritte unterteilen zu müssen, als ob sie seinerzeit beim Säugling dabei gewesen wäre.
Es mehren sich die Stimmen, die Eigenentwicklung von Trennung unterscheiden. Trennung sei kein Entwicklungsziel, nur die Eigenentwicklung, und zur Trennung oder zu Anstrengungen, getrennt zu sein, etwa von den Eltern oder Geschwistern, bestehe kein Anlass, und tatsächlich halten bekanntlich Familienbande am längsten.
So müssen sich keineswegs Geschwister voneinander und Kinder von ihren Eltern und Eltern von ihren Kindern trennen, um ein gesunde Entwicklung mit Selbstständigkeit, etwa auch im Beruf und in der Familiengründung, zu nehmen, und Andere, die solche Kontakte eingestellt haben, deshalb selbständiger, erfolgreicher oder psychisch gesünder sein.
Es ist auch zu bedenken, dass der Forderung nach Beendigung der Analyse nicht selten die eigene Angst des Analytikers zugrundeliegen mag, einen anderen Menschen, der einem so ans Herz gewachsen ist wie jeder analytische Langzeitpatient, nicht loszuwerden, - also im Sinne einer Claustrophobie, einer Angst vor Bindung, und einem Ordnungssinn zwangshafter Strukturen folgend, die eine Beendigung für ihr eigenes Innenleben, speziell ihres Ordnungssinns und ihrer Angst vor einem Dauerkontakt, benötigen, um innere Ruhe zu finden. Es gibt andere Analytiker, die damit keine Schwierigkeit haben.
Auch Bindungen an überkommene Lehrmeinungen, von denen die analytische Literatur voll ist und die seit Jahrzehnten gedankenlos weitergetragen werden, ohne dass es zu einer eigenen Untersuchung und Beurteilung gekommen ist noch diese angestrebt werden, kommen hier durchaus in Frage (unreflektierte Traditions- und Zitatgläubigkeit wie immer wieder in der Psychoanalyse).
Nur zu oft führen solche verfestigten Auffassungen, die wenig aufgefrischt werden und es so unbedacht zu Meinungsverfestigungen kommen lassen, zu einer Art „Analyse nach Notenständern" (Verf. hier), als ob die Analyse nach vorgefertigten Notenblättern, mit einem festen Schema, verlaufen könne. So primitiv arbeiten aber Gehirn und Psyche gewiss nicht.
Auf keinen Fall kann der Analytiker für eine von ihm forcierte oder gar aufgezwungene Beendigung zuständig sein. Denn der Patient ist keineswegs gekommen, um sich von seinem Analytiker zu trennen / die Analyse zu beenden, wie auch umgekehrt nicht, um sich an ihn zu binden, ihn als Menschen besonders hoch zu schätzen oder gar eine private Freundschaft mit ihm einzugehen oder diesem etwas Gutes zu tun, auch nicht, um ihn zu hassen oder sich von ihm abzuwenden oder schlecht über diesen zu sprechen, sondern einzig, um seine inneren Konflikte zu bessern, wenn auch Anderes unterläuft. Aber dieses „Andere" kann nicht ein Programm sein.
Kein Analytiker kann sich das Recht herausnehmen, seine eigenen Interessen, etwa seine – bewusste oder auch unbewusste - Angst vor einer nicht endenden Beziehung, also aus Angst vor einer Bindung (Bindungsangst) im Sinne einer sozialen Phobie oder Klaustrophobie, und seine bloße Traditionsgläubigkeit, diese womöglich in Übereinstimmung mit seinem lokalen Institut oder seinem psychoanalytischen Verein, also aus Gründen bloßer Anpassung (Compliance mit seinem eloquenten Institut, verdeckte Absprachen, verdeckte Einigungen und gegenseitige Beteuerungen von Beschwörungscharakter, direkte Manipulationen eingeschlossen, durch jahrelanges enges Zusammensein mit der Neigung zu sektenhaften Überzeugungen und Abschottungen, mindestens aber mit einer Konsensgesellschaft, mit der Behauptung angeblicher Alternativlosigkeiten, auch zugunsten gegenseitiger beruflicher Förderung im Sinne von Seilschaften, etwa auch zur gegenseitigen Absprache, - wieviel Prozent der Mitglieder sind bloße Opportunisten ohne den Willen zur eigenen Nachprüfung und Beurteilung? - und Förderung des Nachwuchses, zugleich gemeinsame Abwehr anderer Meinungen, die von außen kommen, Einigelung) oder individuellen, auch zwangshaften Ordnungsvorstellungen, als wenn es sich um seinen –eigenen (!) - Vorgarten handelte, über die Interessen des Patienten stellen.
Dies kann auch ein Zeichen der sprichwörtlichen Arroganz von so manchem Psychoanalytiker sein. Was soll ihm das Recht verschafft haben, die Analyse nach Gutsherrenart, nach seiner vorgefassten Neigung, zu beenden, wann es ihm beliebt, und dies schließt eine vorgefasste Behandlungstheorie, die er oft nur der Literatur und / oder der augenblicklich herrschenden Strömung in seinem Ausbildungsinstitut ohne eigene Nachprüfung, ohne eigenes Nachdenken, ohne eigenes Urteil, nur zu oft rein imitativ und anpassungshaft- opportunistisch entnommen hat und so das Leben eines Patienten zu lenken?
Wenn ein Patient die Mühen des Weges und der Zeit auf sich nehmen will, sollte der Analytiker es nicht besser wissen wollen, zumal er nicht in den Kopf des Patienten so genau sehen kann, also nicht wissen kann, was dort im Einzelnen abläuft, auch wenn er dies – als „Empathieathlet" und wackerer Interpret einer gerade gängigen Strömung gerne und gewohnheitsmäßig für sich in Anspruch nehmen möchte und selbstverständlich auch im Groben zu leisten vermag, wie die meisten Menschen und nicht etwa nur oder besonders ausgebildete Analytiker.
Wir haben ja auch auf anderem medizinischen Gebiet durchaus die Bindung an den Hausarzt, den der Patient regelmäßig aufsucht, um mit ihm in Kontakt zu bleiben, auch wenn er keine Beschwerden hat, ohne dass hiergegen Einwände vorgebracht werden. Eltern haben lebenslange Bindungen zu ihren Kindern und umgekehrt, Geschwister untereinander und Verwandte untereinander. Bindung tut den Menschen im Allgemeinen gut. Die innere Bindung zwischen Analytiker und Patient besteht ohnehin weiter, auch wenn der Patient den Analytiker nicht mehr aufsucht.
Auch die Übertragung des Analytikers auf den Patienten kann Anteil daran haben, dass der Analytiker projektiv meint, die Therapie beenden zu müssen, so eigene Ängste, die Selbständigkeit nicht zu erreichen, in den Patienten verlegt und selbst ausagiert.
Gerade dieses hat in der Regel die Eltern in der Nachkriegszeit verleitet (H.E. Richter 1963 „Eltern, Kind, Neurose"), ihre Kinder forciert zu „Selbständigkeit" zu erziehen, ihnen z.B. schon im Kleinkindesalter möglichst rasch zu einem eigenen Bett und eigenem Zimmer zu verhelfen und stolz darauf zu sein, sie nachts stundenlang schreien zu lassen, was einer unreflektierten frühkindlichen und kindlichen Traumatisierung gleichkam, und vielleicht auch für die Zunahme von Angststörungen verantwortlich ist.
Somit können Bindungsangst, Angst vor Mangel an eigener Selbständigkeit, zwangshafter Ordnungssinn, überkommene analytische Tradition, die innere Schwierigkeit, etwas offen zu lassen, sowie blanke Herrschsucht / „Kontrollwahn" Motive des Analytikers sein, die Analyse entgegen dem Wunsch des Patienten beenden.
Das Bestimmenwollen von Seiten des Analytikers dürfte ein häufiges, unflektiertes Motiv sen. Für diese Analytiker mag es schwer erträglich sein, den Patienten das Ende selbst bestimmen zu lassen.
Natürlich können langdauernde Analysen auch auf Trennungsangst im Analytiker selbst beruhen. Will und kann er einfach den Patienten nicht loslassen und ihm ein Eigenleben gönnen? Der Patient soll sich nicht weiterentwickeln dürfen. Nach meinem Eindruck sind solche Fälle durchaus nicht selten. In einem mir bekannten Fall kam die Patientin, eine Kollegin, von ihrer Analytikerin erst dann los, als sie sich ein Herz fasste und eine andere Analytikerin über ihre endlos erscheinende Analyse befragte. Aber da hatte sie bereits einen Zeitschaden erlitten.
Aber es reicht nicht, Trennungsangst des Analytikers (oder gar seine finanziellen Interessen) zu postulieren, - man muss sie auch im Einzelfall aufzeigen.
Solche unnötigen Ewigkeitsanalysen, die nur Zeit verbrauchen, ohne dass der Patient sich weiterentwickelt, die ihm somit schaden, nur weil sich der Analytiker sich nicht von seinem Patienten trennen kann, lassen sich von außen schwer erkennen und beurteilen Da muss der Analytiker innerlich mit sich zu Rate gehen und danach suchen, welche inneren Konflikte ihn bei der Entscheidung behindern, dies zweckmäßig mit Hilfe einer Supervision.
„Regeln", dass eine Analyse zu beenden sei, weil es sonst keine Analyse sei, stehen in auch größerem Zusammenhang mit einem verbreiteten „Regelwerk", wie Analyse und die Beendigung einer Analyse abzulaufen hätten. Zum Glück halten sich nicht alle Analytiker an ein solches Schema. Oft aber wird mehr nachgelernt und nachgebetet, als selbst nachgedacht.
Danach muss der Patient zunächst eine so tiefe und heftige „Übertragung" entwickeln, dass er daran krank wird („Übertragungsneurose"). In deren Feuer soll alles Neurotische an ihm angeblich von selbst „verbrennen", ohne dass der Patient selbst verbrennt (fromme Hoffnung!) und ohne dass sich der Analytiker anstrengen müsste, eine Vorstellung, die ihre Eingängigkeit wohl dem biblischen „brennenden Dornbusch" verdankt. Dies soll dann aber den Analytiker nicht daran hindern, die Analyse zu beenden oder den Patienten so zu manipulieren, dass dieser die Beendigung selbst einleitet. Durch die Entwicklung der Übertragung soll eine angebliche „Regression" (Einwände s. Renik, Schlierf, beide 1998,Krill, 2008) eintreten, und zwar möglicht weit zurück in die frühe und früheste Kindheit (Shapiro 1981: „race back"), - je weiter zurück, desto angesehener der Analytiker in seinem Verein. Dass dies, wenn auch nur scheinbar, unter kräftigem, suggestivem Druck durch den Analytiker geschieht, bleibt unbeachtet, weil es so die Lehrmeinung ist und der Analytiker ja „nur" diese befolgt. Dann soll der Patient innerhalb dieses angeblich regressiven Zustandes das Richtige auch ordentlich und nachhaltig in der Übertragung wiedererleben, dann richtig erinnern und fühlen („Erlebe das Frühe noch früher und gefälligst hier an mir, hier und jetzt in der Stunde, Amen, und nur an mir, nicht an anderen, denn du sollst keinen Gott neben mir haben! Erinnere dich „genauer, fühle richtiger, Genosse!"), und das „Richtige" ist hier zweifellos das, was der Analytiker nach Lehrbüchern über die frühen Stadien der seelischen Entwicklungen gelesen und in seinen Seminaren gelernt hat und schließlich darunter versteht und somit erwartet. Dies muss der Patient erst einmal eine Zeit lang liefern, und dies möglichst „freiwillig", d.h. compliancehaft, weil der Patient längst weiß, was sein Analytiker gern hören möchte, aber wenn das nicht fruchtet, darf der Analytiker auch schon mal selbst durch Suggestivfragen kräftig nachhelfen („War da wirklich kein Trauma"? Waren Sie da wirklich nicht zutiefst erschüttert"? Wie haben Sie das überhaupt überleben können? Es muss ja ganz schrecklich gewesen sein, und es fällt auf, dass die entsprechenden Gefühle noch nicht gekommen sind. Daran müssen wir noch sehr arbeiten, nicht wahr? Sie werden sich gewiss noch näher erinnern, nur Geduld.").
Das höchste Ziel der „richtigen" Erinnerung und des „richtigen" Fühlens gilt dann als erreicht, wenn der Patient sich „erinnert „und einen Zustand von „Trauer" gerät, in dem ihm so richtig klar wird, wie übel ihm schon in frühester Kindheit mitgespielt wurde, wie heftig traumatisiert er dadurch war und welcher Hilfe er jetzt bedarf, um aus diesem Tief wieder herauszukommen und ein Mensch zu werden.
Hier kann, wenn der Analytiker hier unkontrolliert so recht in Fahrt kommt, der psychoanalytische Erinnerungskult zur Hochform auflaufen. Es wäre doch gelacht, wenn sich die dazugehörigen Gefühle nicht gehorsamst einstellen würden, nach dem Motto: „Wer sucht, der findet". Wenn er nichts gefunden hat, hat er nicht richtig gesucht und muss eben solange suchen, bis er es hat. Hier kann die Verlockung der Vergangenheit gewaltig mitwirken, zumal diese mit dem – trügerischen - Gefühl einhergehen kann, man komme der psychischen Wahrheit umso näher, je weiter man zurückgeht in die historische oder vermeintlich historische „Tiefe" oder an die vermeintliche „Wurzel" des Übels, und auch das „Frankfurter Reinszenierungskonzept" streckt schon begierig seine Fühler aus, zu reinszenieren, was da kommt oder kommen könnte. Ist es erst einmal inszeniert, glaubt man es ohnehin. Ist es einmal inszeniert, lebt man prächtig ungeniert.
Was in der Psychoanalyse auch sonst gern unterschätzt wird, ist die Bidirektionalität der innerseelischen Vorgänge. Nicht nur werden aus Beobachtungen und Befunde Konzepte gezimmert, sondern aus Konzepten werden auch Befunde oder „Befunde", und in gleicher Weise darf man von er Gefahr der „Reinszenierungsfalle" (Verf. 2014 hier), einer manchmal system- und vereinsimmanenten „Selbstverschönerung" (Verf. 2014 hier, zit. n. Erich Kästner) sprechen.
Die religiös getönten Rettungsphantasien des Analytikers bleiben unreflektiert (Kommt zu mir. „Ich bin das Leben und das Heil"), ebenso die Motive dazu (Anpassung, Verschiebung aggressiver Regungen aus dem Hier und Jetzt zu früheren Zeiten und auf andere Personen, Vermeidung, intensives Intellektualisieren, indem ständig Verknüpfungen mit tatsächlichen oder vermeintlichen früheren Abläufen gesucht werden bis hin zu höchst gesuchten, blutleeren, an den Haaren herbeigezogenen Erklärungen („Rekonstruktionen"), die manchmal auch nutzlose Desillusionierungen sein können (Analytikerwitz: „Der Einnässer ist nach zehn Jahren Analyse nicht geheilt, aber er weiß jetzt, warum nicht".), Isolierung von tatsächlichen Ängsten, Schuld- und Schamgefühlen, sowie von tatsächlichen depressiven Gefühlen).
Übrigens haben Erklärungen einem Patienten noch nie geholfen.
Woran das liegt? Der Konflikt wurde so nicht bearbeitet, vor allem nicht unter aktiver Mitarbeit des Patienten, er wird nur mit einem Etikett zugeklebt. Gegen Etikettierungen aller Art scheinen sich auch die Patienten bisweilen instinktiv zu wehren, indem sie Stolpersteine (Verf. hier, besser nicht zu verwenden, da schon von anderem Zusammenhang besetzt), regelrechte, drastische Störstellen, Stolperstellen (Verf. hier) in ihre Berichte und Verhaltensweisen einbauen. Denn nach einiger Zeit kommen die Patienten selbst darauf, dass die vielfachen Kollusionen mit dem Analytiker sie nicht weiterbringen können.
Der Fahrplan des Analytikers ist dem Patienten zu geradlinig geworden. Er möchte dem Analytiker signalisieren, dass dieser „um der Ordnung" willen zuviel Glättungen vornimmt, und er möchte den Analytiker damit in seinem Seelenfrieden stören, ihn aufwecken. Ziel ist es, dass der Analytiker zu sich plötzlich sagt: „Hoppla, ich bin auf falschem Wege". Nicht nur der Analytiker behandelt den Patienten, sondern dieser auch seinen Analytiker.
So brachte ein 45j Patient „aus heiterem Himmel", dem Himmel des beiderseitigen Einverständnisses, der beiderseitigen compliance, den Einfall, er könne unter den Tisch im Behandlungszimmer kriechen, diesen hoch heben und leicht kippen, sodass alles darauf Befindliche langsam herunterrutsche, - aber schnell genug, damit der Analytiker nicht eingreifen könnte. Vorausgegangen war, dass sich der Analytiker sich über Stunden hinweg mit der Beziehung des Patienten mit dessen Bruder befasst und die Rivalität zwischen beiden hervorgehoben hatte, was auch auf gute Resonanz des Patienten stieß oder zu stoßen schien. Der Patient wies so wahrscheinlich den Analytiker darauf hin, dass es um die Rivalität zwischen Patient und Analytiker ging, und das Gerede von der Rivalität mit dem Bruder ein kollusives, von beiden betriebenes, Ablenkungsmanöver war (Abwehr der Übertragungs-Gegenübertragungssituation durch Verschiebung auf eine andere Zeit und auf eine andere Person). Der Patient kam somit auf seine und des Analytikers Übertragung und Gegenübertragung durch eine Handlung zu „sprechen", - was üblicherweise mehr die Rolle des Analytikers ist (aber durchaus nicht sein sollte), und zwang den Analytiker, über sein schönes Thema endlich zu stolpern.
Wenn dies nicht ausreicht, den Patientin zur richtigen „emotionalen Einsicht" zu bringen, kriegt der Patient es noch einmal richtig persönlich gesagt („eingebimst"), dass er sterblich ist und dass auch er in höchstem Maße von der Mortalität betroffen ist, und dass es ein schwerwiegendes Symptom sei, notorisch nicht ständig an die Mortalität zu denken, wie es Gesunde und Reife täten, und dass es die Schwere des Traumas beweise, dass er so selten an seinen Tod denke und diesen hier zudem so selten verbalisiere und validiere und überdies viel zu wenig zertifiziere. (wie das Aschekreuz auf der Stirn bei der Firmung, „und zur Asche sollst du wieder werden"!).
Das muss dann der Patient schließlich „einsehen", aber dann geht es erst richtig los mit dem „Trauern" und der „Trauerarbeit". Der Trauerprozess muss gründlich „durchgearbeitet" werden, und erst dadurch soll dann „Getrenntheit" (ein psychoanalytisches Kunstwort, „analytisches Kunstsprech", verbale Kunststückchen, verbale Verfeinerungen auf Kosten des Patienten (Verf. hier) wie auch „Körperlichkeit"), entstehen dürfen, und damit nähert sich der Patient schon der Realitätsgerechtigkeit, und dann kann es zur alles entscheidenden „Abschlussphase" und „Trennung" kommen, und zwar alles hübsch in genau dieser Reihenfolge und in der Übertragung und von der Übertragung weg, und dann verkündet der Analytiker das Ende der Analyse, da der Patient die nötige „Reife" erreicht habe („ego te absolvo") und nun „in das Leben hinaus gelassen" werden könne. Trauere also schneller, tiefer, länger, Genosse Patient! Trauere dich durchs Leben. Und kümmere dich nicht weiter um Konflikte! Die Trauer, des Analytikers liebstes Kind, wird es richten. Sei nicht länger unfähig, zu trauern. (Margarete Mitscherlich: „Die Unfähigkeit, zu trauern"). Wer Trauer hat und wer Trauma hat, hat keine Konflikte und braucht keinen Likör. Trauere dich gesund und lass dich dabei psychoanalytisch begleiten! Mit Trauerarbeit wird alles gut. Kalkulieren Sie dafür schon mal ein paar Jahre ein, Sie haben ja unendlich viel Zeit, Kinder können Sie noch mit 50 kriegen. Dass dabei (oft schon nach 29. LJ.) der Beckenboden (M. levator ani) irreversibel zerrissen wird, mit den Folgen von Harninkontinenz, Stuhlinkontinenz, Uterusprolaps und Darmintrusion in die Scheide, und Schmerzen, ist nicht schlimm, denn Sie haben ja den Trauerprozess schon hinter sich, den Analytiker ebenfalls, und die Rente winkt.
Außerdem: Wozu brauchen Sie Kinder, wenn Sie genügend getrauert haben? Trauerarbeit ist eine Lebensarbeit, ein Lebenswerk. Dies müssen Sie vor allem an Ihrem Analytiker, in der Übertragung, vollbringen. Achten Sie darauf, dass auch Ihr Analytiker richtig mittrauert. Denn mit Ihrem eigenen Trauern kann es nicht getan sein, dies wäre nur die halbe Miete. Alles muss sich in der Behandlungsdyade abspielen. Setzen Sie die Trauerarbeit nach Beendigung Ihrer Analyse fort. Die Analyse hat einmal ein End `, die Trauerarbeit nicht. Denken Sie bei der Trauerarbeit auch an den sozialen Wert von Arbeit. Trauerarbeit verschafft Ihnen auch mehr Anerkennung im Kollegenkreise und mehr Selbstachtung und Selbständigkeit. Nur wer trauert, arbeitet richtig und ist ein nützliches Mitglied der Gesellschaft.
Das menschliche Gehirn, die menschliche Psyche denkt gar nicht daran, sich an ein solches Sukzessionsschema (kritisch betrachtet von Benjamin Barde, 2014 mündliche Mitteilung) zu halten. Analytiker hingegen haben doch zu gerne „Ordnung" in ihrem Kopf, besonders, wenn es eine simple Ordnung ist, damit sie eine Linie haben. Gehirn, gebe gefälligst deine vierdimensionale Tätigkeit auf und bescheide Dich auf unsere lineare Denkweise. Von deinen 100 Milliarden Zellen brauchen wir nur ein paar hundert, und es wäre doch ein Wunder, wenn wir die nicht auf Linie bringen könnten, - wozu haben wir eine Lehranalyse gemacht und uns zu Empathie-Athleten entwickeln dürfen? Hier liegt Unfähigkeit zugrunde, sich von liebgewordenen Vorstellungen zu verabschieden.
Zum Glück denken nur wenige Analytiker (so „institutsgeleitete, geführte Analytiker") so, aber sie geben manchmal (evtl. „Gockelzwang", Kraftlackeltum ((Stolterfoht)) den Ton an.
Von Abwehr ist bei diesen Themen keine Rede mehr, als ob Freud nie eine Strukturtheorie entwickelt hätte und Abwehr in diesen Themen keine Rolle spielte und als ob es sich also hier nicht bereits um Kompromissbildungen handelte, die wie ein Symptom gebildet sind.
Man gibt sich sogar erstaunt, ratlos bis befremdet (so, Abwehrlehre sei doch längst veraltet, - nein , - man hat sie verlernt oder nie wirklich verstanden, jedenfalls meistens nicht konsequent angewandt, und dass ich sie hier und in meinen Analysen intensiv anwende, zeigt schon allein, dass sie nicht untergegangen, sondern höchst vital und quicklebendig ist. wenn bei den vorgeführten Fallbeispielen in diesen Themen nach der Bearbeitung der Abwehr gefragt wird.
Nein, man möchte wie in der Frühzeit Freuds, also gemäß dem topographischen Modell, nach dem Unbewussten direkt „angeln" und das Gefundene als das Unbewusste, Verdrängte ausgeben und als das Sensationelle nicht anders als in der Frühzeit der Psychoanalyse nicht ohne Eitelkeit und Sensationslust vorzeigen, statt das Gefundene als Ergebnis eines weiteren inneren Prozesses zu begreifen und zu respektieren.
Es ist nicht übertrieben, hier von einem zeitgenössischen Neglect der Abwehr im psychoanalytischen Kongress- und Vereinsleben zu sprechen.
Demgegenüber enthalten die Examenskolloquien mit ihren detaillierten Fallvorstellungen (jeweils über 300 Stunden Behandlung mit Supervision durch Lehranalytiker) noch oder wieder regelmäßig längere Ausführungen über die beobachtete und gedeutete Abwehr. Auch über diese Differenz macht sich offenbar niemand Gedanken.
Traditionell herrscht im besten Fall hingegen eine Zugangsweise vor, die auf nur einzelne Komponenten des neurotischen Konflikts fokussiert, so Wünsche nach Halt und Fortkommen oder Ängste, diese Ziele nicht zu erreichen, oder Vergeltungsängste, Schuld- und Schamgefühle, aber den Blick auf das Ganze, den gesamten zugrundeliegenden neurotischen Konflikt mit seinen Einzelkomponenten verloren hat, - richtiger - vermeidet, - eine unnötige, schwerwiegende Selbsteinschränkung zugunsten einer eingeengten Sicht- und Arbeitsweise, z. Z. besonders einer einseitigen Traumatherapie (als ob einem Trauma nicht schon eine Neurose aufgrund eines inneren unbewussten Konflikts vorausgehen könnte, die dann auch weiterbesteht, oder durch das Trauma ausgelöst werden könnte oder sogar müsste, mitsamt deren einzelnen Konfliktbestandteilen und deren Abwehr, oder einer einseitigen Mentalisierungstherapie, deren angeführte Fallbeispiele, wenn man sie Wort für Wort liest (aber wer unterzieht sich schon dieser Mühe?), in keiner Weise die anspruchsvollen Theorien stützen können, sondern von willkürlicher und oberflächlicher Interpretation gekennzeichnet sind (Fonagy et al.: Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst, 2013, s. Krill 2015).
Verbreitet ist auch andere Formen von Abweichungen von der Konzentration auf das Innenleben: Es ist schwierig und kann von der Konfliktbearbeitung ablenken, die gewiss interessanten deskriptiven Gesichtspunkte, etwa von „Diskrepanz" zwischen „phänomenaler Wahrnehmung" und präkonzeptuell gesteuertem Erleben" des Patienten (Bardé 2012, 209), auf eine Behandlungsstunde anzuwenden. Es geht hier um das innere Erleben des Patienten. Für Phänomenologie sind wir kaum zuständig. Das sind Außenaspekte, bei denen es um die Frage ginge, wie Andere das Gleiche erleben würden, nämlich verschieden. Diskrepanzen von Belang kann es aus analytischer Sicht nur geben zwischen den Erlebnisweisen verschiedener Personen, wie sie z.B. in einer Gruppenanalyse zum Ausdruck kommen. In der Einzeltherapie interessiert nur die Erlebnisweise diesen einen Patienten (und nicht etwa meine, abgesehen von der Gegenübertragung, oder die meines Nachbarn), und mit diesen haben wir genug zu tun. Wir lassen uns von unserer Aufgabe nicht ablenken durch Außenansichten durch Andere. Wir brauchen keine Phänomenologie, sie stört uns nur. Gerade die von Balint, Kutter und Andere geforderte „Anerkennung" und die „Performität der primären Spontaneität des Patienten (zit. n. Barde 2012, 209) können wir nur dadurch gewährleisten, dass wir uns streng auf den Patienten und sein Innenleben konzentrieren. Und durch nichts fühlt der Patient sich so anerkannt als durch dieses.
Zu allem, sogar zur komplizierten Philosophie und Phänomenologie, ist ein Analytiker bereit, wenn er nur um die Behandlung des inneren Konfliktes herumkommt. Hier ist die Phobie zum ritualisierten Neglect geworden, per Intellektualisierung als Abwehr gegen die inneren Konflikte, mit denen man partout nicht zu tun haben will. Über alles Andere ist man bereit zu sprechen. Die dort ebenfalls beschworene „Normale Sprache" (dito) ist nichts anderes als eine Sprache, wie sie nach Bearbeitung der Abwehr möglich wird und sein soll, - wenn der innere Konflikt diese Sprache nicht mehr stört. Auch bei der „Verstümmelung von Texten, Textentstellungen und Wiederherstellung zerstörter Zusammenhänge... der Lücken... des Ausgelassenen..." (Freud, Lorenzer, Argelander (zit. von Bardé 2012, 208) geht es um nichts anderes als die Wirkung der Abwehr und deren Auflösung, sodass das Verdrängte endlich gesagt werden kann. Außerdem handelt es sich bei der Konzentration auf die Sprache um ein kapriziöses Unterfangen, nicht ohne Eitelkeit, weil man über die Sprache am besten philosophieren kann. ohne jemandem weh zu tun und ohne zur Sache kommen zu müssen („Goethe hat den Braten gerochen, er hat nie über die Sprache gesprochen").
Ganz gelingt die Auflösung der Abwehr nie. In jeder sprachlichen und nicht sprachlichen Äußerung steckt immer noch Abwehr. Die Störung oder jedenfalls Beeinflussung der seelischen Abläufe durch Abwehr ist umfassend. Sie betrifft nicht nur das – kleine und harmlose - Gebiet der Sprache, sondern beeinträchtigt alle Abläufe, namentlich die nonverbalen, die das Leben weit mehr beherrschen. Auch hier kann man sagen, dass man „bereit ist, über alles zu reden", wenn man nur die Macht der Abwehr und somit den inneren Konflikt negieren kann / darf. Wir wollen das aber nicht erlauben.
„Textentstellungen", - als ob es nur um Texte ginge. Ist der Patient ein „Texter"? Welche Verharmlosung, welche Intellektualisierung. Der Analytiker soll die Aufgabe haben, die angeblich zerstörten Texte wiederherzustellen. Der Analytiker als Dichter und Wiederhersteller, Konservator des Alten, des Richtigen, als Besieger des Bösen, des Entstellenden, als Retter und edler Ritter, als Papierraschler. „Zerstörtsein" macht sich als dramatisierender Ausdruck immer gut, zumal der „Zerstörung" dann die Retter auf dem Fuße folgen können. Aber sie wollen alle direkt und höchstselbst die Lücken schließen, das Ausgelassene ohne Respekt auf die Abwehr erraten, als „Empathieathleten", und gelernte Restaurateure, die „Verstümmelungen" wieder zusammenflicken wie ein Chirurg. Man kann doch einen Verstümmelten nicht einfach so lassen, einen Zerstörten nicht einfach so liegenlassen, nicht wahr? Auch eine „Störung des Raumzeiterlebens, gar als „Auflösung der Formen von Raum und Zeit" (hier wird es sogar physikalisch statt nur psychisch, wo ist hier der Text? Lit. b. Verf. 2012) aufgefasst, kann ich klinisch nicht erkennen, und auf solches allein kommt es an, denn Philosophie ist so geduldig wie Papier und wie ein Schreibtisch. Wo soll „der Raum zu einer Fläche zusammengepresst" sein, ein „Weltverlust" sich ereignet haben, ein „Nullpunkt konstituiert" (wie vor dem Urknall?) sein? (dito S. 207). Wo sind die klinischen Korrelate? Es handelt sich um Zitate von Kant, aber Kant hat, wenn man höflich daran erinnern darf, nicht einen einzigen Patienten gehabt, geschweige denn psychoanalytisch behandelt. Im angeführten Fallbeispiel hat ein Pat. immer wieder Vorhofflimmern erlitten, wenn er sich nicht durchsetzte (gegen überlange Spaziergänge, die ihm nicht zuträglich waren, gegen aufgedrängtes Kuchenessen, gegen Totgeredetwerden oder besser Sichtotredenlassen durch einen, der ihn im Auto mitnahm u.a.). Die aufsteigende Wut, also eigene aggressive Regungen, eigene aggressive Wünsche, die sich dann auch in der Übertragung zeigen, indem der Patient fernbleibt, ohne die Sitzungen abzusagen (S. 211 dito) und nicht weniger in der Gegenübertragung („befürchtete...ein gewalttätiges Schlage-Szenario"; fürchtete, eine solche Dynamik –selbst- auszulösen", also die eigene Aggressivität fürchtend und somit abwehrend, S. 211 dito, sodass man sich auf einen Kuraufenthalt einigte – Verschiebung des gesamten Aggressionskonflikts auf einen anderen Ort und auf andere Therapeuten, -ein Schelm, wer fragen würde, ob man den Aggressionskonflikt auch im Patienten selbst hätte behandeln können - , konnte er nicht äußern, aus Vergeltungsangst, aus Scham, aus naheliegenden Schuldgefühlen (man tut so etwas nicht, wenn man eingeladen ist, wenn man im Auto mitgenommen wird, wenn man sich auf eine Wanderung nun mal eingelassen hat) er dürfte deshalb Abwehr gegen diese unangenehmen Gefühle eingesetzt haben in Form von Wendung gegen die eigene Person, was unterwürfiges Verhalten und Selbstbestrafung einschließt. Der dort genannte „zirkulär- rotierende Prozess", „Präkonzept" und die „präkonzeptuell gesteuerte Ablaufstruktur", „infantile Modellszene" ( S. 216 dito) (die drei letzten sind zu außerdem zu statisch gedacht, als ob es um endgültige Zustände ginge),(dito 209-10) sind nur ein andere Worte für das Hin und Her des inneren Konfliktes mit seinen Wünschen, gesund zu bleiben, sich durchzusetzen, seinen Vergeltungsängsten und seinen Schuld- und Schamgefühlen einerseits und seiner Abwehr gegen diese unguten Gefühle andererseits. Statt „Weltverlust" und „Objektlosigkeit" darf man bescheidener sagen: Wenn der Patient einen Herzanfall erleidet, fühlt er sich hilflos und ist er ganz mit seinem schlechten, sogar katastrophal schlechten, Zustand beschäftigt und interessiert sich kaum noch für Anderes. Warum sollte er auch? Er handelt völlig realitätsgerecht, denn er hat die Aufgabe, sich um sich zu kümmern, um Hilfe zu bitten usw. Sprechen wir auch von Weltverlust, wenn jemand sehr hungrig ist und nun das Essen hinunterschlingt, oder jemand akute Zahnschmerzen hat und sich nur noch um den Zahn kümmert ? (W. Busch: All des Schmerzes Seele, sitzt jetzt in des Zahnes Höhle"). Im Augenblick interessiert ihn nur die Mahlzeit, nur der Zahn, - was soll daran pathologisch sein?
Gegenüber seiner Ehefrau (S.211 ff, dito) ist die gleiche Abwehr in Form der Wendung gegen sich selbst zu erkennen (Impotenz, Unterwürfigkeit, -treffend als „devote Bedienungshaltung" beschrieben, stellt sich gern männerlose lesbische Treffen vor, um seiner Angst vor männlicher Konkurrenz und seiner Angst vor eigener Aggressivität gegen Konkurrenten auszuweichen, Abwehr durch Negation) , bis er in der Sicherheit der weiteren Analyse diese Abwehren aufgeben und klinisch eine erfreuliche Entwicklung nehmen konnte.
In ähnliche Richtung bewegen sich „Bedeutungsbildungen durch musikalisches Zuhören" (Dantlgraber 2012). Zweifellos kann das Ubw unter Umgehung des Bw mit dem Ubw eines Anderen über nonverbale Mitteilungen über Stimmungen, Wünsche nach Halt, Geborgenheit oder aggressiver Entfaltung und Ängste (vermittelt jeweils visuell (so besonders mimisch), akustisch (so besonders Stimmlage und Stimme), olfaktorisch, sensomotorisch (so besonders Bewegungsmuster und Hautkontakt) reagieren, wie schon Mutter und Kind. Gewiss handelt es sich „ um ein in sich geschlossenes System der Bildung, Transformation und Speicherung" (dito, S 151). in etwa auch Balints „primärer Liebe" entsprechend, und keinesfalls handelt es sich hier um eine neue Erkenntnis .Entscheidend ist aber, dass die erst im Laufe der Entwicklung entstehenden inneren Konflikte sich so gewiss nicht lösen lassen. Es reicht dazu keineswegs, gut mitzufühlen, sich einzufühlen, etwas gemeinsam zu fühlen, und sei es noch so intensiv, etwa auch in einem analogen musikalischen Erleben oder Miterleben, etwa auch in Beispielen aus der Musikliteratur oder Klangerinnerungen, welche „die Affekte darstellen" („Affekthören", dito 152). Niemand wird bestreiten, dass das Evozieren von Musik und Erinnerungen an Musik Affekte auslösen und darstellen, und auch umgekehrt ein Therapeut und ein Patient aus Affekten musikalische wie auch visuelle, körpersensorische Erlebnisse formen, eine „frühe Wahrnehmungs- und Kommunikationsweise" ... oder eine „archaische Lebenszeit wieder wachrufen" (S.152) kann. Auch kann dies durchaus, auch in gegenseitiger Beeinflussung wie sonst im Alltag mit anderen Personen auch, im Gleichklang mit dem Patienten geschehen, was aber nicht heißen kann, dass hier irgendetwas verschmolzen wäre. Patient und Analytiker mögen die gleichen oder ähnliche Erlebnisse oder Stimmungsanwandlungen haben, dennoch geschieht dies getrennt in zwei Personen. Die Erlebnisse als solche sind nicht etwa „vereinigt" („unified"), wie dies an anderer Stelle behauptet wurde. Im Einzelnen geht es „vom Affekthören zu Klangvorstellungen, was dem Schritt vor der reinen Darstellung eines Affekts zum Versuch, dem Affekt eine Bedeutung zuzuschreiben, ähnele" Die Klangvorstellungen seien vom Patienten den Analytiker „sensomotorisch induziert" (S. 153, gemeint kann nur sein „sensorisch"), zugleich seien sie in dem persönlichen Erfahrungsbereich des Analytikers verwurzelt. In meinen eigenen Worten: Der Patient bringt etwas im Analytiker zum Klingen, - wirklich ein neuer Gedanke? Was jeder Bauer weiß, wird hier so richtig gründlich- wissenschaftlich!
Von den Klangvorstellungen geht es zu „vagen Vorstellungen von Tonfolgen, die als Hörassoziationen zu bezeichnen" seien, einhergehend mit körpernahen Gefühlen wie Gefühlen des Fallens, des Steigens, des Rotierens, die nach Stern (2005) auch „Vitalitätsaffekte" genannt worden seien. Die affektiven Erlebnisse können den Analytiker an ein musikalisches Motiv erinnern. Sie geben die „gespeicherten Beziehungserfahrungen" des Analytikers wieder. Dann könne der Analytiker eine Deutung geben, die der Patient zum „Ausbau seiner inneren Welt verwenden" könne (S. 153).
Solche Vorstellungen sind vielmehr ein Beispiel für (Abwehren von) Ausweichen vor konflikthaften Differenzen zwischen den beiden Beteiligten und in diesen selbst, und zwar zu Vorstellungen von Harmonie in Form von Vermeidungen, Verleugnungen, auch Reaktionsbildungen gegen aggressive Wünsche, aggressive Regungen.
Die angeführten Fallberichte (so dito 154 ff), die übrigens, wie auch sonst in der analytischen Literatur zu beobachten, notorisch theoretische Erwartungen / Hoffnungen mit klinischen Beobachtungen oder Befunden verwechseln oder unauflösbar vermischen, legen aber nicht dar, dass dadurch ein innerer Konflikt einer Lösung nähergebracht, noch, dass dies überhaupt angestrebt wurde. Welche Abwehrvorgänge zugleich oder auch nicht zugleich in Patient und Analytiker in ihrem Musikerleben ablaufen, - dafür interessiert man sich nicht.
Im ersten Fall kam es zu einer „Hemmung des Assoziationsflusses in der (25j.) Patientin" durch eine erotische Übertragung mit den Ängsten und Schuldgefühlen sowie Vermeidung des Sprechens der – wesentlich jüngeren – Patientin, die auch ohne Musikerleben deutlich und deutbar genug war. Auch die Gegenübertragung („Hörassoziationen, ergänzt durch ein inneres Sehen") „im Meer würde ein Sturm aufkommen" ist nur natürlich. Der Analytiker hat hier aber nur von sich auf Musik verschoben, weil die erotische Gegenübertragung auf eine sehr junge Frau, die wegen „Beziehungsproblemen mit Männern" kam, bekanntlich nicht weniger bedrängend ist als eine erotische Übertragung. Hier dienen die feinen musikanalytischen Schritte und Überlegungen ersichtlich der Abwehr von Schuld- und Schamgefühlen sowie Vergeltungsängsten im Analytiker selbst.
Im zweiten Fall, einem 45 j. Krankenpfleger, erfasst der Analytiker ebenfalls „ unsagbares affektives Material des Patienten" „via sensomotorischer Induktion", bis zu Assoziationen eines konkreten Musikstücks. Dies habe es ermöglicht, dass sich „in einer nichterfassbaren analytischen Situation Bedeutungen bilden" konnten, die zu einem diskursiven Verstehen geführt haben. Die Wege, die dort bis zu diesem Ergebnis gezeichnet wurden, sind äußerst verwirrend, um nicht zusagen, verworren. Auch hier herrscht Wunschdenken vor, und die Wege zum Ergebnis sind nicht nachvollziehbar, erwecken vielmehr den Eindruck von Willkür. Es wird dargestellt, wie es sein sollte, aber nicht, wie es war. Zweifellos teilt sich Ubw des Patienten dem Analytiker direkt mit, wie auch gewiss nicht weniger umgekehrt, - direkt, d.h. ohne dass sich dieses in Worte oder gar in einen klaren Gedankengang fassen ließ. Dazu benötigen wir keineswegs den Umweg über Musikvorstellungen, der, wie hier angeführt, mit einer gewaltigen auch intellektuellen Anstrengung einhergeht bzw. diese anscheinend auch erfordert. Nein, zum Glück für den Patienten geht es einfacher und direkter, wie zwischen Mutter und Kind! Umständlichkeiten können wir uns als Analytiker nicht länger leisten. Es ist schon viel getan, wenn es dem Analytiker gelingt, seine Gegenübertragung zum Nutzen des Patienten einzusetzen. Hier kann der Verdacht aufkommen, auch noch mit einem gewaltigen Aufwand von der Bearbeitung des inneren Konfliktes abzulenken, i. S. einer Vermeidung, die Abwehr anzugehen, auch unter dem gefährlichen, oft von Eitelkeit und Selbstbezogenheit nicht freien Anspruch, nicht nur Analytiker, sondern noch mehr ein Künstler zu sein (s. hierzu die Einwände von Paul Gray) und die eigene Person zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen, zumal vom Musikerleben des Patienten nicht die Rede ist.
Aber es kann sogar der Eindruck entstehen, dass nicht nur der Konflikt im Patienten vom Analytiker abgewehrt wird, sondern auch der Kontakt zwischen den beiden Ubw. der Teilnehmer. Denn zuviel ist vom Analytiker an umständlichen und scharfsinnigen Überlegungen und Musikerleben dazwischen geschoben, als dass dieser direkte Kontakt noch möglich wäre. Man kann durchaus die These vertreten, der Kontakt wurde sogar nur durch das Musikerleben gestört, zumindest nicht erleichtert, sondern erschwert. Beides gleichzeitig ist nicht zu haben.
Insgesamt ist auch festzuhalten, dass inneres Musikerleben des Analytikers ihm helfen kann, seine Gegenübertragung zu erkennen und vielleicht auch intensiver zu fühlen. Aber dies kann man von anderen inneren Vorgängen im Analytiker ebenfalls sagen, z.B. eigenen Erinnerungen, Wünschen, Ängsten, Schuld-und Schamgefühlen sowie Abwehrformen der gleichen oder gegenteiligen Art, wie der Patient sie vorträgt bzw. zeigt. Gegenübertragung ist wichtig, aber auch nicht alles, und keineswegs nur Musikerleben, erhellt die Gegenübertragung.
Es ist auch zu berücksichtigen, dass es auch Analytiker geben soll, die mit Musik nichts am Hut haben. Was machen die?
Bloß von Arbeit an der Abwehr will niemand etwas hören. „Sprachzerstörung und Rekonstruktion" klingt besser. Die Seelen, an sich schon verloren, werden vom sōtēr, vom salvator, vom Heiland, vom Retter, vom Analytiker gerettet. Dem Rekonstrukteur ist nichts zu schwör. „Wer ein Volk retten will, kann nur heroisch denken." Man begnügt sich nicht, zu meinen, dass man die Abwehr mildern konnte, nein, man muss ein Retter sein.
Indessen hat die frühere Konzentration auf die Therapie von angeblichen oder tatsächlichen Borderlines, etwa nach Kernberg, schon wieder an Aufmerksamkeit verloren, zumal deren Ergebnisse die hochgesteckten Erwartungen von Anfang an enttäuschten, auch bei Vertretern dieser Richtung selbst.
Deren Fallbeschreibungen erscheinen dürftig, sogar programmhaft- vollmundig- plakativ, routinehaft sich selbst durch die Rotation der Presse reduplizierend, schon nach dieser kurzen Zeit miefig- verstaubt- bürokratisch, tot wirkend, vor allem auch laienhaft, nämlich naiv-populärpsychologisch, voller falscher, gesuchter Analogien, z. T. tief unter Selbstverständlichkeiten stehend, ohne an Abwehrmechanismen Anna Freuds auch nur zu denken und ohne auch nur einen einzigen der behaupteten sog. primitiven Abwehrmechanismen klinisch darzustellen, auch ohne sonst anschaulich zu sein, halten sich sehr im Allgemeinen und lassen auch keine konkreten klinischen Besserungen erkennen (Krill 2008, Projektive Identifikation, Spaltung, 82-88), Borderline als „waste basket diagnosis, Borderline als unerkannte Gegenübertragung, 250- 259).
Die offensichtliche Herkunft vom Nur- Schreibtisch, das Künstlich- Synthetische, ist ihr deutlich anzumerken, das herdenhaft Nachschwätzende, d.h. der immer wie selbstverständlich klingende, gedankenlose, gedanklich nicht selbst überprüfte Umgang mit gewichtigen Bruchstücken wie „projektiver Identifikation" (die nie im Einzelnen beschrieben wurde) mit ihrem inzwischen heftigen Wurzelwerk nicht weniger..
Auch persönlich ist mir kein Psychoanalytiker bekannt, der erfolgreich nach dieser Methode gearbeitet hätte, ungeachtet der umfangreichen, verheißungsvollen Literatur. Die Druckerpresse lässt grüßen, wir und viele Andere grüßen höflich, aber in der Sache bestimmt, zurück. Bis heute wird der Begriff gedankenlos gebraucht.
In Kliniken wird „Borderline" besonders häufig verwandt (und muss dann weiter ohne eigene Nachprüfung und Beurteilung von den niedergelassenen Ärzten übernommen werden), damit die Länge des Aufenthalts vor den kritischen Augen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) mit schwerer Krankheit gerechtfertigt werden kann. Klingt nicht diese Diagnose nach einer Fast-Psychose? Welche gefühllose Person möchte es wagen, einem „Borderline" eine medizinische Leistung zu versagen oder zu kürzen? Um sich – immer im Vergleich zu analogen Kliniken – zu behaupten, werden 30 % Borderlines, 30 % schwere Persönlichkeitsstörungen oder „schwere depressive Episoden" und 30 % schwere Traumatisierungen (PTBS) von ganz oben an die Ärzte und Psychologen vorgegeben, sonst muss die Klinik schließen.
Der MDK hat es schwer, einem eloquenten Klinikdirektor und Professor zu widersprechen, und die Krankenkassen hüten sich (und kein Mitarbeiter hätte dort ein Interesse daran, denn er handelt sich nur Ärger ein), einem Patienten zu widersprechen. So kommt es zu der „wundersamen Vermehrung schwerer psychischer Erkrankungen" von biblischem Ausmaß in den Statistiken.
Nun ist die angebliche Therapie an verdinglichten (reifizierten) „intermediären Räumen" an der Reihe. Hierzu gehört auch die Forderung von Sandler, Holder und Dare (1973), Klüwer (1983), vom „Frankfurter Szenen- und Inszenierungskonzept" (Klüwer, Scharff 2010, Otto 2014) (Kritik s. Krill 2008, 226 ff: Narzisstisch getönter Leistungsehrgeiz), „Rollenbeziehungen, „wechselseitige Behandlung , „Handlungsdialog", situative Evidenz (gleich oder ähnlich bei Argelander, Lorenzer, alle zit. n. Markert 2012, 176) und nach „gemeinsamem Forschungsprogramm von Patient und Analytiker", das die vom Patienten beabsichtigte „Rollenübernahme" des Analytikers einschließen soll.
Den „Handlungsdialog" hat man auch früher schon gesehen. Er ist Alltag, mitsamt der ständigen gegenseitigen Manipulation (die auch sensationell, trendhaft, imitativ und ohne eigene Überprüfung des Begriffs „projektive Identifikation" genannt wird, - um die es jetzt wieder stiller geworden ist). Die Handlungen des Analytikers hatte man bislang unter „Gegenübertragungsagieren" gefasst. Damit war treffend festgehalten, dass diese Handlungen vom Patienten induziert waren, dass also der Analytiker sich manipulieren ließ. Die Frage ist, ob die Einführung des Begriffes „Handlungsdialog" neue Erkenntnisse gebracht hat. Es ist wohl ein treffendes Wort gefunden worden, aber der Nachteil dieses Begriffes ist neben seiner Alltäglichkeit, seiner Selbstverständlichkeit der Aufmerksamkeitsentzug, den der Patient, speziell sein Innenleben erfahren muss oder kann, wenn sich die Konzentration des Analytikers auf den Handlungsdialog verlegt.
Markert (2012, 191) plädiert aber: „ ..ein Analytiker, der bereit ist, auf der analytischen Bühne mit der „Analysantin" (eigentlich falsche Wortbildung, - man kann nicht einfach aus einem Gerundivum ein Partizip machen, Verf., - man wollte wohl damit die aktive Rolle des Analysanden hervorheben, - was hat man eigentlich gegen das Wort Patient? Antwort: Bloße Soziologen (anwesende ausgenommen) haben keine Patienten und könnten auch keine behandeln.) Handlungsdialoge zu inszenieren, wird es ermöglichen, einen Neubeginn zu gestalten". Freud habe lediglich die infantilen Wurzeln der Übertragungsliebe erkannt, nicht die Neuschaffung einer Vaterbeziehung und deren intensives Durchleben durch eine Patientin, nein, durch beide Teilnehmer, denn der Analytiker muss hierzu wirklich die Rollen voll übernehmen (Briefe mit Anreden als „mein lieber Papa", „mein liebes Töchterlein", Telefonate, Besuch), selbstverständlich ohne das Inzesttabu in Frage zu stellen. Einleuchtend ist, dass die Patientin infolge des Einsteigens des Analytikers auf die ihm zugedachte Vaterrolle (und auf die dahinterstehende Mutterrolle mit Sehnsucht nach der Mutter) die Beziehung zu ihrem eigenen und zu einem neuen Vater gewiss intensiver als in „gewöhnlichen" Analysen durchleben und Verzicht lernen konnte. Es war ein Handlungsdialog zustandegekommen, über den nicht nur nachgedacht wurde, sondern der auch ein intensiveres Durchleben ermöglichte. In einer Einzelanalyse ist ein solcher Aufwand nur als Ausnahmefall möglich, und schon deshalb kann dieser Fall kein Vorbild sein.. In einer Gruppenanalyse wäre aber ein Handlungsdialog von diesem Ausmaß überhaupt nicht möglich, sondern würde nur zur Verwirrung führen. Grundsätzlicher Einwand kann sein, dass es fraglich ist, ob ein volles Durchleben kindlicher Konflikte bzw. Traumen in der Analyse und eine solcher Handlungsdialog wie hier wirklich ausreichend und notwendig (Definition von Wirtschaftlichkeit) sind, innere Konflikte zu lösen. Ist dieser Weg nicht doch zu umständlich und zeitraubend wie auch andere oder ähnliche Wege, welche die Arbeit mit Übertragung, Gegenübertragung und Empathie als die einzig richtige betrachten? Oder wird hier im Stillen auf Konfliktlösung verzichtet, weil man nicht an wesentliche innere Konflikte im Zusammenhang mit kindlichen Traumen wie hier glaubt und nur Traumafolgen mildern will und hierzu Nacherleben mit Rollenübernahme durch den Analytiker für ausreichend oder einzig erfolgreich erachtet? Hierbei würde der Empathie höchste Bedeutung zukommen, wie auch Übertragung und Gegenübertragung sowie dem Handlungsdialog. Diese Art von Analyse nähert sich bedenklich dem frühen topographischen Modell Freuds an. Zudem ist Neubeginn sicher auch in anderen Analyseformen oder sogar im Alltagsleben angestrebt und erreicht, wenn auch eher stillschweigend, kann also keinesfalls vom Konzept des Handlungsdialogs gepachtet sein, ist also für diese Art von Analyse nicht spezifisch, sondern unspezifisch. Andererseits und immerhin: Nichts ist so erfolgreich wie Erfolg.
Speziell zum Frankfurter Szenen –und Inszenierungskonzept: Auffallend ist eine gewisse Selbstzufriedenheit, wenn nicht ein naiv gegenüber dem Patienten (die daraufhin das Weite suchen, Krill 2008) demonstrierter Stolz über die eigene blitzartige Leistungsfähigkeit und die so erreichten Erkenntnisse (Krill 2008, 266 ff: Narzisstisch getönter Leistungsehrgeiz). Dennoch wurde das Konzept in der deutschen Literatur als große Entdeckung gefeiert. Diese hehren Gefühle stören aber – unreflektiert - die spätere, nachhaltige Arbeit am Patienten. Zumindest besteht immer die Gefahr, sich auf diesem übereilt erlangten „Erkenntniskissen" (Verf. 2014, Krill 2008: „Wir haben niemals Ruhe") auszuruhen. Dementsprechend ist auch nirgendwo ein therapeutischer Ansatz erwähnt, noch eine Absicht dazu, oder nur wenig (Kipphan 2012, 275- 285). –
Zudem ist hier wieder die einseitige Rückwärtsgewandtheit zu erkennen. Schon Freud ist auf diese konzentriert. Selbst wenn er sich vorübergehend mit der Gegenwart des Patienten befasst, namentlich auch mit dessen jetziger Übertragung auf ihn, kommt er, wie zurückgeprallt von der ihn beängstigenden Gegenwart, besonders von dem Drang erotisierter Patientinnen, immer wieder auf die - vermeintliche oder tatsächliche- Kindheit zurück.
Er ist weit mehr mit „Rekonstruktionen" beschäftigt als mit dem, was im Patienten gerade jetzt vorgeht.
Es ist nicht zu übersehen, dass schon Freud hier ausgiebig von Abwehr durch Intellektualisierung, Vermeidung, Verleugnung (der offensichtlichen Affekte im Patienten in der Stunde), Idealisierung (der Kindheit, mit von ihm verteilten Alleinvertretungsanspruch dieses Entwicklungsabschnitts) und Verschiebung auf die Vergangenheit und auf vergangene Personen Gebrauch macht, um nicht mit dem Innenleben des Patienten und damit mit seinen eigenen aktuellen Konflikten konfrontiert zu sein, vor allem nicht mit den unangenehmen Affekten wie verbotenen Wünschen, Ängsten, Schuld- und Schamgefühlen. Dies ist ja deutlich genug zu erkennen, wenn man nur hinsehen möchte.
So schließt Freud, etwa in seinen „Studien über Hysterie" (1895, 288 ff) auch in seiner Theorie von „Schichten" und „Kernen", 291 ff, „konzentrisch um den pathogenen Kern geschichtet", S 292), immer die – angebliche oder tatsächliche - Genese in der Kindheit ein, die dann offenbar in Kernen und Schichten geronnen sei („Gruppierung (von) Erinnerungen" S 292).
Entsprechend schwer sei an diese Kerne und Schichten therapeutisch heranzukommen.
Freud hat sich hier also eine Ordnung in der Ablage von Erinnerungen ausgedacht, die dann auch in der Analyse zu beachten sei, nämlich in wachsendem „Widerstand". - mit zunehmender „Tiefe" („Kerne" wie bei Obst am tiefsten).
Es gebe eine „Verknüpfung durch den bis zum Kern reichenden logischen Faden", und diesen Faden zum Kern zu verfolgen, sei eine „Rösselsprungaufgabe" (S. 293). Freud versucht es hier also mit List, - erfolglos.
Mit List erfolglos, greift Freud in seinen Gedanken nun zur Gewalt.
Er bedauert, dass „sich unsere pathogene psychische Gruppe .. nicht sauber aus dem Ich herausschälen" (!) lässt (S. 294) und man noch nicht soweit sei, die „pathogene Organisation, die sich wie ein Infiltrat verhalte, zu „exstirpieren"(!) (S. 295).
Man müsse „den Widerstand zum Schmelzen (offenbar durch die bereits bekannte Galvanokaustik, Elektrokoagulation, wie ein Chirurg, Verf.) bringen" und „so der Zirkulation den Weg in ein bisher abgesperrtes Gebiet ..bahnen" (S. 295). um gründlich aufzuräumen mit dem Pathogenen, einem „Denkobjekt" (S. 295), unter dem er offenbar das versteht, was man heute als Wunsch-Abwehr-Konfiguration bezeichnet, genauer das Konglomerat aus libidinösen und aggressiven Wünschen, Ängsten, Schuld- und Schamgefühlen und Abwehrformen.
Eine weitere Gewaltphantasie (von Zerquetschung, Verf.) Freud folgt auf dem Fuße: „Wie kam ein Kamel durch ein Nadelöhr?.. „ wenn man ...(einem Dritten)..diese pathologische Organisation „zeigen könnte" (S. 295).
Auch seine „Druckprozedur" (so S. 296 ff), die er zur Therapie anwendet, ist nicht gewaltfrei.
Ob Freud hierbei nur die Vorstellung des losen, besänftigenden Handauflegens hatte, wie oft angenommen (weil der Gedanke an Aggressivität in Freud selbst den Nachfolgegenerationen zu unangenehm war), ist fraglich. Wahrscheinlicher ist es, dass in ihm die Vorstellung von Druckausübung wirksam war, um mit dem „Widerstand" (S. 295) des Kranken wetteifern zu können ( „ ..durch Drücken einen neuen Weg eröffnet hat...(den) der Kranke ohne ...Widerstand.. fortsetzen wird").
Letztlich geht es dabei um die Frage, vor was oder wem der Patient mehr Angst hat, - vor seinem Verdrängten oder vor dem Therapeuten Freud.
Freud hofft hier deutlich, dass er mit seinem „Druck" die Partie gewinnt („..durch Anwendung der Druckprozedur ...Widerstände überwindet", S. 296).
Die pathologische Organisation muss nach Freud vernichtet werden, entweder durch List oder durch Gewalt.
Entsprechend gilt für Freud für sein Verständnis der inneren Vorgänge in den Patienten: „...wenn der Kranke (die pathogene Erinnerung) ..verstümmeln (!) will" (S. 295) und therapeutisch: „ „.(das) pathogene(s) Material(s) wird .. durch eine enge Spalte gezogen...., , in Stücke und Bänder zerlegt (!)", S. 296), „Schicht(e), in die man nicht eindringen kann" (S. 307) .
Freud zeigt hier nebenbei, dass er einen so ungezwungenen Zugang zu seiner Aggressivität hat wie heute wohl kein analytischer Autor.
Hierzu sei auch an Freuds herabsetzende Äußerungen gegenüber Frauen als Patientinnen erinnert (Eickhoff, F.-W. 2001, 43-72, Krill 2008, 2014: Rezension, - Freud: „Suppenlogik mit Knödelargumenten").
Freud nimmt seine mit seiner Tochter Anna Freud später besser ausgearbeitete und mehr betonte Abwehrlehre vorweg: „Es ist ganz aussichtslos, direkt zum Kerne der pathogenen Organisation vorzudringen." Dies heißt nichts anderes, als dass man zuerst die Abwehr zu behandeln hat.
Wenn der Analytiker die Abwehr missachtet und statt dessen, wie bis heute immer noch weitgehend üblich, den Patienten über seine verdrängten Inhalte „aufklärt", ist nichts gewonnen, will Freud sagen. („Könnte man diesen Inhalt) „ ..erraten, so würde der Kranke doch mit der ihm geschenkten Aufklärung nichts anzufangen wissen und durch sie nicht psychisch verändert werden", S. 296).
Dies entspricht zusammengefasst der heute unbestrittenen Erfahrung, dass Erklärungen, etwa zur Genese der psychischen Störung, keinerlei therapeutischen Erfolg zeitigen.
Der Erfolg stellt sich erst nach Deutung der Abwehr ein, denn dann kommt der Patient selbst auf dass Abgewehrte, erlebt seine Motive selbst, lernt dies damit verbundenen unguten Emotionen zu ertragen und kann somit seinen inneren Konflikt lösen und seine Abwehr mehr oder weniger aufgeben (..„es fallen ihm jetzt (von selbst) eine Fülle von Reminiszenzen ein.....die Darstellung des Kranken klingt wie vollständig und in sich gefestigt", S. 297).
Weiter schreibt Freud (S. 298): „...verborgener unbewusster Motive...dort zu vermuten, wo ein solcher Sprung (auftritt)"..... „Lücken in der Darstellung"(S. 299).
Freud spricht hier von der Abwehr insbesondere durch Vermeidung, weiter zu sprechen.
Freud machte hier auch eine weitere Abwehr im Patienten aus:
Der Patient verspürte eine nur scheinbare Entlastung von seinen inneren Konflikten. Es handelt sich um das, was Freud in den Studien über Hysterie (1895, S. 303) das „Sich freier fühlen" bezeichnete: „..alles Interesse.. in die Stunden der Behandlung zu verlegen, und sie beginnen dann, sich in der Zwischenzeit freier zu fühlen".
Freud hatte bereits bei seinen Patienten erkannt, dass es sich nur um eine Verschiebung der Konflikte in die Sitzungen bei ihm handelte, das Gefühl der Erleichterung also nicht von Dauer sein konnte.
Eine Deutung dieser Abwehrformen führt dazu, dass der Patient selbst sein Abgewehrtes erkennen und vor allem fühlen kann („emotionale Einsicht"). Heute kann man klarer sagen: Der Patient kann selbst auf sein Abgewehrtes kommen und es nach und nach voll erleben (fühlen) und sich so daran gewöhnen und dann seine Angst davor (und Schuld-und Schamgefühle) und seine Abwehr dagegen aufgeben.
Aus dem gleichen Grunde dürfte Freud seinen Patienten das „Mitsprechen der Symptomatik" während der Stunde empfohlen haben (S. 303) und von einer „psychischen Beleuchtung" (S 306) sprechen.
Hier ist zu ergänzen, dass der Patient selbst diese Beleuchtung vornehmen kann und soll, nach Deutung der Abwehr.
Hierdurch rührt der Patient ja an den gesamten Konflikt, d.h. an sein Symptom, an seine Abwehr und an die erwähnten abgewehrten, unangenehmen Gefühle, gewöhnt sich somit an den gesamten neurotischen Komplex.
In der Sache muss Freud immer wieder resignieren: „Dies vermag Psychotherapie heute nicht" (S. 295).
Aber stets sieht sich Freud dabei noch als ein aktiv Vorgehender, ohne dass keine Analyse zustande käme ( S 299: „..bahnt sich durch die Druckprozedur von da aus den weiteren Weg"... „sich ins Innere durchzuarbeiten", „besiegen"... „den Faden verfolgt hat"... „man lässt ihn fallen, um eine anderen Faden aufzugreifen... „den bevorstehenden Widerstand von neuem anzugreifen" ... „man drängt sich ein".
Hier wieder deutlich, wie aggressiv sich Freud bei seinem Vorgehen fühlt (S 299). Freud will dann „an der Miene des Patienten ablesen" können, ob er richtig dabei liegt.
Auch greift Freud immer wieder zum „Erraten" ... dass ich richtig geraten hatte" (auch S. 300) von Abgewehrtem, was Gray als Umgehung der Abwehr und Zurückfallen auf das topographische Modell ansieht und Krill (2008, 2014) als „bloßes Ratespiel, Anglerglück" unter Missachtung der Abwehr im Patienten brandmarkt.
Immerhin erkennt schon Freud, dass „ein sicheres Besserwissen" im Patienten (S. 300) vorliegen kann.
Wie erwähnt, erkannte Freud die Zwecklosigkeit der Absicht, die Abwehr umgehen zu wollen (... „man nicht imstande ist, dem Kranken über die Dinge, die er angeblich nicht weiß, etwas aufzudrängen", S. 300)
Auch nach Auffassung der modernen Abwehrlehre bahnt sich der Patient selbst den Weg, nachdem der Analytiker die Abwehr anspricht und hartnäckig bearbeitet.
Aber immer bleibt Freud bei seiner Auffassung, dass es darauf ankomme, Erinnerungen (Reminiszenzen") zu wecken oder diese wieder bewusst zu machen („Reproduktion der Erinnerungen", S. 300, „Reminiszenz heraufbefördert", S 307).
Er ist unermüdlich hinter „Erinnerungsresten affektvoller Erlebnisse und Denkakten" her (S.302).
Seine Sehrichtung ist die nach hinten, und diese Auffassung hat sich bis heute in der Psychoanalyse und in dem, was Andere in ihr sehen, gehalten.
Der prospektive Gesichtspunkt ist fast nicht vorhanden, bis heute. „Regression" wird angestrebt und angenommen und dabei übersehen, dass es sich um Abwehr in der Gegenwart handelt.
Nur vergangene Konflikte werden angegangen, nicht zukünftige, die zu erwarten sind, wie z. B. nach zukünftiger Eheschließung, Partnerschaften, beruflichen Auseinandersetzungen, die unvermeidlich oder auch vermeidlich sind etc.
Diese Einseitigkeit hat sich bis heute gehalten (s. hierzu die Kritik von Shapiro (1981: „verantwortungsloses Wettrennen nach immer früheren Positionen", und Werner 1940)
Entscheidender ist aber, dass Psychoanalyse bis heute nicht über diese unreflektierte Abwehr durch Verschiebung auf die Kindheit hinweggekommen ist, also nicht als historisches Faktum getrost bei Freud belassen wurde, als eine Art Marotte.
Das Schwerfällige, das Einseitige, im Verhältnis zum Aufwand nicht genügend Erfolgreiche der Psychoanalyse und das übermäßig Schulmäßige ist auf Freuds Gedanken von der Gründlichkeit der „Seelenzergliederung" (Thomas Mann in „Zauberberg") zurückzuführen, die mit deutscher Gründlichkeit am – vermeintlichen oder tatsächlichen- „Ursprung" beginnen müsse.
As a side note I would like to mention the danger of onesided preoedipal viewpoints. Emphasizing the wishes and anxieties of early mother-infant-relations is not a new development, not a new discovery, not an exceptional achievement as often falsely suggested, but for long times discussed, beginning with Freud, Anna Freud, M. Klein and many other analysts. What’s about later born conflicts of oedipal, juvenile and adult times? Are all that only mother- infant- conflicts? Are these really in their current accentuation more than a worldwide temporary fashion, as in the past so often in psychoanalysis? I would like of bringing to mind the apparently now forgotten defences of displacement, of negation, idealization of trends, etc. , off the present conflicts to earlier conflicts in analysts and patients too (making evasions, elusions, avoidances, eschewing the disagreeable points of adult life, - "the trend is your friend"). In my experience analysis of present conflicts is painstaking, troublesome, difficult (and very successful), and I am impressed, but not astonished by the many evasive maneuvers to be not confronted with them. Convenience is lurking overall, nobody is free that from.
In this way present aggressive and present violent erotic conflicts are hold out of analytic work in Here and Now, and both, analyst and patient, feel lucky, because the very heavy conflicts are not in the view of transference-countertransference. Both are spared that from.
Namely the reducing (often routinely in such a way minimizing the task) of powerful, vehement erotic feelings of an adult woman as mere love to her mother and so on is seldom appropriate, rather shallow and sometimes offensive ("Should I be only a child? Didn’t you see, that I am a adult woman with all female attributes? Did you anytime look at me?" (Eickhoff 2001, citing Freuds misogynic, scorning, contemptuous, demonstrating revulsion, relegating them into the kitchen, alluding to their breasts, not well known uttering against these females, cit. in Krill 2008: "Suppenlogik mit Knoedelargumenten", Krill 2014: Rezension). Such evasions by analysts are rightly refused by these female patients. There is at all in psychoanalytic tradition a tendency, to pathologisize and infantilisize the adult sexuality and in this way to devalue (Krill, 2008, 196-197). In one case the analyst (cited by Krill 2014: Rezension) asserted to her, her erotic feelings being only urethral-erotic ones, reawoken from childhood. Some female patients obey in this point to their analysts in a false way and agree only out of compliance. The secret motives for denigrating and derision are fears and envy, both unreflected.
Regularly another fallacy is involved here: Confusion between deepness and time table in psychoanalysis. To be early in the time is falsely equated with "deep" and pivotal, later conflict / developments are waved aside and called superficial, not eminent and not essential, mostly these remain even unmentioned. Every inner conflict followed by symptoms merits analytic treatment.
Really there are many common features between transference induced love and normal love (zit aus Krill 2016 Brief an die Japanische Psychoanalytische Gesellschaft (JPS).
An diagnostischen Verfeinerungen, einschließlich z.B. Kernbergs gut klingenden, vornehmen, exakt vermessenen Abstufungen von verschiedenen Konfliktniveaus (primitiv, tief, - mittel, - hoch, archaisch, unreif, ödipal, genital, reif) fehlt es in der Psychoanalyse ja nicht, hingegen sind diesen gegenüber die tatsächlichen therapeutischen Möglichkeiten weit zurückgeblieben, besonders, wenn man den Aufwand in Rechnung stellt. Ein Schelm, wer denkt, mit diagnostischen, hübsch aufgemachten Tricks wolle man ablenken von tatsächlicher Unfähigkeit, wenn es darum geht, aus diesen therapeutischen Gewinn zu schlagen. Hic (auf therapeutisch-praktischem Feld) Rhodos, hic salta! Die diagnostischen Feinheiten haben sich von den therapeutischen Möglichkeiten abgekoppelt, - sie haben den Charakter von Heilsversprechungen eingenommen, die nicht eingelöst wurden und mit den jetzigen, analytisch-üblichen Mitteln auch offensichtlich in Zukunft nicht eingelöst werden können. Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Große Worte ohne Taten.
Auf das Erstgespräch oder irgendeine Eröffnungsszene ist man ohnehin zur Diagnostik nicht angewiesen. Wie bereits früher erwähnt (Krill 2008), ist schon grundsätzlich nicht einzusehen, warum gerade die Eröffnung so herausragend wichtig sein soll, - es sei denn, man hat nichts Anderes. Inszenierungen gibt es in jeder Stunde aufs Neue, in Hülle und Fülle, und ebenfalls von beiden Seiten.
Ein nicht weniger gewichtiger Einwand gegen die Überbewertung des ersten Gesprächs, der Anmeldungsweise u. ä. ist der, dass die darin enthaltene Abwehr (immerhin erwähnt von Kipphan 2012) in Art und Ausmaß nicht abzuschätzen ist. Vor allem, und das ist der dritte Einwand, stimmt nachdenklich, dass es vielfältiger Überlegung bedarf, das Erstauftreten des Patienten auf diese Weise zu verstehen. Wir können uns weit schneller und besser auf unser Gefühl verlassen. Wir fühlen auch ohne Inszenierungskonzept, Szene hin, Szene her, was der Patient mit uns anstellen will und - was nicht unbedingt das Gleiche ist – welchen inneren Konflikt und welchen Behandlungsplan (Sampson & Weiss 1972-1982) er ungefähr hat. Ist nicht gerade das unmittelbare Mitfühlen (d. h. unter Ausschaltung komplizierter Überlegungen) (s. o.) in der Psychoanalyse en vogue? (Dantlgraber 2012 s. o., Markert 2012 s. o.), und dieses keineswegs nur im Erstkontakt, sondern in jeder Sitzung? Was soll denn nun gelten?
Gruppen-Ich, Gruppen- Überich, Angstgefühle und Schuld-und Schamgefühle der Gruppe, Gruppenabwehr (Gruppe analog der Struktur des Einzelnen), so nach Argelander besonders Idealisierung, Projektion, Identifikation, Regression, und schließlich die „Gruppendeutung" und Gruppenübertragungsdeutung, d.h. Deutungen, die an die ganze Gruppe gerichtet wurde. Bion sah die Gruppe von „gemeinsamen unbewussten Phantasien" gelenkt (z. n. Gerlach 2012, 118).
Hier sind Bion und Argelander m. E. einem Missverständnis erlegen. Gewiss haben die Gruppenmitglieder oft die gleichen Ängste, Schuld- und Schamgefühle und Abwehren, und gewiss haben sie auch ähnliche oder sogar gleiche Erlebnisse gehabt, haben auch gleiche oder ähnliche Erinnerungen, haben viele gleiche oder ähnliche Übertragungen auf den Leiter der Gruppe und untereinander. Bei der außerordentlichen Ähnlichkeit der Menschen untereinander ist dies auch nicht anders zu erwarten. Dennoch ist es irreführend, zu behaupten, die Gruppe habe gemeinsame unbewusste Phantasien. Sie haben diese nicht gemeinsam, sondern jeder für sich hat die gleichen oder ähnlichen Vorgänge in sich, weil wir uns so ähnlich sind.
Dies ist deshalb wichtig zu betonen, weil sonst die Gruppe i. S. eine Reifizierung zu einem Einzelwesen idealisiert bzw. dämonisiert wird, das eigenen Gesetzen gehorche, eine eigene Vorgeschichte mit Primärpersonen hätte, eigene Abwehren entwickle, eine eigene Übertragung (und Gegenübertragung auf den Therapeuten) entwickle.
Dem Gedanken, die Gruppe trete wie ein Einzelwesen auf, kann auch eine Gegenübertragung des Therapeuten i. S. seines Gefühls der Hilflosigkeit zugrundeliegen. Er ist nicht mehr in der Lage, von den einzelnen Gruppenmitgliedern die einzelnen zu unterscheiden, - weil sie sich außerordentlich ähneln. Verhängnisvoll dürfte die Überforderung es Therapeuten und der Patienten sein: Mit dem Eingehen auf die Voten der einzelnen Teilnehmer hat der Therapeuten schon seine liebe Last, diese zu verstehen und die Abwehr in ihnen zu erkennen und zu deuten. Dies auch noch über die Gruppe zu tun, dürfte ihn überfordern (Tausendfüßlerproblem!). Auch der einzelne Teilnehmer müsste dann noch aus der pauschalen Gruppendeutung das für ihn in Frage kommende herausfiltern, und dies auch noch mit Übertragung und seiner Gegenübertragung auf den Therapeuten und auf die anderen Mitglieder der Gruppe, sowie ebenfalls auf die Gruppe „als Ganzes". Wer die Gruppe zum Empfänger von Deutungen zu machen versucht, verleugnet die Komplexität des Geschehens und das völlige Auseinanderfallen der Gruppe nach Beendigung der Gruppenanalyse und betreibt außerdem Selbstidealisierung (Selbstüberschätzung in seiner Möglichkeit, eine Deutung zu finden, die für die Gruppe passt, Selbstüberschätzung aber auch darin, zu glauben, dass die Gruppe bzw. die meisten Gruppenmitglieder von einer „Einheitsdeutung" profitieren können, Selbstüberschätzung auch darin, dass er glaubt, zugleich dem Einzelnen gerecht werden zu können).
Die Anzahl der Variablen, die er aufgreifen soll oder kann, ist dadurch nur noch mehr unübersichtlich geworden, was die Entscheidung darüber noch schwieriger macht, als sie es ohnehin schon ist (Entscheidungstheorie). Wenn er sich dazu in der Lage fühlt, ist an eine narzisstische Selbstüberschätzung (Selbstidealisierung auf Kosten der Patienten) zu denken. Was hat sich da der Gruppenanalytiker nicht alles aufgepackt, und den Patienten ebenfalls noch zugemutet.
Zudem würde der Therapeut so den einzelnen Patienten vernachlässigen. Dieses ist nur wegen sich selbst gekommen, nicht wegen der Gruppe oder wegen des Therapeuten. Ob aber er aus einer Gruppendeutung wirklich Gewinn für seinen Gesundheitszustand ziehen kann, ist sehr fraglich, und wenn, müsste er dafür auf eine Deutung, die auf ihn zugeschnitten ist, verzichten.
Eine Gruppendeutung steht ja nicht für sich allein, sondern in Konkurrenz mit anderen. Sie muss sie sich in ihrem Wert messen lassen an Deutungen, die sich primär an eines der Mitglieder der Gruppe wenden und von denen die anderen Mitglieder regelhaft ebenfalls Nutzen ziehen können.
Zudem sind Deutungen an eine ganze Gruppe notwendigerweise guruhaft, weise, entrückt, abstrahiert, und dies ist wie Weniges geeignet, die abträgliche Idealisierung des Analytikers durch die Patienten zu fördern.
Statt des Begriffes „analytische Identität" sind besser Begriffe wie „Identitätsgefühl", „Selbstdefinition", „Selbstverständnis", zu verwenden, denn allein diese beziehen sich auf die seelische Befindlichkeit und die Selbsteinschätzung, mit der wir es als Therapeuten zu tun haben. Für „Identität" ist die Psychoanalyse nicht zuständig, da es sich um einen soziologischen Begriff handelt, i.S. einer Personalie. Für Identität sind Rathäuser, das Einwohnermeldeamt, die Polizei mitsamt Verkehrskontrollen und mitsamt Personalausweis und der Reisepass, Statistiker, Staaten und Gemeinden, Kirchenämter, kurzum listenführende Verwaltungen zuständig. Das „Identitätsgefühl" des Psychoanalytikers hingegen umfasst nicht nur das berufliche Können des Analytikers (so aufgefasst von Markert 2012, 177), sondern bedeutet das emotional getragene Selbstverständnis, welches das bisherige und zukünftige Leben als Entwurf, die eigenen Wünsche, Ängste, Schuld-und Schamgefühle, Abwehrgewohnheiten und Symptombildungen sowie die berufliche Entwicklung einschließt (Verf. hier 2014), und so, nämlich als Identitätsgefühl, war der Begriff Identität auch von Erikson gemeint.
Das Nachteilige am Begriff „psychoanalytische Identität" ist zudem eine gewisse unreflektierte Haltung der Arroganz gegenüber den Vertretern anderer Therapieformen. Ein Verhaltenstherapeut ist klug und bescheiden genug, nicht von verhaltenstherapeutischer Identität zu sprechen, obwohl auch er mit seiner Person arbeitet. Ein Lehrer spricht nicht von seiner Lehreridentität, der Handwerker nicht von seiner Handwerkeridentität, - obwohl auch diese nicht weniger ein berufliches, emotional getragenes Selbstverständnis (Verf.2013) aufweisen. Wir lieben es nicht, wenn jemand zu sehr seine religiöse „Identität" hervorhebt. Dass in analytischen Kreisen dauernd dieses Wort auftaucht, sogar das Wort „Identität unseres Psychoanalytischen Instituts", die gegen die (unausgesprochen „bloße") tiefenpsychologische, hausinterne Ausbildung verteidigt werden müsse, dürfte andere, emotionale Gründe haben (Unsicherheit und Suche nach Überlegenheit? Abwehr durch Vermeidung, Abschottung. Die „geheiligte Institutsidentität", die auf keinen Fall in Mitleidenschaft gezogen werden dürfe, - als ob es sich um eine Person handele. Daran, dass Konkurrenz das Geschäft hebt, also eine Win-Win -Situation entstanden ist, .wird wenig gedacht). Wir sollten den Begriff Identität für uns nicht mehr verwenden, sondern in unseren psychischen Bereich verbleiben, und zudem unterscheiden zwischen (stillschweigendem) Identitätsgefühl und dem Bedürfnis, dauernd damit anderen Leuten - notorisch bis querulatorisch - in den Ohren zu liegen, sozusagen darauf zu pochen.
Vor allem aber sollten wir bei unserer z. Z. sehr betonten „Identitätssuche" nicht übersehen, wie abträglich diese Verschiebung der Aufmerksamkeit auf uns selbst für die psychoanalytische Therapie sein muss. Es geht uns oft viel zu sehr um uns selbst, statt um den Patienten. Auch bei der Identitätssuche nach uns selbst handelt es sich um eine Ausflucht, - vor der schwierigen Patientenbehandlung.
Bei all diesen Begriffen (wohl auch dem Handlungsdialog), die cum grano salis alle das gleiche Konzept beschreiben, handelt es sich um nichts Anderes als einen verkappten, nur damals noch nicht so benannten, „intermediären Raum", um den sich nun alles drehen soll. Der Begriff „intermediärer Raum" wird unreflektiert verdinglicht (reifiziert) benutzt, als ob es dabei nunmehr um einen Patienten „der dritten Art" ginge, mit einem Eigenleben und eigenen Gesetzen, und sowohl der Patient wie auch der Analytiker fast außen vor sind und für nichts mehr eigenverantwortlich. Das „Forschungsfeld" und die immer wieder verschieden genannten „Räume" , auch „Zwischenfelder" u. ä. genannt, sind es nun, die Gegenstand einer Therapie sein sollen, nicht mehr der Patient. Dass in diesem Forschungsfeld Patient und Analytiker enthalten sind, ist geschenkt.
Dem gleichen, ebenfalls unreflektierten Zweck dient auch die übermäßige Befassung mit der Auffaserung der Groß-Diagnostik (endogen depressive Psychose mit phasenhaftem Verlauf und im allgemeinen guten Ansprechen auf Thymoleptica, schizophrene Psychosen (einschließlich schizoaffektiver Psychosen), Psychosomatische Erkrankungen, Neurosen, in immer feinere Unterdiagnosen. (etwa nach ICD10).
Damit, d.h. mit dem Aufkleben zahlloser Etiketten sowie den endlosen, intellektualisierenden Diskussionen, die wiederum ungünstige Auswirkungen auf die eigene therapeutische Tätigkeit hat , weil sich hier Intellektualisierungen zwischen Therapeut und Patienten schieben (auch wenn sie natürlich zur groben Verständigung und für schriftliche Äußerungen über den Patienten notwendig sind), entfernt man sich vom Patienten, - weil es so schwer ist, ihn zu verstehen und zu behandeln und man nicht bereit ist, sich selbst bei der Behandlung zu vergessen.
Statt sich mit den Feinheiten der Unterdiagnosen nach der ICD-10 (zum Glück betreiben dies Psychoanalytiker am wenigsten) und der – tatsächlichen oder vermeintlichen – Biographie (und sich daraus ergebenden Gewimmel an Informationen (Verf. hier 2014) oder anderer Selbstablenkungen des Patienten - zu beschäftigen und sich darin ständig zu verbessern, könnte man sich in derselben Zeit auch in der Sache selbst, d.h. mit dem Innenleben der Patienten, weiterbilden.
Ein guter Therapeut kommt dem Patienten in wirklicher Hingabe ganz nahe. Er ist mit einer extremen Aufmerksamkeit, man darf auch sagen, mit Begeisterung, beim Patienten und nicht so sehr bei sich. Ohne Begeisterung kommen keine besonderen Therapieergebnisse. Ohne Begeisterung kommt ja auch sonst wenig zustande, so etwa in Gesang, Tanz, Malerei, Film, Theater (wo man mit dem eigenen Körper arbeitet), Schriftstellerei. Sich vergessen heißt, dass man wie ein Handwerker ganz bei der Sache, also bei dem Patienten sein muss, und seine Person außen vor lässt, auch wenn sie ein oder sein Behandlungsinstrument ist. Vielleicht, wenn ein Vergleich gestattet ist, wie ein Hauch den Patienten hautnah rundum umgibt und dabei keineswegs in ihn eindringt oder mit ihm verschmilzt, aber sich selbst auf eben
diesen Hauch reduziert.
Ein Handwerker stellt ebenfalls seine Person ganz zurück, auch wenn er natürlich mit ihr arbeitet. Was würde man sagen, wenn dieser sich als „Handwerker-Identität" vorstellen und darüber langatmige Ausführungen machen würde, statt einfach seine Arbeit zu machen?
Entscheidend abträglich für eine Psychotherapie / Psychoanalyse ist die Verlagerung des Schwerpunktes der Aufmerksamkeit vom Patienten weg (wie auch, wenn auch wohl geringer, aber nicht weniger unbedacht vom Analytiker weg) bei all diesen erwähnten Vorgängen und Thesen auf Patientenfremdes. Dazu gehören gewiss unreflektierte Anleihen aus der Soziologie, Philosophie und akademischen Psychologie.
Patient wie Analytiker sind sich hier einig wie selten, können sie doch so die Analyse von unangenehmen Affekten und Abwehren einträchtig, in Kollusion, vermeiden. Den Schaden hat der Patient, während sich der Analytiker zurücklehnt und sein Forschungsfeld genießen kann.
Es handelt sich bei diesen Vorstellungen um einen unreflektierten Zeittrend, dem sich niemand entzieht und der die Kongresse, die Falldarstellungen, die Arbeit in den Ausbildungsinstituten, vielleicht auch die Lehranalysen, beherrscht. Man schwimmt einfach mit. Wer Karriere machen will, kann es nur mit diesen Themen.
Hand in Hand damit geht die Überbewertung (und die Ausdehnung des Begriffs) der Gegenüberragung unvermindert weiter. Die Gegenübertragung wird trendhaft („The trend is your friend". – ist er das wirklich? nach außen ja, für Opportunisten ja, für Freunde der Karriere ja. Sonst gilt: Trends machen dumm.) immer noch als einziger Schlüssel für das Verständnis des Patienten idealisiert. Tatsächlich führt aber diese Idealisierung dazu, dass man sich nicht selten tatsächlich weiterhin von der Therapie des Patienten solipsistisch mehr abzuhalten als sich ihr zu nähern versucht.
Hier wird weit mehr imitiert als kritisch nachgedacht, und oft ist die bloße Anpassung („compliance", „ stille Unterwerfung") an den Denkstil und Sprechstil einer psychoanalytischen Gemeinde mit dessen spezieller, leicht durchschaubarer Gruppendynamik (s. Krill 2008, „schlammige Situation") nur von außen erkennbar.
Bisweilen steht z.B. ein besonders denkintensives, viel Zeit erforderndes, vorsichtiges, taktierendes, z.T. auch intellektualisierendes, d.h. vom Gefühlsgehalt einer Stunde abkommendes Entwickeln von Thesen mit viel Verwendung des Konjunktivs und von vielen Wenn und Aber, auch schon mal mit Wortklaubereien, mit gewissenhaften Relativierungen und Absicherungen nach allen Seiten und somit – mangels Angriffspunkten – tendenzieller Verhinderung von Entgegnungen (z.B. wohl teilweise Stil von Rolf Klüwer (Frankfurt, SFI), sowie auch manchmal einem Mangel an klarer Verständlichkeit, der in Kauf genommen wird, im Vordergrund, - i. Ggs. etwa zur Verwendung von kurzen, klaren Sätzen im Indikativ mit wohl mehr Risikobereitschaft, widerlegt zu werden (z.B. wohl Stil von Hermann Argelander. Frankfurt, SFI)
Es geht aber nicht darum, wieweit diese Denk- und Sprechstile von den genannten Personen wirklich dauerhaft und konsequent vertreten wurden und etwa von Anderen nicht. Sie gelten aber immerhin als bekannte Vertreter dieser Einstellungen und sind der Anschauung wegen benannt. Jeder, der diese Analytiker persönlich gekannt hat, versteht noch besser, was gemeint ist.
Es geht nicht darum, einen dieser höchstpersönlichen Stile weniger zu schätzen, denn gewiss haben beide ihre Berechtigung, sondern um das Phänomen der Anpassung, die in ihrem Ausmaß bedenklich erscheinen muss.
Jeder muss in seinem persönlichen Stil sprechen und sprechen dürfen, wenn er sich verständlich machen will. Jeder spricht, so gut er kann, und dies ist eben nur in seinem eigenen, höchst persönlichen Stil möglich. Niemand soll daher versuchen, Anderen seinen eigenen Stil, der zu dem Anderen nicht passt, abzufordern, etwa mit dem Einwand, dessen Diktion sei zu „bestimmt".
Auch gewisse Totschlagargumente kehren immer wieder, nicht selten in rabulistischer Manier (Sophismen, reine Rhetorik, Spitzfindigkeiten, um den Anderen zu diskreditieren, gern verwandt von rhetorisch Geübten). Statt zu fragen, was einen Diskussionsteilnehmer zu seiner Diskussionsbemerkung veranlasst hat, wird gefragt, „woher er dies wisse" („Fangfrage") und ihm ein Wahrheitsanspruch unterstellt, den er nicht geltend gemacht hat und der auch absurd wäre.
Es kommt auch vor, dass ein Analytiker die Fallbesprechung mit einem Satz aus dem Lehrbuch bewertet oder jedenfalls bespricht, ohne zu bemerken, dass diese Bemerkung nicht zu dem Fall passt, und vor allem, ohne dass seine Bemühung zu erkennen ist, eine Verbindung zum Fall herzustellen. Dieser ist hier offensichtlich mit einem vorbereiteten Text gekommen („präfabriziert"), nur um sich selbst darzustellen. Besonders lustig ist es, auf einem Kongress zu beobachten, wie ein Teilnehmer eine Diskussionsbemerkung macht und dann sogleich fortgeht, ohne die Erwiderung abzuwarten. Geht er in den nächsten Saal, um dort das Gleiche zu tun? („Gesichtspflege", „Landschaftspflege").
Übrigens sind heute auf einmal fast alle Patienten „traumatisiert", so wie in den 70zigern plötzlich alle Fälle, auch die Ausbildungsfälle kohutistisch aufbereitet werden mussten, später kernbergerisch, nicht weniger plötzlich. Gleichschaltung fast ohne äußeren Zwang, freiwillig, um in einer Gemeinschaft von Gleichdenkenden aufgehoben sein zu dürfen, - ein wohl universales Phänomen. Heute sind „Traumatisierung" und Empathie-Athletik an die gewollte Leerstelle der Abwehranalyse und der Konflikttheorie eingerückt und möchten aus jedem erwachsenen Patienten mit seiner Erwachsenen- Sexualität und seiner Erwachsenen- Aggressivität ein Kleinkind machen, um der Konfrontation mit der Macht des Erwachsenen aus dem Wege zu gehen. Oft kommt es nicht einmal zu einer Parallelverarbeitung, sondern verbleibt bei Linientreue.
Schafft sich hier die Psychoanalyse selbst ab? Die Hervorhebung des inneren Konflikts durch die Abwehranalyse droht verloren zu gehen. Abwehranalyse wird als „programmhaft" oder „hermetisch" abgetan.
Dabei wird übersehen, dass jede analytische Richtung ein Programm verfolgt und dass die Abwehranalyse weit ergebnisoffener ist als alle anderen Richtungen, da zunächst nur die Abwehr angegangen wird und alles Abgewehrte (frühkindliche Konflikte oder Defizite? kindliche? juvenile? erwachsene?), gleich nach welcher Theorie, dann erscheinen kann, und zwar – ganz entscheidend – aus dem Munde des Patienten.
Hierzu wird auch das Warten auf eine „Reinszenierung" nicht benötigt. Diese tritt vielmehr ständig ein (Wiederholungszwang, - brauchen wir hierzu Begriffe aus der Theaterwelt?), aber die Analyse kann sich nicht auf diese beschränken, sondern kann mit der Abwehranalyse wesentlich aktiver vorgehen.
Wenn Argumente nicht weiterhelfen, wird auch gern mit der „guten Stimmung und dem allgemeinen Sich-Wohlfühlen in der Gruppe und in er Institutsatmosphäre argumentiert, die man vermisse (es war doch immer so schön mit uns, man kennt sich lange Jahre, man hat sich „doch jahrelang so gut verstanden", man weiß, was die anderen denken", - das ist ja das Verheerende). Da kommen Heimatgefühle auf. Ist ein Analytiker etwa zum Sich- Wohlfühlen zu der Gruppe gestoßen? Macht er sich dazu auf den Weg? Er möchte etwas lernen (und man lernt immer) und auch mitteilen, - ein Arbeitsbündnis zum Geben und Nehmen, dies in gegenseitigem Respekt, aber nicht unbedingt einhergehend mit Zustimmung. Man ist nicht Analytiker geworden, um sich in der Gruppe von Analytikern oder einem Institut wohlzufühlen (Ist das Institut eine Wellness –Einrichtung? Soll sie der Kräftigung einer geschlossenen Gemeinschaft dienen?), sondern um sich in ihr, oder zugleich auch außerhalb von ihr, weiterzuentwickeln, persönlich und im Umgang mit den Patienten, in der Deutungstechnik, im Kontakt. Man versucht bisweilen eine Vergällungs-Therapie, um den lästigen Störer loszuwerden, aber auf diese muss der sich ja nicht einlassen.
Besonders müssen Fragen aufkommen, wenn unter „Gegenübertragung" nicht mehr die Reaktion auf die Übertragung des Patienten und dessen Manipulationen der Person des Analytikers (Sandler, Holder, Dare 1973, Klüwer 1983, jeweils zit. n. Markert 2012, S.176) und auf den Patienten überhaupt verstanden wird, so wie es bei der Bildung dieses Begriffes gemeint war, sondern diesen Begriff erweitert und die „philosophische und weltanschauliche Position des Analytikers (Markert 2012, 175) darin mit einschließen möchte. Solches ist wie die bloß lokal üblichen Überzeugungen und seine höchst eigenen Angewohnheiten, Bewertungen, Einstellungen und Bequemlichkeiten aber als Übertragung des Analytikers auf den Patienten und als sein Manipulationsversuch an der Person des Patienten zu bezeichnen und nicht als Gegenübertragung. Das Nichterkennen dieser eigenen Übertragung ist geeignet, vom Patienten und seinem inneren Konflikt zu dessen Schaden abzulenken. Der Analytiker sollte sich über seine eigene Übertragung im Klaren sein, nachdem er deren Abwehr erkannt hat, und seine Weltanschauung nicht zum Maßstab machen. Sondern er muss, soweit möglich, von diesen absehen und danach sehen, was im Patienten vorgeht. Dass dies nicht so leicht zu bewerkstelligen ist, ist ein anderer Umstand, doch dieser enthebt uns nicht der Verpflichtung, sich möglichst auf den Patienten zu konzentrieren, jedenfalls Anderes, schon gar nicht uns selbst, nicht zum Programm zu erheben. Es ist ein Unterschied, ob uns etwas unterläuft, oder ob wir dies zum Programm machen.
Diese Thema zusammengefasst: Die genannten „Zwischenräume" und die Verehrung der Gegenübertragung und die Erweiterung dieses Begriffs um die eigene Übertragung des Analytikers haben eines gemeinsam: Sie wollen vom Patienten wegführen.
Es handelt sich bei diesen Entwicklungen um großangelegte Fluchtbewegungen, vom Patienten und seinen Anliegen weg zu sich selbst, dem Therapeuten, - eine Phobie vor dem Patienten und seinen Krankheiten, die uns ja tatsächlich auch die Arbeit machen, aber zum Unwort geworden sind. Krankheiten soll es schon lange (ICD10 !) nicht mehr geben, nur noch Störungen, aber auch keine Patienten mehr, sondern nur noch Klienten, d.h. Kunden (d.h. sich nur zum Einkaufen in Psychoanalyse begeben, - so will es anscheinend die Psychoanalyse selbst haben, indem sie aus dem Patienten, aus dem Leidenden, einen möglichst rasch einkaufenden und möglichst rasch wieder weggehenden „Kunden" macht, damit sich der Psychoanalytiker nun endlich wieder sich selbst zuwenden kann), so besonders konsequent bei Yalom (2013), oder jetzt (2014) nur noch „Räumen" oder „dem Dritten" oder „Präsenzen", die „mit dem dritten Ohr" zu behandeln seien.
So ist es zu einer Vernachlässigung unserer therapeutischen Aufgaben gekommen, was nun auch zunehmend den Leistungsträgern missfällt und deren Geduld strapaziert. Die Versicherungen werden sich pflichtgemäß auf ihre Aufgaben besinnen und künftig genauer hinsehen, wieweit überhaupt noch Krankheiten behandelt werden oder etwa nur noch Vorgaben der analytischen Ausbildung (2 Behandlungs- Fälle von mindestens 300 Sitzungen, mit wöchentlicher Supervision) abgearbeitet werden. Diese 300 Sitzungen, so notwendig und zweckmäßig sie auch oft unbestritten sind, wie auch die Hochfrequenz, sind aber auch außerhalb der Ausbildungssituation nicht selten zur unreflektierten Norm (die Hochfrequenz nicht mehr im bisherigen Maße) und jedenfalls zur Höchstzahl an kassengenehmigungsfähigen Stunden geworden (warum gerade die magische runde Zahl von 300? Wer will das ausgerechnet haben und wie?), wohl nach dem Motto: „Mehr hilft mehr", worüber sich schon Watzlawik mokiert hat.
Das Motiv für diese Phobie ist in der Mühe der therapeutischen Aufgabe zu sehen, konsequent und konzentriert die symptomrelevanten inneren Konflikte zu behandeln und so eine Symptomerleichterung zu ermöglichen.
Dies gilt für viele Therapeuten, aber auch für nicht wenige Patienten. Nicht jeder ist gewillt, präzise zu arbeiten. Angst vor Genauigkeit ist weit verbreitet, dementsprechend überwiegt die Neigung zum Ungefähren.
Nicht zufällig möchten sich nur wenige Menschen intensiv mit Schachspiel, Uhrmacherhandwerk oder Mathematik beschäftigen, auch wenn dem nicht etwa ein Mangel an Begabung entgegensteht.
Daher sind nicht alle Therapeuten und nicht alle Patienten für diese Therapie geeignet bzw. bereit, - was allerdings auch für andere Arten von Psychoanalyse gelten mag.
Das Resultat ist eine immer weitere, vor allem emotional immer kühlere Entfernung vom Patienten und seinem Anliegen zugunsten von Veranstaltungen, Ansprachen, Vorträgen von 90 Minuten unter Vermeidung von wirklicher Diskussion, für die keine Zeit eingeräumt wird, Kongressen, workshops, Seminaren und unzähligen Zeitschriften und Büchern, der – gewiss notwendigen – Verwaltung von Vereinen und Supervereinen, nebst ausgefuchsten analytischen Idiomen, die nicht selten die Verbindung zum Patienten und dessen klinischen Beschwerden und Symptomen und überhaupt zu Krankheiten vermissen lassen.
Die grassierende Prokrastination lässt grüßen. Sie hat nicht nur viele Patienten, sondern auch viele Therapeuten erfasst, unterstützt von der Ideologie einer zwangshaften „Gründlichkeit" und der Suche nach letzten Wahrheiten, hinter der klinische Besserung zurückzustehen habe.
Abwehranalyse gibt sich mit der Bearbeitung des inneren unbewussten Konflikts zufrieden und legt auf letzte Wahrheiten keinen Wert.
Hierzu der einsame Ruf eines deutschen Analytikers in den USA auf einer Tagung dort in den 40ger Jahren, zit. von Brenner: „Ach, wie wäre es, wenn man sich einmal nach dem Befinden des Patienten erkundigen würde?", - seinerzeit eine endlose Lachnummer, heute aber durch Brenner (2014) wieder zu Ehren gekommen.
Ich komme im Buch darauf zurück, wie schwer es heutigen Therapeuten oft fällt, zwischen Krankhaftem und Gesundem, Alltäglichem zu unterscheiden, besonders, wenn ihr Studium es ihnen nicht ermöglicht hat, mit Kranken in einem tieferen Sinne umzugehen, sondern es bei virtuellem, allenfalls höchst oberflächlichem tatsächlichem Kontakt, etwa im Rahmen eines Praktikums oder Praktischen Jahres und im bloßen Nachsuchen in der ICD-10, verblieb.
Der zweite Grund hierfür liegt darin, dass eine Unmenge von Material unterschiedslos (Biographie? Übertragung? Gegenübertragung? Aktuelles aus der Außenwelt? Traumen? Träume? Freie Assoziation?) gesammelt wird, sodass der analytische Prozess sich enorm verlangsamen muss, und zwar wegen sich anhäufender Entscheidungs-Schwierigkeiten, was denn aufgegriffen werden soll (Entscheidungstheorie) - bei selbstverständlich ständig weiter erfolgenden Entscheidungen, dann aber notgedrungen willkürlicher Art.
Hier fehlt es auch oft an einem Mindestmaß an Selbstreflexion, die allein Imitation, Gruppendruck, Suche nach bloßer Übereinstimmung mit Angelerntem und mit dem jeweiligen Ausbildungsinstitut und die oft endlosen Intellektualisierungen, der häufigen Berufskrankheit analytischer Therapeuten, eindämmen könnte.
Hält nur die Abwehrtheorie am inzwischen lästig gewordenen Patienten noch fest?
Auf eine durchgängige Systematisierung wurde bewusst verzichtet, zumal diese mit Nachteilen (Erstarrung, Aura von Endgültigkeit, unerfüllbarer Anspruch) verbunden wäre.
Bevorzugt wurde eine Darstellung von Schwerpunkten, die klinisch, auch für das Antragsverfahren bei tiefenpsychologisch und analytisch orientierter Gruppen- Psychotherapie (Krill 2008), bedeutsam sind, auch an verschiedenen Stellen. Der interessierte Leser wird sich zurechtfinden.
Die grundlegenden Gesichtspunkte sind durch andere Schriftgröße und in Fettschrift (was den heutigen Verlagen offenbar als unfein gilt, - sie wählen oft die Kursivschrift in derselben Schriftgröße, sodass der Leser Mühe hat, diese überhaupt zu erkennen) hervorgehoben und leicht zu finden. Die Einzelheiten lassen sich dann leicht im kleiner Gedruckten weiterverfolgen.
Im Mittelpunkt stehen nicht irgendwelche von den zahllosen Konflikten, die wir alle täglich erleben, zu bewältigen haben und auch in der Regel gut überwinden, sondern diejenigen inneren unbewussten Konflikte, die zur Symptombildung geführt haben („symptombedeutsam") und welche die Patienten veranlasst haben, sich um eine Gruppenanalyse zu bemühen, und zwar zu einer, die zeitlich und finanziell überblickbar und zu bewältigen ist, im Ggs. zu manchen Langzeittherapien mit großen, vagen Erwartungen,. nämlich einer Art „Erneuerung von Grund auf", und stillschweigenden Versprechungen, aber immer ungewissem Ausgang und immer gewissem großem Zeitverlust, der wichtige Lebensentscheidungen unabsehbar aufschieben oder sie gar endgültig verhindern kann.
Ein Schelm, wer glaubt, es könnte manchmal das heimliche Ziel sein, Heirat und Nachwuchs endlos zu verschieben und schließlich zu verhindern, etwa auch durch überlange Lehranalysen (Ausbildungsanalysen). „Where are my childbearing years" (Wohlberg J W 1997).
Analyse wird nicht verstanden als ein mehr oder weniger selbstgefälliges, beliebig ausführliches oder beliebig einfühlsames Nachzeichnen innerseelischer (einschließlich sog. intersubjektiver) Vorgänge aus der Gegenwart oder gar aus der „möglichst frühen Kindheit" („race back", „ehrgeiziges Wettrennen Gewissenloser in die früheste Vergangenheit um jeden Preis", - „darf es etwas früher sein?", Shapiro 1981) , schon gar nicht als deren bloßes Benennen, als ob es damit getan sein könnte, d.h. ein innerer Konflikt gelöst werden könnte, sondern als Auftrag, die jetzigen symptomrelevanten innerseelischen Konflikte in den Patienten zu lösen und so eine Symptomlinderung und eine bessere Entwicklung zu ermöglichen.
Analyse wird hier auf das zurückgeführt, was es ursprünglich war: Lösung von unbewussten inneren Konflikten, soweit sie zu Symptomen geführt haben.
Das Buch plädiert für Bescheidenheit in den Zielen und in dem Weg, diese zu erreichen, nämlich solider, handwerklicher Arbeit bereits in der Diagnostik und in der Therapie durch Abwehranalyse.
Dies bedeutet nicht weniger, als dass alle (!) Konfliktkomponenten, als Erstes die Abwehr, dann die Wünsche, darunter vor allem auch die aggressiven, die Ängste, die depressiven Gefühle, die Schuld- und Schamgefühle geduldig aufzusuchen sind (Krill 2008, 2012, 2013). Dies ist sehr lohnend, freilich auch anstrengend und deshalb nicht gerade beliebt.
Neben der Abwehr werden insbesondere aggressive Regungen im Patienten und in den helfenden Personen tabuisiert.
Ein Fuchs oder ein Wolf, wer denkt, manche Analytiker könnten in diesem Sinne eine Phobie vor Abwehranalyse und aggressiven Regungen der Patienten und in sich selbst entwickelt haben und möchten sich lieber Geschichten von Vater und Mutter erzählen lassen oder die verbalen Äußerungen bloß mit anderen Worten wiederholen, diese durch gelegentliche Bemerkungen begleiten und hoffen, dass die Entwicklung von Übertragung und Gegenübertragung und Einfühlung („Empathie" durch Empathieathleten) schon alles richten wird.
Hier handelt es sich um eine desolate Entwicklung der Psychoanalyse, welche zusammen mit gesellschaftlichen Faktoren die Prokrastination fördert, statt deren Abwehrcharakter zu erkennen und diese Abwehr gegen das Erwachsenwerden und die damit verbundenen aggressiven Auseinandersetzungen analytisch anzugehen.
Aggressive Wünsche eines Patienten, wie auch des Therapeuten selbst, sind bereits als solche ein unangenehmes Thema und werden schon deshalb gern vermieden, haben es aber auch schwer, überhaupt noch wahrgenommen zu werden, weil der Begriff „Gewalt" heute gewissermaßen durch Überdehnung und inflationären Gebrauch ausgeleiert ist.
Namentlich die feineren, z. T. unbewussten Formen von Aggression in Form von Obstruktion, Auflaufenlassen, Gruppendruck, verdeckter Meinungsmanipulation, Manipulation und Erniedrigung Anderer werden vernachlässigt oder gar übersehen.
In dieser Beziehung herrscht heute in den helfenden Berufen unprofessionelle Blindheit (Berufsblindheit) vor.
Es ist merkwürdig, dass das Wissen um Abwehrformen und um unbewusste aggressive Motivationen (aggressive Wünsche) und Handlungen ausgerechnet in der Psychoanalyse nicht selten wieder verlorengegangen ist, gewiss nicht theoretisch, wohl aber in der praktischen Durchführung.
Psychoanalyse ist nicht davor gefeit, wieder Erkenntnisse über die Kraft des Unbewussten und der Abwehr einzubüßen (Margarete Mitscherlich, 1973, mündliche Mitteilung) und zu bloßen intellektualisierenden Beschreibungen und Glasperlenspielen mit bloßen Begriffen zu verflachen.
Arbeit an der Abwehr müssen wir keineswegs der Verhaltenstherapie überlassen. Wir können wesentlich mehr bieten: Die Aufdeckung und Bearbeitung auch der unbewussten Motivationen, die Abwehr auslösen, ohne Ausflüchte, wie Ausweichen auf philosophische, - vermeintliche oder tatsächliche - biographische oder künstlerische Gebiete. Und wir müssen dies auch in derselben kurzen Zeit oder in kürzerer Zeit erreichen können.
Wie immer wird hier auf eine präzise Sprache Wert gelegt. Eine verschwommene Sprache, darunter auch oft aus fremden Gebieten entlehnte (s. Krill 2008, 69ff, 75 ff, 82ff, 88ff ,105ff, 335 ff) und nicht immer von Eitelkeiten freie, hat auch ungünstige Rückwirkungen auf den Therapeuten selbst, nicht nur auf die Patienten, somit auf die Therapie.
Wir müssen uns auf unsere Zuständigkeiten (N. Luhmann) beschränken und unsere Arbeit machen („Handwerker", craftsman nach Gray, remeslennik, mastjer), und somit zugleich die Anderer respektieren. Sich so zu bezeichnen zu lassen, dürfte besser sein, als sich von der Behandlung des Innenlebens beider Beteiligten (welches die jeweiligen Übertragungen und Gegenübertragungen mitumfasst und zum Gegenstand hat) zu entfernen und sich etwa nur noch mit sich selbst, seiner angelernten Theorie, der Gehorsamkeit gegenüber seiner Gemeinde zu beschäftigen und sich der Zustimmung („compliance") seiner Kollegenschaft zu vergewissern.
Für das Verständnis einer Stunde kommt es natürlich darauf an, was zwischen Patient und seinem Analytiker abläuft, also wie beide miteinander umgehen.
Eine Verschlankung des großen Gebietes der Psychoanalyse mit seinen mittlerweile recht unscharfen, ausfleddernden Grenzen ist angezeigt, wenn Psychoanalyse nicht ihre Kompetenz für Krankenbehandlung einbüßen soll.
So gesundgeschrumpft, kann sich Psychoanalyse auch besser dagegen wehren, weiterhin als Steinbruch für Sachfremde und Sachunkundige zu dienen und sich so ihrer Substanz entleeren zu lassen.
Diese Ausplünderung wird fälschlich als Bereicherung und angeblich längst überfällige Kontaktaufnahme zu anderen Disziplinen wie Politik, Philosophie (ausschließlich Marxismus), Soziologie, Kunst, Dichtung, Geschichte gedeutet. Umgekehrt wird ein Schuh draus: Heilkunde und besonders Seelenkunde haben Jahrtausende gebraucht, um sich von der Welt der Götter, der Religionen, des Schamanentums, der Pädagogik, des Mönchstums, und der alles erstickenden Philosophie des Altertums und des Mittelalters zu emanzipieren, aber was tut ein Analytiker von heute, der mit seinen Erfolgen nicht zufrieden ist (obwohl er es oft sein dürfte)? Er mutiert zum Philosophen, zum Künstler, zum Empathie-Athleten (Verf.), der sich auf Empathie-Attacken (Verf., hier, 2014) spezialisiert und mit dem dritten Ohr (Theodor Reik 1976, zit. n. Thomä 2012; 63, - ich brauche nur eines, und selbst dieses ist bisweilen überflüssig) das Gras wachsen zu hören glaubt. Dabei wird übersehen, dass wir ohne Theorie ohnehin nichts verstehen. „Auge und Ohr schlafen, bis eine Theorie sie scharfstellt." (Verf. 2014 hier)..
Wir müssen v o r h e r wissen, auf was wir achten wollen. Das, was wir empathisch vom Patienten erfassen, ist weit weniger als das, was unser eigenes Gehirn laufend an Erwartungen aus sich selbst produziert (90%). Die Informationen aus unserem Gehirn-Inneren überwiegen bei weitem die von Auge und Ohr oder Geruch, und auch diese kämen kaum zustande, wäre wir nicht darauf schon eingestellt durch unsere Erwartungen. Pointiert ausgedrückt: Zuerst sind unsere Erwartungen (Prognosen) da, dann finden wir das Erwartete, - Anderes können wir nur schwer erkennen, - am ehesten noch dadurch, dass wir das Ganze einem Anderen berichten, der nicht die gleichen Erwartungen hat wie wir. Deshalb sollten wir nicht zuviel auf unsere „Empathie" geben, denn diese gibt mehr unsere eigenen Erwartungen wieder und nicht so sehr etwas, das im Patienten vorgeht. Kurzum, auch beim Begriff der „Empathie" sprechen wir mehr von uns als vom Patienten. Die Ergebnisse der „Empathie" werden zu 90 % aus unserem eigenen Gehirn erzeugt (Friston, Karl & Picard, Fabienne 2014) und nur in geringen Ausmaß von dem, was uns der Patient verbal und nonverbal mitteilt, zumal auch dieses noch der eigenen selektiven Aufmerksamkeit unterliegt. Daher ist auch verständlich, dass überall auf der Welt inzwischen die Person des Therapeuten als maßgeblich für Verstehen und Therapieerfolg angesehen wird. (zu Erwartungen und Voraussagen, experimentell überprüft, s. auch Mount-Zion-Gruppe (s. Sampson & Weiss 1977 a, b), Weiss (1986, 1995, 1998, 2003)
Wenn wir etwas anderes vorfinden, werden die Erwartungen korrigiert (was mitzunehmendem Alter immer weniger möglich ist, deshalb ist hier bei raschen Veränderungen der Umwelt das jüngere Gehirn im Vorteil), also durch neue, genauere, ersetzt.
Handlungen dienen dazu, die Welt so zu verändern, dass sie mit unseren Voraussagen wieder in Einklang steht und wir am Leben bleiben. Man könnte dies vergleichen mit einem Gang durch eine kunsthistorisch interessante Kirche. Wenn jemand von Kunstgeschichte so gar nichts weiß, wird er allenfalls die Stimmung in der Kirche empfinden. Die künstlerischen Besonderheiten erkennt er nur, wenn er ihm diese schon aus anderen Zusammenhängen bekannt sind, er also diese hier sucht und sie erwartet und so wiedererkennt. Trifft die Kirche seine Erwartungen (Voraussagen) nicht, kann er durch Aufsuchen einer anderen Kirche anders handeln. Wenn wir als Therapeuten in einem Patienten so gar nichts von dem finden, was wir erwarten, geben wir gewöhnlich auf und schicken ihn weg. Wir sagen dann, er sei nicht behandelbar, jedenfalls nicht analysierbar. Seine Äußerungen bleiben dann ohne Zusammenhang, d.h. ohne Korrektur und ohne sie mit unseren Erwartungen in Einklang bringen zu können, isoliert stehen. Das gleiche geschieht mit den Bildern in einem Traum. Sie bleiben erratisch, bruchstückhaft und isoliert, weil wir sie nicht durch Wahrnehmungen korrigieren können und auch handlungsunfähig sind (Moutouissis et al 2014.). Wir können diese Traumbilder nicht in Einklang bringen zur Wirklichkeit oder unseren Wahrnehmungen von ihr.
Die Abwehranalyse (diese wie immer bei Erfolgsunternehmen mit Hingabe, und dies heißt hier: immer ganz dicht am Patienten) hat es aber einfacher: Sie achtet zunächst auf die Abwehr im Patienten, einschließlich der Abwehr seiner Übertragung und der Abwehr seiner Gegenübertragung auf den Therapeuten, und die Abwehr im Therapeuten selbst, namentlich auf die Abwehr seiner Übertragung auf den Patienten und seiner Gegenübertragung auf den Patienten. Wenigstens eine einzige Abwehr ist immer leicht zu finden, und mit ihr kann der Therapeut unbesorgt anfangen. Es reicht die Erwartung, wenigstens eine Abwehrform zu finden, und man muss selten diese Erwartung korrigieren.
Auch bei Filmbesprechungen fängt sie nicht einfach beim Tun und Lassen einer Figur an, sondern bei erkennbaren Abwehrformen, egal, wo im Film. Dieser Zugang macht sich unabhängig von Gesichtspunkten, auf die das Auge, das Ohr zufällig getroffen ist, und deren Fülle wegen der Entscheidungsschwierigkeiten den analytischen Prozess verlangsamen müssen.
Die Abwehranalyse greift dann ein, wenn Abwehren des Fluss zum Stocken bringen. Die Deutung von Abwehren wird dann zeigen, in welcher Ebene nach Kutter (1971, Drei-Schichten- Modell) wir uns befinden: In der Ebene der bewussten Interaktionen, oder der Übertragungs- und Gegenübertragungsbeziehungen oder der Ebene der anaklitisch-diatrophischen Gleichung, wobei diese Ebenen, dies sei kritisch angemerkt, nicht mit den Ebenen des Bewussten und des dynamisch Unbewussten übereinstimmen. Diese Ebenen tauchen nach einer Deutung der Abwehr von selbst auf, - wir müssen sie nicht erraten und können dann in dieser vorgefundenen Ebene weiterarbeiten. Wir müssen keineswegs von einer Ebene zur anderen springen.
Ferner sieht sich der heutige Analytiker gern als Biographen, Linguistiker, Lebensversteher und Lebensberater, Umwelt- und Klimaschützer, Atomgegner, als Film- und Theater- Mitreder, als – kaum zu glauben –unerbittlichen Moralisten (was z.B. Pädophilie, SM, Prostitution, bis vor kurzem auch die Homosexualität angeht), als Feministen, als Euphemisten, Pessimisten, als Möchtergern- Politiker, als Gottesankläger, als Historiker, als Stoiker, als Antifaschisten, als Gewaltgegner, als Vegetarier und Veganer, als Diagnostiker von Krankheiten, die er nicht kennt, kurzum als „Allesversteher", geradezu als „Alleskönner", als „Therapeut für Alles".
Jahrtausende hat es gebraucht, um Zuständigkeiten zu entwickeln (N. Luhmann), aber jetzt können es viele gar nicht abwarten, die analytische Zuständigkeit wieder an Andere abzutreten. Dies ist ein bedeutender Rückschritt zu eigentlich schon überwundenen Zeiten und bedeutet Resignation vor unseren Aufgaben durch Ausweichen auf andere Gebiete.
Nicht zufällig erkundigen sich heute viele Patienten schon zu Beginn danach, ob die Behandlung „patientenzentriert" sei. Sie möchten sichergehen, dass der Therapeut sich um ihr Innenleben, mit ihren inneren Konflikten kümmern wird. Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass dies nicht mehr selbstverständlich ist.
Gelegentlich heißt es ja bereits, der Patient müsse auch „Gebrauch machen können" vom Analytiker. Wenn der Patient dies nicht leisten kann, ist er selbst schuld, und der Analytiker von Verantwortung frei. Der Analytiker kann sich zurücklehnen, bis der Patient erkennt, wie er Nutzen von ihm ziehen kann. Der Patient muss zusehen, dass er sich etwas von dem kostbaren Kuchen nimmt. Die Aktivität ist auf den Patienten verlegt. Die gegenteilige Vorstellung, dass sich der Patient einfach nur behandeln lässt wie von einem Zahnarzt, also ohne eigenes wesentliches Zutun, ist natürlich nicht weniger verheerend. - Solche Selbstzentrierung (Selbstherrlichkeit) aber beleuchtet, wieweit sich Psychoanalyse heute vom Patienten und seinen Bedürfnissen entfernen kann, wenn man nicht achtgibt.
Mit Recht sind die Patienten enttäuscht, wenn der Therapeut von seiner Person, seinen philosophischen und soziologischen Neigungen und womöglich den eigenen Nöten spricht („Offenbarung der Gegenübertragung", „Man trägt Gegenübertragung"), sich so in den Mittelpunkt stellt und nicht emotional beim Patienten bleibt. Aus Sicht der Patienten sind hier die Therapieziele seltsam verrutscht, nicht selten auch die verwendete Sprache zu Fachchinesisch verkommen. Nicht der Analytiker selbst darf im Vordergrund stehen, sondern das, was beide miteinander machen und das, was im Patienten dabei vorgeht. Dies ist mit „Handwerklichem" gemeint.
Den beliebten, gängigen Auffassungen entgegen wollen die Patienten vom Therapeuten gar nicht soviel wissen, wie unterstellt („Übertragung"). Sie sind ausschließlich wegen sich selbst (einschließlich der Defizite in ihren Kontaktmöglichkeiten) gekommen, keinesfalls seinetwegen, nicht einmal der Gruppe zuliebe.
Die „Übertragungsneurose" ist in ihrem Ausmaß ein vermeidbares Kunstprodukt infolge der noch geförderten Idealisierung des Analytikers, statt diese Idealisierung als Abwehr gegen die Introspektion und gegen aggressive Impulse, die dann nicht bearbeitet werden können, zu erkennen und aufzulösen. Dies ist im Buch näher ausgeführt.
Wegen der bekannten Defizite in psychiatrischer Ausbildung, um nicht zu sagen blanker Ignoranz und nahezu völligen Desinteresses (welcher Psychoanalytiker liest psychiatrische Literatur?) nicht nur der psychologischen, sondern jetzt auch der ärztlichen Psychotherapeuten an den großen Fortschritten der Psychiatrie (während sich Psychiater in großer Zahl in Psychoanalyse / Psychotherapie engagieren und deren Literatur lesen) ist ein großes Kapitel der Gruppentherapie bei Schizophrenie gewidmet.
Dies erscheint umso notwendiger, als manche angesehene Psychoanalytiker ohne jede psychiatrische Ausbildung oder mit lediglich der Erfahrung eines Praktikums, womöglich in einer psychosomatischen Klinik ohne Psychosen, die aber nicht selten ermächtigt ist, 1, 5 Jahre Psychiatrie zu bescheinigen, fleißig über „Psychosen" schreiben und unbekümmert z.B. über einen „psychotischen Kern", einen „psychotischen Kosmos" oder eine „psychotischen Zustand einer Gruppe", aber auch bei psychiatrischer Ausbildung: einer „psychotischen Übertragung" (Kutter 1971, hier wird aber Übertragung angenommen, wo es sich um formale Denkstörungen und eine gestörte Filterfunktion, sich das jeweils Richtige aus der Fülle andrängender Gedanken herauszusuchen (Blankenburg) des Schizophrenen handelt, die mit Übertragung nichts zu tun haben, sondern nur mit seinem Unvermögen ) (nicht etwa eine Gruppe von psychotisch Erkrankten) sinnieren und dabei übersehen, dass nur die Einzelperson an einer Psychose erkranken kann. Kenntnis wird ersetzt durch die stets suggestiv wirkende Zitatitis („Freud hat gesagt, Winnicott hat gesagt"...). Lange Jahre schien festzustehen, dass Schizophrenie nichts als eine Regression zur oralen Phase oder noch weiter zurück, nur narzisstischen Mutter-Kind- Einheit, sei. Es stand so in jedem Lehrbuch der Psychoanalyse. Dies allein wäre nicht schlimm gewesen, hätten es nicht Generationen von Ausbildungskandidaten und ausgebufften Analytikern nachgebetet. Religiöser Eifer ist nicht weit davon entfernt. Noch heute wird pauschal behauptet (und nachgebetet), die Selbst-Objektgrenzen seien aufgelöst.
Viele Zitate sind des Hasen Tod, wobei der Hase hier die Eigenleistung, die Eigenbeurteilung ist, die auf der Strecke bleibt. Eine unreflektierte Zitatendiktatur.
Diese Art von „Psychoanalyse" hat sich selbst disqualifiziert. Den Anfang dazu hatte bereits Melanie Klein gemacht, indem sie ohne Not eingeführte psychiatrische Begriffe willkürlich in einem ganz anderen Sinne verwandte, statt eigene, neue zu wählen für das, was sie sagen wollte, z.B. besorgte Position statt „depressiver Position", und eine kindliche Schizophrenie als Durchgangsstadium sowie den lebenslangen Wechsel zwischen einer paranoiden und depressiven Position behauptete. Richtig katastrophal aber wirkten sich das weltweite bloße Nachschwätzen ihrer Nomenklatur und deren Verwurzelung in alle Richtungen aus, was dann als Bestätigung verstanden wird. Zu eigener Nachprüfung und eigener Urteilsbildung ist es nie gekommen.
Zitate werden als Befunde genommen und mit ihnen einträchtig verwechselt. Dies ist bis heute so geblieben Man sollte in der Psychoanalyse nichts mehr drucken, das nur auf Zitaten beruht. Psychoanalyse sollte sich auf Befunde berufen.
Außerdem interessieren sie sich nicht für den Unterschied zwischen einer schizophrenen, einer depressiven und einer hirnorganischen Psychose.
Auch solche Philosophen, Soziologen, Theologen, Historiker, Schriftsteller, die selbst über keinerlei Erfahrungen mit Psychoanalyse oder überhaupt Kranken verfügen, möchten beim Thema „Psychose" (und Psychoanalyse) mitreden und dabei den Anschein erwecken, Sachkenntnis erworben zu haben, ohne dass eigene Nachprüfung und Beurteilung möglich war oder auch nur die Notwendigkeit dazu gesehen wurde.
Vom Seelischen möchte jeder etwas verstehen, und „Psychose", erst recht „psychotischer Kern", klingt sofort nach „Tiefe" und „letzten Wahrheiten über den Menschen", wie auch bereits das populäre „Borderline", der angebliche „Grenzgänger", dessen Attraktivität er nur dem wackeren Hauch des Sensationenellen, des Unerhörten, des vorgeblichen „Wagnisses", sich „so nahe an der Psychose zu bewegen", und nicht weniger des behaupteten Wagnisses des Therapeuten, als mutiger Recke einen solchen Patienten in Behandlung zu nehmen,, der irrationalen Begriffbildung (s. Krill 2008 und andere Autoren, dort 2012, 2013) zu verdanken hat. Sie zehren hier vom Sprichwort „Wer wagt, gewinnt". Die Eitelkeit (Tiefenexperte, Kernbeißer) bleibt unreflektiert.
Wir hingegen wünschen keine letzten Wahrheiten, sondern nur den inneren Konflikt kennenzulernen. Die letzten Wahrheiten darf der Patient gerne für sich behalten.
Außerdem gehört Psychoanalyse ohnehin zu den „weichen" Wissenschaften und ist daher auch besonders anfällig für Ideologisierungen.
Diese Ausfransungen der Psychoanalyse gingen unbemerkt an deren Substanz, entfernten sie auch noch weiter, über die Wirkung des Kleinianismus hinaus, von der Psychiatrie, aus der sie entstand, werden sogar von ihr noch gutgeheißen und dürfen im Namen der Psychoanalyse sprechen. Möchte sich da noch jemand wundern, dass Ordinariate nicht mehr von Psychoanalytikern besetzt werden?
Es reicht nicht, die verheerenden Folgen der Zitatgläubigkeit zu bekämpfen, man muss auch endlich deren Ursachen angehen. Diese sind nicht in mangelndem Denkvermögen begründet, nein, denken und zitieren und diskutieren können sie, aber Zitate sind keine Begründungen, sie zeigen nur Belesenheit und Stolz auf Belesenheit, - sondern in der blinden, nicht selten sektenhaften Nachahmungstendenz des Menschen, die regelmäßig in einem kollektiven Brei endet. Wo ist die akademische Haltung geblieben? Hat man vergessen, dass Abschreiben der Wahrheit (und – so sollte es sein, ist es leider nicht - der akademischen Laufbahn) Tod ist? Die Zitatgläubigen können lediglich einen Scheinvorteil für sich verbuchen: Sie sind gut gerüstet für Diskussionen mit skeptischen Kollegen. Dies täuscht aber darüber hinweg, dass sie in der Sache selbst nichts beizutragen haben. Vielmehr fühlen sie sich durch die Verehrung der Zitierten von jeder Fehlersuche befreit und möchten diesen Eindruck beim Leser erwecken, um ihn ebenfalls von einer Fehlersuche abzuhalten und der eigenen suggestiven Position Beifall zu spenden. Ein weiteres Motiv, einen Hochverehrten immer wieder zu zitieren, mag darin liegen, dass der Zitierende dadurch sein Ansehen auch dann schützt, wenn die übersehenen Fehler offensichtlich werden. Er kann sich so hinter dem Zitierten verbergen, und wenn sich herausstellt, dass die Leistungen des Zitierten nicht so hoch waren, wie immer behauptet, ist der Zitierende vor Vorwürfen geschützt.
Wegen der großen Bedeutung der Gruppentherapie einschließlich der Gruppenanalyse ist auch die Anwendung auf Mentalisierungsstörungen, Somatisierungsstörungen und hypochondrische Entwicklungen beschrieben.
Inhaltliche Wiederholungen im Text sind unbeabsichtigt, beabsichtigt und unvermeidbar zugleich. Ein Lektor hätte sie aufgespürt und erbarmungslos ausgemerzt, aber womit hätte ein präsumptiver Leser, dem zunächst erst einmal ein präsumptiver Käufer vorangehen müsste, ein solches Maß an Aufmerksamkeit verdient? Alles für den Leser? Soll er es gut haben in seinem Ohrensessel? Der Leser kann sogar von Glück reden, dass ein Lektor nicht zum Zuge kam, denn so manches kann er gar nicht oft genug lesen. Auch wenn ich es mir mit dem Leser verderbe, möchte ich ihn auf das zurechtstutzen, was er ist, eben nur der Leser, der zum Stück nichts beigetragen hat. Es gibt keinen vernünftigen Grund, ihn zu hofieren. Außerdem berufe ich mich auf Ciceros Ausspruch: „Ich habe keine Zeit, kurze Briefe zu schreiben". Und hier handelt es sich nicht um einen Brief, sondern ein Buch. Erst recht darf ich beanspruchen: Quod licet Ciceroni, licet mihi. - Die zahlreichen Überschneidungen sind ohnehin unvermeidlich und zugleich unentbehrlich, da gleiche Themen immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen auftauchen und so andersartige Aspekte bieten, aber dies soll nicht die Rechtfertigung sein.
Die deutsche (oder Ihre) Sprache wird bevorzugt, weil sie jeweils meine (unsere, Ihre?) Muttersprache ist, weil sie in vielem genauer ist als die englische und weil sie zudem viele falsche, gedankenlos gebrauchte Anglizismen (so „Regulation" (mittels Schräubchen? Wie ein Schleusenwärter?) statt Beeinflussung, „Kontrolle" - von control -, statt Beherrschung, beherrschen) vermeiden kann. Nicht nur aus sprachlichen Gründen hat Frankreich die Verwendung von Anglizismen verboten. Die Unkenntnis angloamerikanischer Idiomatik ist erschreckend, aber etwas eigenes Nachdenken (sind wir Akademiker oder nicht?) würde schon helfen. So heißt „substance abuse" nicht Substanzmissbauch, sondern Drogenmissbrauch, „asylum" nicht Asyl, sondern beschützendes Heim. Wird das Feuer kontrolliert oder gelöscht („to control")? Bereits hier ist die verhängnisvolle Nachahmungstendenz („umgekehrt rheotaktisch") in der Psychoanalyse deutlich, nicht nur in Gruppendiskussionen, wo sie nur zu oft alles beherrscht. Sollen psychoanalytische Institute zu Einrichtungen verkommen, die bloße Anpassung fördern?
Für „Potenzen", über die ja jeder Patient reichlich verfügt, denn sonst könnte er ja nicht einmal die Stunden einhalten und pünktlich bezahlen sowie keinen Beruf ausüben oder kein Studium verfolgen, und die auch in der Abwehr („Abwehrleistung") liegen, sind wir streng genommen nicht zuständig, wenn sie natürlich auch in der Psychoanalyse von größter Wichtigkeit sind. Aber wir müssen nicht für alle seelischen Erscheinungen von größter Wichtigkeit aufkommen, sondern nur für die pathologischen davon. Wir haben Krankheiten, Konflikte, zu behandeln, nicht Potenzen. Die Einrede, dass man beiden nicht trennen könne, ist eine Ausrede (elusion, evasion, otgoworka), und zwar eine Rationalisierung (und also definitionsgemäß richtig, aber nicht für diesen Fall zutreffend, - das ist ja das Raffinierte an der Rationalisierung) dafür, dass man nicht bereit ist, sich auf pathologische, d.h. symptomverursachende, „symptomrelevante" Konflikte, zu konzentrieren. Ich glaube auch hier, dass man „gern bereit ist, über alles zu reden", wenn man nur um die Mühe herumkommt, den inneren Konflikt ins Auge zu fassen, - eine phobische Reaktion. Aber in einem weiteren Sinne sind wir sehr wohl zuständig: Wir haben die Aufgabe, Hindernisse im Patienten zu beseitigen, die ihn an der Selbstorganisation, die immer in Richtung Selbstoptimierung, maximales Wachstum, geht, also an der vollen Potentialentfaltung, behindern, und wir haben die angeborene Zuversicht hierzu, wenn sie denn verlorengegangen ist, wiederherzustellen..
Ähnlich verhält es sich mit den Primärfiguren und früheren und jetzigen Außenfiguren. Sollte man nicht schleunigst „alle Figuren aus dem Behandlungszimmer herauswerfen", wie einmal von einem Analytiker gefordert (Bion? Winnicott? Freud gewiss nicht) und sich auf das konzentrieren, was in der Stunde abläuft? Und sich mit Begeisterung auf die Stunde konzentrieren?
Auch hier wird große Mühe darauf verwandt, die verzwickten Beziehungen in der Vergangenheit und Gegenwart sowie deren Aufscheinen in der Übertragungs- Gegenübertragungsbeziehung aufzudecken, mit viel schlauer, oft hinterlistig wirkender Überlegung, um nicht zu sagen Rabulistik, d. h. reichlichem Gebrauch von intellektualisierenden Konstruktionen, das mehr oder weniger in eifrigem Parallelenziehen zwischen Vergangenheit und Gegenwart besteht. Nur an den inneren Konflikt will man nicht heran. Dies kann auch Mangel an Respekt vor der Wucht des inneren Konflikts sein, aber es kann auch die Angst vor dem Gestrüpp des inneren Konflikts sein, und die daraus folgende Resignation. Man glaubt nicht wirklich, denn inneren Konflikt lösen zu können, will sich aber gutwillig, und zwar mit Ersatzleistungen, zeigen.
Wer kennt nicht das Beispiel eines Schulkindes, das eher bereit ist, die Kohlen aus dem Keller zu holen und schwere Gartenarbeit zu verrichten, und dies besser und fleißiger als jemals zuvor, als sich an die eigentlich simplen Schulaufgaben zu machen? Oder das des Novizen, der eine jahrhundertealte, äußerst mühevolle, scharfsinnige und mit Zitaten von Autoritäten gespickte Diskussion in seinem Kloster mit dem Vorschlag beenden wollte, einmal in das Maul des Pferdes hineinzuschauen. Das Kloster war dazu keinesfalls bereit, gab sich aber größte Mühe, den Novizen mit einer Unzahl von Argumenten und mit klugen Zitaten zu widerlegen. Nicht wenige Studenten schieben das Examen auf (Prokrastination), lernen vielleicht statt dessen noch schnell eine Fremdsprache.
Eine eigenartige Scheu vor den naheliegendsten und keineswegs schwierigen Aufgaben, die rational unverständlich ist. Hat eine konkrete Aufgabe, die nur wenig Fleiß und Genauigkeit erfordert, aber schon deshalb Angst und Schuld- und Schamgefühl verursacht, der Aufgabe nicht gerecht zu werden, schon von sich aus die Eigenschaft, neurotische Vermeidung auf sich zu ziehen? Die betroffenen Personen scheinen dies kaum verhindern zu können. Die Neurose scheint von Aufgaben angezogen zu werden. Zuerst ist die Aufgabe da, die Neurose folgt ihr dann auf dem Fuße, wie der Schlüssel zum Schloss, das nur auf den Schlüssel wartet.
Aber mit dieser Überlegung hätte man sich ebenfalls von der Aufgabe der Bearbeitung des Konflikts entfernt, wenn dieser nicht doch gerade noch eben, sozusagen rechtzeitig, von mir benannt worden wäre, weil auch ich das Aufschieben und das Abweichen von der Aufgabe gerade noch rechtzeitig bemerkt habe und diese Passage vom Konflikt einschieben konnte.
Im Übrigen ist das Aufschieben nicht nur ein Symptom unter anderen, sondern stellt selbst einen großen psychischen Schaden dar, weil es weiter Schuld- und Schamgefühle verursacht sowie, wie bereits jeder innere Konflikt, ein Gefühl außerordentlicher innerer Schwäche vermittelt. „Neurose zehrt gewaltig am Selbstgefühl". Vom Befinden her ist es oft besser, im Examen „richtig durchgekracht" zu sein, als ewig aufzuschieben. Wir dürfen nicht vergessen, dass Symptome selbst erneut konfliktauslösend und deshalb schleunigst zu bessern sind, auch durch eine Kombination mit kurzer VT oder klarer Strukturierung des Tagesablaufs.
Zu den Aufgaben eines Psychoanalytikers gehört es auch, zu einer einigermaßen abgesicherten Diagnose zu kommen. Wie sind diese nicht nur den Leistungsträgern schuldig, sondern vor allem dem Patienten und uns selbst. Namentlich der Patient hat einen moralischen und einen Rechtsanspruch darauf, zu erfahren, an welcher Erkrankung er leidet. Wir alle kennen die Schwierigkeiten mit der ICD10, die auf unserem Fachgebiet mit rein deskriptiven Diagnosen arbeitet. „Depression" allein ist keine Diagnose (Krill 2008), Prof. Walde 2014, mündliche Äußerung), sondern ein Symptom, höchstens ein Syndrom. Nur Nichtpsychiater (wie kann man ein dickes Buch über „Depression" schreiben, wenn man offenbar nicht gelernt hat, Näheres zu unterscheiden? Antwort: Um zu großen Zahlen zu kommen, wenn auch ohne denkbare Aussagekraft. Die großen Zahlen werden für Drittmittel benötigt.) und die ICD10 werfen eine psychotische Depression, die etwa in jedem Frühjahr und Herbst auftritt und mit charakteristischen Durchschlafstörungen, evtl. Schuldwahn und Krankheitswahn einhergeht und oft auf Thymoleptica anspricht (immerhin 4 % der Bevölkerung leidet an einer MDK, manisch-depressiver Krankheit, einer Psychose), eine reaktive Depression nach Verlust eines wichtigen Objekts in der Familie oder eines Haustieres, eines Vermögensteils oder der Heimat, und eine neurotische Depression infolge eines kräftezehrenden inneren Konflikts, etwa auch eines ödipalen Konflikts oder auch einer sog. frühen Störung, in einen Topf und unterscheiden, der ICD10 gehorsam, nur noch nach Schweregraden der depressiven Stimmung. Die führt zu dem grotesken Ergebnis, dass leichte depressive Verstimmung psychotherapeutisch behandelt werden sollen, obwohl ein Teil von ihnen aufgrund einer leichten psychotischen Depression erkrankt ist, die aber nicht erkannt wird. Umgekehrt werden schwere depressive Verstimmungen dann mit Psychopharmaka behandelt, obwohl sie neurotischer oder reaktiver Genese sind.
Aus diesen Gründen können auch psychoanalytische Arbeiten über „die Depression" zu keinem psychoanalytischen Ergebnis führen.
Das gleiche gilt für „Psychose". „Psychose" allein ist keine Diagnose. Nichtpsychiater haben auch hierin einen Nachholbedarf. Niemand hindert sie daran, zwischen schizophrener Psychose und deren vielen Unterformen und Stadien, depressiven Psychosen („Endogenen Depressionen") und hirnorganischen Psychosen (so Delir, etwa aufgrund von Substanzmissbrauch oder Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes, sowie Dämmerzuständen bei Epilepsie), zu unterscheiden, nur ihr Unwissen. sowie ihre Gehorsamkeit gegenüber der ICD-10-.
Traditionspflege wird in der Psychoanalyse z.Z. großgeschrieben. Dabei wird übersehen, dass seit Freud zwar unser Wissen zugenommen hat, aber nicht weniger auch die Fehlerhaftigkeiten und Einseitigkeiten, die fleißig tradiert, um nicht zu sagen nachgebetet, werden. Auch davon rührt die Skepsis an den Universitäten. Andererseits darf nicht vergessen werden, dass Fehlerhaftigkeiten nicht weniger als die Richtigkeiten zur Entwicklung einer Wissenschaft beitragen.
Darüber hinaus ist gerade die Abwehranalyse wie keine andere analytische Methode geeignet, zukünftige Forschungen zu fördern, da sie im Vergleich zu anderen einzigartig genormt erscheint. Namentlich kann sie zu einer neuen Betrachtungsweise beitragen: Zu einer Erfassung von psychischen Krankheitsbildern und deren fortschreitenden Behandlungsfähigkeit sowohl horizontal (in verschiedenen Kulturen) als auch gleichsam vertikal (im bisherigen und weiteren Zeitverlauf). Ohne einen festen Maßstab ist weder das eine noch das andere möglich.
Das neue Fachgebiet könnte heißen: Entwicklung der Psychoanalyse in lokalen (kulturellen) und zeitlichen (temporären) Dimensionen oder: Analysehistorische Datenerhebung.
Wissenschaftsgeschichte trägt auch zur Entzauberung von Mythen bei (Entidealisierung), also ebenfalls auf diesem Wege zur Weiterentwicklung jeder Wissenschaft (bessere Bodenhaftung). Sie lässt auch im Rückblick die Entwicklung verschiedener Denkstile (Ludwik Fleck) und Paradigmenwechsel (Thomas S. Kuhn) besser erkennen als nur im Rundblick.
Freuds anfänglich grenzenloser Optimismus („...mit dem letzten Worte der Analyse schwindet das ganze Krankheitsbild..." (Freud 1895, S. 304).ist einer Ernüchterung gewichen. Therapeutische Erfolge der Psychoanalyse sind nachgewiesen, aber weltbewegend sie sie nicht, vor allem nicht in angemessen kurzer Zeit (s.o.).
Abwehranalyse des Traums ist höchst ergiebig, wird aber selten angewandt (Krill 2008, 234 ff). Vielen Therapeuten ist Abwehranalyse offenbar zu mühsam.
Mehr oder weniger zeigt jeder erschreckende Traum einen kürzeren oder auch tagelangen Nachhall in Form einer emotionalen Verstimmung.
"Nachhall" (u.a. mündliche Mitteilung Morgenthaler 1970) ist m. W. in der Literatur nicht bearbeitet.
Nachhall ist die emotionale Einfärbung des gesamten Innenlebens (nach meinem Erleben) nach einem Traum, kann den ganzen Tag anhalten, klingt erst allmählich ab, - wie wenn das ganze Gehirn mit depressiver Stimmung vergiftet wäre. Er ist stundelang nicht abzubremsen, auch nicht durch Beschäftigung mit anderen Themen oder intensive Arbeit. Bei angenehmen Träumen ist der Nachhall weniger intensiv und kürzer.
Außer Abwehr des unangenehmen Nachhalls "Wendung vom Passiv ins Aktiv" nach Loevinger (1966, Krill 2008) ist hier nichts an anderen Abwehren zu sehen. Man fühlt außerdem, dass dies nur wenig hilft. Man weiß im Stillen, dass Zeit alles heilt, und vertraut darauf.
Theoretisch müsste auch wichtig sein, wie man mit einem so schlechten Nachhall umgeht. Welche Abwehren werden eingesetzt? Es sind oft gar keine zu finden. Der Patient ist einfach nur „erledigt" für den Tag. Er steht unter dem Eindruck von Machtlosigkeit. Eine leise Hoffnung dabei: Das kann ich nicht bewältigen, das muss mein Körper machen, also ich nicht selbst, oder ein leises, tiefes Vertrauen zum Körper, den ich aber nicht beeinflussen kann. So etwas wie die eigene Natur, die Biologie die Evolution an sich. Das wäre immerhin Abwehr durch leise, lahme Verschiebung (von der Person weg auf die Biologie, auf den Körper). dabei hat man nicht das Gefühl der aktiven Ingangsetzung von Abwehr wie bei anderen Abwehren. Mehr ist der Träumer dabei Zuschauer, - aber ohne dass eine Depersonalisation vorliegt.
Oder Gefühl, die Zeit wird es richten. Im Grunde nähert sich dies an Resignation an.
Blechner (2001) hält nichts von freier Assoziation bei der Traumdeutung oder der Wunscherfüllungstheorie Freuds, auch nichts von der Übertragung (und Gegenübertragung! Eine solche hat auch der Patient auf die Übertragung von Seiten des Analytikers) des Patienten auf seinen Analytiker und auch nichts von der Gegenübertragung (und Übertragung auf den Patienten. Denn auch der Analytiker hat eine Übertragung) des Analytikers auf den Patienten, aber viel von systematischer Untersuchung nach 18 Punkten (Krill 2008, 234 ff, dort auch eine ausführliche Besprechung eines Traums nach den Kriterien von Blechner):
1) Kompensation für einseitige bewusste Haltungen.
2) Der Traum teilt etwas mit, das anders nicht mitgeteilt werden kann.
3) Der Traum entsteht nach dem „random firing", dem Zufallsprinzip, und wird
anschließend vom Träumer interpretiert, analog dem Rohrschachtest.
4) Der Traum versteht sich als Hausreinigungsaktion.
5) Er dient der Festigung und Integration von Informationen.
6) Frühe Erfahrungen werden erinnert und mit gegenwärtigen integriert.
7) Der Traum wirkt stimmungsausgleichend, also ähnlich der
Wunscherfüllungstheorie Freuds.
8) Der Traum wirkt als Eigentherapie.
9) Es wird von einem sicheren Platz aus geträumt.
10) Der Traum als „a potential source of highly creative-out-of- the box-thinking".
Neues, kreatives nonlinguistisches Denken. Der Traum ist zufallsgeneriert und
wird vom Träumer nach neuen, brauchbaren Ideen abgesucht. Dient hier also der
Evolution neuer Ideen und damit der Evolution überhaupt („oneiric darwinism").
Eigentlich ist hier nur Punkt drei weiter ausgeführt.
11)Träume vermitteln dem Träumer eine Einschätzung des aktuellen und zukünftigen
psychischen Zustandes, also seiner Gesundheit vs. Krankheit.
12) Träume sind ehrliche Produktionen („honest communications", Lügen ist im
Traum nicht möglich. Erst hinterher kann der Traum durch Lügen verändert
werden.- Anm.: Der zitierte 56j. Patient (Krill 2008, 235 ff) hatte aber doch in
seinem Traum gelogen. Er forderte zwei Pullover (die ihm realiter geschenkt
worden waren) von einem Anderen, der sie besaß, zurück und belog dazu das
Gericht, die Pullover gehörten ihm, obwohl ihm im Traum klar war, dass diese
ihm nicht gehörten.
13)
Die Regeln sind traumeigen, einzigartig. Weder verhüllen sie alles, noch decken
sie alles auf eine leicht zu verstehende Weise auf. Dennoch enthalten sie wichtige
Informationen über unsere Persönlichkeit.
14) Klangassoziationen, Verdichtungen und verbale wie nonverbale
Merkwürdigkeiten können zu bewussten Ideen führen.
15) Jede Interpretation ist in die Kultur und Ära des Interpreten mit seinen Glaubenssystemen („belief systems") eingebettet. Anm.: Dies ist leicht gesagt und gewiss eingängig, da es mit dem ephemeren Gerede von kultureller Beeinflussung unserer Patienten - und deren häufiger Funktion der Ausflucht vor der therapeutischen Aufgabe - übereinstimmt, aber es käme darauf an, diese „Erkenntnis" für den Patienten in einer bestimmten Behandlungssituation nutzbar zu machen, und solches habe ich noch nie hören oder lesen können. Auch in „Die Unwirtlichkeit unserer Städte" (Prof. Mitscherlich 1965) oder später war kein Patient aufgezeigt worden – dies war nicht einmal Intention -, der davon krank geworden wäre, auch wenn Tilmann Moser (mündliche Mitteilung 1977) fortan von Krankfurt sprach (anders Prof. Ammann 1970: „Nach meinem Umzug von Regensburg nach Frankfurt konnte ich endlich wieder durchatmen").
Die „kulturelle Einbettung", die sich auch gern als „Postmodernismus" (z.B. Frie et al. 2009) bezeichnet, lebt von einem falschen Feindbild („cartesiche absolute Gewissheiten", Civitarese et al. 2016). Wann soll in der Psychoanalyse ein Cartesianismus i.S. des Individuums als völlig unabhängig von den äußeren Umständen vertreten worden sein? Auch hier dient ein solches Feindbild nur als Ausflucht vor der Aufgabe, sich mit dem Innenleben und seinen Konflikten zu befassen.
16) Am Traum und an der Deutung des Traums sind somit beteiligt: Der Träumer, seine Biologie („firing"), Deuter des Traums, der soziale Kontext. Anm.: Auch dies ist leicht gesagt. Diese verschiedenen Faktoren soll erst mal jemand zusammenbringen und in einem konkreten Fall darstellen. Programme sind gut, Nachweise besser.
17) Deutungen können mehr schrittweise (etwa nach der Abwehrtheorie: Dass abgewehrt wird, wie abgewehrt wird ((Abwehrmechnismen)) und was abgewehrt wird ((Wünsche libidinöser oder aggressiver Art, Ängste, Trauer, Schuld- oder Schamgefühle)) oder mehr „ganzheitlich" erfolgen, - wobei niemand weiß, was das genau ist, - ist es eine Deutung nach Bauchgefühl? Oder ein bizarrer, „nicht zur Sache" gehöriger Einfall? Dieser kann aber sehr wohl eine große therapeutische Wirkung entfalten, s. „aberrante Deutungen" (Verf. hier), „abduktive" Deutungen. Bardè 2016, Peirce 1991).
18) Mit dem Erzählen des Traums wird dieser zu einem Gruppenphänomen. Hier wird aber einmal mehr so getan, als trage dies zum Verständnis bei. Gewiss wird dann viel diskutiert, aber alles nicht dazu Passende wird regelmäßig unter den Teppich gekehrt, bald ist auch die Zeit um, und es bleibt bei Scheinergebnissen, zu oft mit gruppenhaftem Abnicken, - schlammige Situation, Krill 2008, 227 ff. Hier wird die Gruppe als Ausflucht vor der analytischen Aufgabe, die sie keineswegs ersetzen kann, benutzt. Das Vertreten einer Gegenposition ist in einer Gruppe völlig unmöglich, zumal die Zeit abgelaufen ist.
Bion entwickelt eine eigene Denkweise und spricht von der
Fähigkeit der Mutter zur Träumerei und der Traumaktivität. Erstere ist die
Fähigkeit der Mutter, die identitätsbildenden Projektionen ihres Säuglings zu
empfangen, die "Beta Elemente", und sie zu « entgiften » („detoxify"), bevor sie ihm diese, verwandelt in „Alpha Elemente", zurückgibt.
Die Traumaktivität ist eine Funktion, die stets am Werk ist. Sie ist es, welche
die aktuellen Ereignisse, die « Tatsachen » der erlebten Erfahrungen, in
traumfähige Elemente verwandelt.
Der analytische Prozess aktualisiert diese primitive Mutter-Säugling Situation
wieder und öffnet, in der Bionschen Optik, den Traum für eine
zwischenmenschliche Herangehensweise.
Gegen diese Bionschen Thesen lässt sich einwenden, dass sie wie so viele nicht durch klinische Berichte unterlegt sind, sondern vielmehr pauschal-theoretisierenden Charakter tragen. Die Verwendung einer quasi- naturwissenschaftlichen Ausdruckweise kann nicht die zuverlässige Beobachtung ersetzen, die jedes Konzept benötigt.
Literatur
Arlow J.A & Brenner C 1964: Psychoanalytic concepts and the Structural Theory, NY Int Univ. Press
Benjamin Bardè (2012):Wagnis Psychoanalyse, Brandes & Apsel, Frankfurt
Bardè 2015: www.dr-benjamin-barde.de, unter: „Behandlungsangebote und Behandlungsmethode").
Bardè B & Jordan J (2015): Klinische Psychokardiologie, Brandes & Apsel 2015
Blankenburg W 2012: Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit , - zur Psychopathologie symptomarmer Schizophrenien, Parodosverlag
Bion W R (1967): Notes on memory and desires. Psa Forum , 2, 272-275
Blechner, M J (2001): The dream frontier. Hillsdale NY (Analytic Press)
Brenner Charles 2003:: Conflict, compromise formation and structural theory Psa Q LXXI,3, 397-418
Civitarese G, Katz S M, Tubert-Oklander J 2015 Prologue Postmodernism and Psychoanalysis Psa Inq Vol 35, No4 , 562 ff
Dantlgraber J (2012): Bedeutungsbildungen durch >>musikalisches Zuhören<<, in Benjamin Bardè :Wagnis Psychoanalyse, Brandes & Apsel, Frankfurt
Doi T (1986): The anatomy of Self- the individual versus society, trans. M. A.. Harbison, Tokyo: Kodansha International
Dorpat Theo L 1979: Is splitting a defense? Int Rev Psa 6, 1, 105-114
Eagle M N 1988: Neuere Entwicklungen in der Psychoanalyse, Verlag Internationale Psychoanalyse (US Orig 1984)
Eickhoff, F.-W. (2001): Sigmund Freuds »Bemerkungen ueber die Uebertragungsliebe«, wiedergelesen im Jahre 1992. In: Freud heute, Wendepunkte in Streitfragen. Bd. 3: Ueber Freuds Bemerkungen über die Uebertragungsliebe. Stuttgart/Bad Cannstatt (frommann-holzboog), S 43–72.
Freud (1895): Studien über Hysterie, GW I.
Frie R & Orange D (2009): Beyond Postmodernism. New dimension in theory and practice. London Routledge
Gill M 1994: Conflict and deficit Psa Q LXIII, 4, 756- 778
Gon S 2016: On becoming and being a psychoanalyst in Japan: What was the Amsterdam shock? Psa Inq Vol 36, No. 2/Febr.-March 2016, 145-154
Gray Paul 1982: Developmental lag in the evolution of technique for psychoanalysis of neurotic conflict J Am Psa Assn 30, 621-655
Hartmann H 1950::Comments on the psychoanalytic theory oft the ego Int Univ Press, 113.141
Holt R R 1976: Drive or wish? NY Int Univ Press
Huber G Gross G Schüttler R 1979: Schizophrenie Berlin Springeverlag
Kano R (2010): The Japan Psychoanalytic Society and the Japan Psychoanalytical Association their history of coexistence and their future. Japanese Contrib. to Psychoanal., 3: 223-242
Kendell R E 1978: Die Diagnose in der Psychiatrie Verlag Enke Stuttgart
Kitayama O (2016) Becoming a psychoanalyst: To think about the nature of jealousy,
Kinugasa T 2016: Encounter with psychoanalysis: How I became a psychoanalyst, Psa Inq Vol 36, No. 2/Febr.-March 2016, 129-137
Kosawa Hekasu (1897-1968): 1932 with Freud,
Krill M (2001): Kompromisstheoretische Deutung der Posttraumatischen Belastungsstörung. In: DPV-Informationen, Nr. 31, S. 21–23.
Krill M (2003a): Borderline- Störungen – Sammelbecken für unklare Fälle? In: Neurotransmitter 9, 61–64.
Krill M (2003b): Erfahrungen mit dem Gutachterverfahren. Neurotransmitter 11, 33–37.
Krill M (2005): Erotische Übertragung – Cybersex mit dem Therapeuten. In: Neurotransmitter, 2005, 11, 46–48.
Krill M (2008): Das Gutachterverfahren für tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie, ein Handbuch, 376 Seiten, Psychosozialverlag Gießen
ISBN 978-3-89806-773-7
Krill M ( 2010):Zur Buchvorstellung „Briefwechsel Sigmund Freund- Nikolai Jewgrafowitsch Ossipow 1921-1929" im FPI Frankfurt , in DPV- Informationen Nr. 49, S. 96-98
Krill M (2011): Das Ende des Ödipus, Sophokles: Ödipus in Kolonos („Oidipous epi Kolonō"),- psychoanalytisch neu gelesen, Verlag Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Bern, Berlin, Frankfurt, Oxford, Wien, Brüssel, New York
Krill M (2011): Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TfP) und analytische Identität, in DPV-Informationen, Berlin, Nr. 51, 47 ff.
Krill M (2012) Drehbuch zum Drama Sophokles` „Ödipus in Kolonos", ISBN 978-3-9815177-
-5, Verlag 978-3-981 5177
Krill M (2012) Klassische Psychoanalytische Kompromisstheorie:
Symptombildung als Kompromiss ISBN 978-3-981 5177-1-2 , Verlag ISBN 978-3-981
5177
Krill M (2012): Psichoanalititscheskaja teorija kompromissa: Obrazowanie simptomow kak
kompromiss. Jezschegodnik istorii i teorii psichoanalika, T. 5., ERGO
Krill M (2014): Rezension: Dr. phil. Jörg M. Scharff: Die leibliche Dimension in der
Psychoanalyse, Brandes & Apsel,1. Auflage, 2010, 205 Seiten, ISBN 978-3-9815177-7-4
Dr. Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse (ISBN 978-3-9815177)
D-61462 Königstein im Taunus
Krill M ( 2016) Brief an die Japanische Psychoanalytische Gesellschaft (JPS), in Dr. Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse
D-61462 Königstein im Taunus
Laplanche J Pontalis, J-B. (1967): Vocabulaire de la psychanalyse Paris (Presses Universitaires
de France). [Dt. (1973): Das Vokabular der Psychoanalyse. Aus dem Französischen
von Emma Moersch. Frankfurt a. M. (Suhrkamp).]
Ogawa T (2016): How I became a psychoanalyst: A journey in quest of the truth, Psa Inq Vol 36, No. 2/Febr.-March 2016, 117-128
Ogura K: 2016: Prologue: Psychoanalysis in Japan: Exploring the encounter with Otherness , Psa Inq Vol 36, No. 2/Febr.-March 2016, 115-116
Okada A (2016): On becoming a psychoanalyst in Japan, Psa Inq Vol 36, No. 2/Febr.-March 2016, 155-161
Okano K (2016): My path toward becoming a bicultural analyst: An autobiographical sketch, Psa Inq Vol 36, No. 2/Febr.-March 2016, 138-144
Okudera T (2016): Epilogue: Psychoanalysis in Japan: Exploring the encounter with otherness, Psa Inq Vol 36, No. 2/Febr.-March 2016, 195-196
Phillips H (2006): Paul Gray’s narrowing scope: A "developmental lag" in his theory and technique. J Am Psa Assn, 54, 137–170.
Peirce, Charles 1991, Schriften zum Pragmatismus und Pragmatizismus, 2. ed. (hrsg.
K.O. Apel). Übersetzt von G. Wartenberg. Frankfurt a.M. 1991: Suhrkamp.
Racker H (1959): Uebertragung und Gegenuebertragung, Verlag Enke, Stuttgart (übersetzt ins Englische 1968, Hogarth)
Rapaport D. Gill M M (1959): Introduction: A historical study of psychoanalytic ego psychology. Psychoanalytic Issues, 1, 1–17.
Rapaport D (1960): The structure of psychoanalytic theory: A systematizing attempt. Psychological Issues, Monogr 6, New York (Int Univ Press). [Dt. 1960: Die Struktur der psychoanalytischen Theorie. Versuch einer Systematik. Beiheft zur »Psyche«, Stuttgart (Klett).]
Renik O. (1993): Analytic Interaction: Conceptualizing technique in light of the analyst’s irreducible subjectivity. Psa Q, 62, 553–571.
Renik O. (1998): Getting real in analysis. Psa Q, 67, 566–593.
Renik O. (1999a): Muendliche Mitteilung am 19.1.1999 in Frankfurt a.M.
Renik O. (2001): The patient’s experience of therapeutic benefit. Psa Q, LXX, 1, 231–242.
Renik O. (2002): Defining the goals of a clinical psychoanalysis. Psa Q, LXXI, 1, 117–124.
Sampson H Weiss J. (a 1977): Research on the psychoanalytic process. Bulletin 5.
Sampson, H.; Weiss, J.; Gassner, S. (b 1977): Research on the psychoanalytic process. Bulletin, 3.
Sampson H (1982): Psychotherapy Research, Bulletin, 5.
Schafer R. (2005): Conflict: conceptualization, practice, problems. Psa Q, LXXIV, 1, 47–64.
Shapiro T (1981): On the quest for the origin of conflict. Psa Q 50,1-21
Schlierf Ch (1998): Nachlese zu Owen Renik. In: FPI-Forum, Zeitschrift der Mitglieder des Frankfurter Psychoanalytischen Instituts e.V., Heft 7 (4.5.1998).
Schmidt-Hellerau C (2005): The other side of Oedipus, Psa Q, LXXIV, 1, 187–218
Schneider K 1950: Klinische Psychopathologie Thiemeverlag Stuttgart
Schwaber E A: Chapter 4: Heading the vocabulary of another culture: Psychoanalysis in Japan, Psa Inq Vol 36, No. 2/Febr.-March 2016, 182- 186
Shapiro T (1981): On the quest for the origins of conflict. Psa Q, 50, 1–21.
Stone L (1973): On resistance to the psychoanalytic process, Int J Psychoanal 50, 275-92
Strachey J (1934): The nature of therapeutic action of psychoanalysis, Int J Psychoanal 50,275-292
Takahashi T (2010): Revolution of Japanese psychoanalysis- a preliminary report by an extended homecoming analyst. Japanese Contrib. to Psychoanal., 3: 196-199
Takahashi T (2016): Splitting, conflict, resolution and realization: Reflective association of a psychoanalytic pilgrim, Psa Inq Vol 36, No. 2/Febr.-March 2016, 187-194
Thomä H (2012): Psychoanalytische Ausbildung – eine utopische Vision ihrer Zukunft, 48-76, in B. Bardè & E. Bolch: Wagnis der Psychoanalyse ,
Brandes & Apsel FrankfurtWalde Christine 2001: Antike Traumdeutung und moderne Traumforschung. Artemis & Winkler Duesseldorf , Zuerich
Weiss J Sampson H: The Mount Zion Psychotherapy Research Group (1986): The psychoanalytical process. Theory, clinical observation and empirical research. New York (Guilford).
Weiss J (2003): Development of a research program. In: Psa Inq, 23, 2, 350–366.
Werner H (1940): Comparative psychology of mental development, N Y, Int.Univ Press
Wurmser Leon 1995, in Scott Dowling, Madison, The psychology and treatment of addictive
behaviour, NY Int Univ Press
Bücher
|
Das Gutachterverfahren für tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie Verlag: Psychosozialverlag, Gießen ISBN: 978-3- 89806-773-7
|
|
Ödipus' Ende, Sophokles (497/96-406 v. Chr.) Verlag: Peter Lang, Frankfurt ISBN: 978-3-631-61407-5
|
|
Klassische Psychoanalytische Kompromisstheorie Verlag: Dr. Krill Verlag, Königstein ISBN: 978-3-9815177-1-2
|
|
Sophokles Ödipus in Kolonos Drehbuch von Manfred Krill Verlag: Dr. Manfred Krill Verlag, Königstein ISBN: 978-3-9815177-0-5
|
|
Anorexia nervosa und Aggression Neue Psychodynamik nach der Klassischen Kompromisstheorie Verlag: Dr. Manfred Krill Verlag, Königstein ISBN: 978-3-9815177-0-5
|
|
Klassische
Psychoanalytische Kompromisstheorie und ihre Auswirkungen und
Nichtauswirkungen auf Psychoanalytiker, Patienten und Gesellschaft
Symptombildung als Kompromiss ISBN 978-3-9815177-5-0
Gruppenanalyse Neu, 158 Seiten, Preis 56 Euro gegen Vorauskasse Verlag: Dr. Manfred Krill Verlag, Königstein ISBN
978-3-9815177-6-7
Neue
Traumatheorie Das Schicksal der spontanen Traumafolgen: Einkapselung, Patinabildung,
Innere Auszehrung (Tafonisierung), aktive Zertrümmerung, Erosion,
einfacher Zerfall, spontane oder aktive Auflösung, Assimilation,
Ausscheidung? Das Schicksal der Traumaanalyse. von Manfred Krill
The
rehabilitation of movement-disturbed patients What
can modern psychoanalysis contribute to it? von
Manfred Krill ISBN 978-3-9815177-7-4
Dr. Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse (ISBN
978-3-9815177), D-61462 Königstein
Как
работает
психоанализ
в
групповом
анализе? von Manfred Krill ISBN
978-3-9815177-8-1 Dr.
Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse (ISBN 978-3-9815177) D-61462 Königstein im Taunus
Analyse durch Freud Die Sitzungsprotokolle Ernst Blums 1922 - psychoanalytisch neu gelesen Lehranalyse, Ausbildungsanalyse, Selbsterfahrung: Wirklich unentbehrlich? Wirklich keine rechtlichen Bedenken? von Manfred Krill ISBN 978-3-9818213-2-1 Dr.
Manfred Krill Verlag für Psychoanalyse (ISBN 978-3-9815177) D-61462 Königstein im Taunus
Krill, Manfred / Tuin, Inka: (2018)Gestörter Schlaf und Schlaflosigkeit , in Krovoza, Alfred / Walde, Christine: (2018) Traum und Schlaf, ein interdisziplinäres Handbuch , 316- 329, J.B. Metzler Stuttgart, imprint Springer Verlag, Springer Nature ISBN 978-3-476-02486-2
Friedrich Hölderlin (1770-1843) Eine Pathographie ISBN 978-3-9818213-2-1
Karl May (1842-1912) ISBN 978-3-9818213-5-2
Letter to Japan Psychoanalytic Society
|